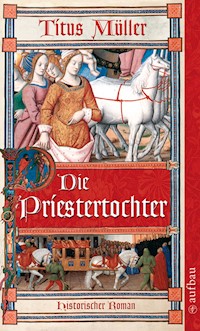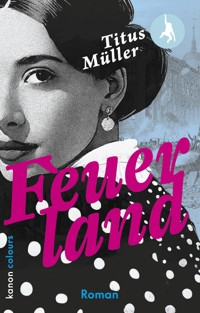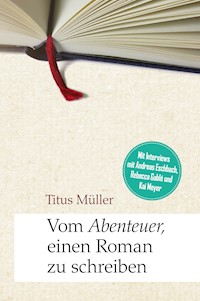10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Spionin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ria ist zehn Jahre alt, als ihre Eltern von der Staatssicherheit abgeholt werden. Sie wird von ihrer kleinen Schwester getrennt und in einer Adoptivfamilie untergebracht. Seither führt Ria in Ostberlin ein scheinbar angepasstes Leben. Erst als der BND sie als Informantin rekrutiert, sieht sie ihre Chance gekommen. Mithilfe des westlichen Geheimdienstes will Ria sich an der DDR rächen und endlich ihre Schwester wiederfinden. Doch dann erfährt sie im Sommer 1961 von einem ungeheuerlichen Plan, der ihr Schicksal und die Zukunft beider deutscher Staaten für immer verändern könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Ein eisgrauer Abendhimmel zog über Berlin auf. Aus den Schornsteinen qualmte es. Dicht an dicht zogen Autos den Kurfürstendamm entlang. Die älteren Modelle klappten noch Winker aus beim Abbiegen, moderne blinkten schon elektrisch. An den Häuserfronten sprangen Neonröhren an und warben in knalligen Farben für Bier, Versicherungen und Mundwasser. Hier war der Westen, das Leben pulsierte fast wie in den legendären Zwanzigerjahren. Motorenlärm sorgte für ein beständig an- und abschwellendes Rauschen. Die Luft schmeckte nach Staub und Benzin.
Und im Osten? Die U-Bahn untertunnelte die Sektorengrenze, die S-Bahn trickste sie oberirdisch aus. Die Berliner taten so, als wäre es das Natürlichste der Welt: eine Stadt, geteilt in zwei Hälften, und jede Hälfte gehörte zu einer anderen Weltmacht.
Titus Müller erzählt die Geschichte der jungen Spionin Ria Nachtmann, die in die politischen Wirren des Schicksalsjahrs 1961 gerät und für ihren Traum von Freiheit und Glück ihr Leben aufs Spiel setzen muss.
Der Autor
Titus Müller, geboren 1977 in Leipzig, hat 13 Romane und 7 Sachbücher geschrieben. Er ist Mitglied des PEN-Clubs und wurde u. a. mit dem C.-S.-Lewis-Preis, dem Sir-Walter-Scott-Preis und dem Homer-Preis ausgezeichnet. Seine große Spionin-Trilogie erzählt die Geschichte einer mutigen Frau – und drei Jahrzehnte deutsch-deutscher Geschichte.
TITUS MÜLLER
DIEFREMDE
SPIONIN
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 07/2021
Copyright © 2020 by Titus Müller
Copyright © 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gunnar Cynybulk
Covergestaltung: Favoritbuero, München, unter Verwendung von Motiven von © Bridgeman Images (Käfer), © Shutterstock (Himmel), © akg-images/Sammlung Berliner Verlag/ Archiv (Auto) und © Vintage Germany (Brandenburger Tor)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-27066-7V006
www.heyne.de
1
Fjodor Sorokin schrieb einen falschen Namen in das Meldeformular und erfand eine Adresse in Dortmund.
»Wie lange werden Sie bleiben, Herr Budeit?« Der Hotelangestellte nahm das Formular mit professionellem Lächeln in Empfang. Er spähte auf die Zeile für das Abreisedatum, die Sorokin leer gelassen hatte.
»So lange es nötig ist«, sagte Sorokin. »Vier, fünf Tage.«
»Sie sind geschäftlich hier?«
Sorokin sah ihn statt einer Antwort kalt an. Schließlich nickte er.
»Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer.« Der Hotelangestellte kam um den Tresen herum und wollte den rotbraunen Lederkoffer nehmen, aber Sorokin griff schneller zu. Nun beeilte sich der Angestellte, vor Sorokin am Aufzug zu sein und die Ruftaste zu betätigen. Sie standen da, während der Fahrstuhl näherkroch, und der Angestellte fragte: »Sind Sie zum ersten Mal in München?«
Zwei Jahre war es her, dass er hier gewesen war und den ukrainischen Exilpolitiker Lew Rebet getötet hatte. Stepan Andrijowytsch Bandera würde eine schwierigere Aufgabe darstellen. »Ja, zum ersten Mal«, antwortete er. »Können Sie mir ein Restaurant empfehlen?«
Der Hotelangestellte empfahl Böttner oder Röttner in der Theatinerstraße, er hörte nicht genau zu.
Vor drei Jahren war bereits ein Kollege an Bandera gescheitert, vor zwei Jahren ein weiterer. Er war gewarnt. Er würde vorbereitet sein. Bandera war ein ukrainischer Nationalheld, und er war Kopf der OUN, der Organisation Ukrainischer Nationalisten.
Sie fuhren hinauf. Der Angestellte schloss ihm das Zimmer auf und wies hinein, als handle es sich um ein nobles Penthouse. Sorokin drückte ihm ein Fünf-Mark-Stück in die Hand und schloss die Tür hinter sich. Er setzte sich auf den Stuhl am Schreibtisch.
Er musste also hinein. Musste ihn töten, ohne Geräusch und ohne Spuren, und dann wieder hinauskommen. Die Makarow kam nicht infrage, selbst mit Schalldämpfer war die Gefahr, dass man den Schuss hörte, zu groß. Bandera arbeitete unter anderem für den BND, sicher hatten sie Wachposten aufgestellt. Fiel ein Schuss, würden die das Haus stürmen. Und in der Wohnung hielt Bandera womöglich selbst Überraschungen bereit.
Sorokin zog das Dossier aus dem Koffer und schlug es auf. Bandera hatte im Krieg seine eigene kleine Privatarmee angeführt. Unter dem Decknamen Konsul II hatte er für die Wehrmacht gearbeitet, dann war er abtrünnig geworden und hatte einen unabhängigen ukrainischen Staat ausgerufen, was die Deutschen nicht dulden konnten. Sie brachten Bandera nach Sachsenhausen, ließen ihn aber nach drei Jahren wieder frei, damit er den ukrainischen Widerstand gegen die Rote Armee anführte. Er täuschte sie und folgte wieder seinem eigenen Programm. Seitdem versuchte er, der Sowjetunion mit seiner OUN die Ukraine abspenstig zu machen, und war damit ein natürlicher Verbündeter des BND. Hinzu kamen die Informationen, an die er durch seine Wühltätigkeit gelangte und die er an den Westen weitergab. Seit fünfzehn Jahren lebte er im Verborgenen. Er führte in der Bundesrepublik einen falschen Namen, hatte geheiratet und zog drei Kinder groß.
Sorokin prägte sich das Foto ein, dann nahm er die losen Seiten aus der Mappe, ging ins Badezimmer, legte das Dossier ins Waschbecken und zündete es an. Die Flammen gaben dem Raum ein gespenstisch blaues Licht. Als auch das Foto zu hauchdünnem schwarzem Kohlenstoff verbrannt war, zerteilte er die knisternden Reste und spülte sie im Waschbecken hinunter.
Er schlief gut, so wie immer, wenn es darauf ankam. Das Kissen war hart, das Bett durchgelegen, trotzdem erwachte er nach einer traumlosen Nacht und war im Vollbesitz seiner Kräfte. Zum Frühstück aß er eine Schüssel Haferflocken und eine Banane, die erste seit zwei Jahren, und trank echten Bohnenkaffee. Dann ging er in die Stadt und traf einige Vorbereitungen.
Er kannte die »Verkleidungskoffer«, die es bei der ostdeutschen Staatssicherheit gab und die auch manche beim KGB benutzten. Vorräte von Perücken, falschen Bärten, verschiedenen Brillen, Kosmetika, mit denen sich die Hautfarbe ändern ließ. Von solchen Hilfsmitteln hielt er nichts. Sie lenkten vom Eigentlichen ab.
Wenn man sich tarnen wollte, ging es um eine Geschichte. Man verkörperte eine andere Person. Tauchte in deren Alltagsgebaren ein. In einem Bahnhof war ein Koffer wichtiger als ein falscher Bart. In einer Einkaufsstraße brauchte man ein Tragenetz, keine Perücke.
Der Schnurrbart, den er heute angelegt hatte, war bloß eine Nebensache, eine kleine Unterstützung. Viel wichtiger war der Kinderwagen. Er schob ihn in die Kreittmayrstraße. Seine Sorge war, dass der Kinderwagen neu wirken könnte, auch wenn er ihn mit Milchflecken versehen hatte und mit den Rädern auf dem Spielplatz durch den Sandkasten gefahren war. Ein aufmerksamer Mensch konnte riechen, dass der Kinderwagen unbenutzt war.
Als er sich dem Haus Nummer sieben näherte, beugte er sich in den Wagen vor und stopfte die Babydecken, die er gekauft hatte, fester um die Puppe. Er ließ kaum eine Handbreit des Puppenkopfes sehen und zog der Puppe die Babymütze tief in die Stirn. Zusätzlich stellte er den Sonnenschutz auf, sodass man sich weit über den Kinderwagen hätte beugen müssen, um hineinzublicken.
Er entdeckte die Posten sofort. Einer von ihnen stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite und las eine Zeitung, der andere saß auf einer Parkbank nahe dem Hauseingang. Sie waren zu gut rasiert für Müßiggänger.
Wenn der auf der Parkbank Schwierigkeiten machte und ihn in einen Kampf verwickelte, hatte der auf der anderen Straßenseite Deckung hinter einem parkenden Auto, konnte seinerseits aber ungehindert auf ihn schießen. Es war keine gute Ausgangslage.
Trotzdem näherte er sich der Haustür. Der Posten stand von der Bank auf und trat auf ihn zu. »Hat die Mama keine Zeit?«
Sorokin tat irritiert.
Versöhnlicher fragte der Posten: »Wie heißt denn der Kleine?«
»Es ist eine Sie.« Sorokin sprach mit gedämpfter Stimme. »Luisa. Sie schläft gerade, ich werde sie im Hausflur stehen lassen. Man ist so froh, einmal Ruhe zu haben.«
Der Posten versuchte, einen Blick in den Kinderwagen zu werfen, aber der Sonnenschutz hinderte ihn, und drin im Wagen war es schattig. Ich hätte mir die Hose zerknittern sollen, dachte Sorokin. Immerhin hatte er sich einen Schluck Milch auf die Schulter gespuckt, das bemerkte der Posten jetzt. Sorokin sah, wie sein Blick am länglichen weißen Fleck hängen blieb.
»Zu wem wollen Sie denn?«
»Zu meiner Tante.« Forsch trat er an das Klingelfeld heran und wählte einen Namen, der mit weiblicher Handschrift geschrieben war. Er drückte die Klingel.
Als er sich wieder zum Kinderwagen wandte, sah er, dass der Mann auf der anderen Straßenseite die Zeitung faltete und um das parkende Auto herumtrat, im Begriff, die Straße zu überqueren und ebenfalls zu ihm zu kommen.
Die Sache wurde heiß.
Ein Puls von 175 war nichts Gutes. Man konnte nicht mehr richtig sehen. Man war nicht Herr seiner selbst. Aber wer zum dritten oder vierten Mal in einen Schusswechsel geriet, der lernte, einen kühlen Kopf zu bewahren. Der Puls ging nur noch auf 120 hoch, oder auf 110.
Wann öffnete diese verdammte Person? Er überlegte, sich nah an die Klingeln heranzustellen, sodass die Posten nicht sahen, wo genau er die Finger hatte, und rasch einen anderen Klingelknopf zu drücken, aber auch die Bewegung zum Klingelfeld würde ihn verdächtig machen. Wer nichts zu verbergen hatte, dem war es gleichgültig, ob er etwas länger vor der Haustür wartete.
Jenseits einer Pulsfrequenz von 145 passierten unangenehme Dinge. Komplexe Bewegungsabläufe wurden schwierig. Man konnte die Hände nicht mehr richtig koordinieren. Bei einem Puls von 175 schaltete sich das Großhirn ab, und das Mittelhirn übernahm, was für die kognitiven Prozesse nicht gut war. Der Blick verengte sich, das Blut wurde aus den äußeren Muskeln abgezogen und konzentrierte sich auf die inneren Muskeln, um sie hart zu machen, damit bei einer Verletzung möglichst wenig Blut verloren ging. Man konnte sich nicht einmal mehr an die Notrufnummer erinnern. Mit diesem Puls wählte man 000 oder irgendwelchen Unsinn.
Er zwang sich zur Ruhe und schärfte seinen Geist. Das Handschuhfutter war mit Bleigranulat gefüllt, seine Schläge würden Wirkung zeigen. Zog der zweite Posten eine Waffe, würde er den ersten als Schutzschild vor sich stoßen, während er selbst die Makarow aus dem Halfter löste. Dann würde er beide umlegen.
Eine Frau in grün gemusterter Kittelschürze erschien in der Tür.
»Fasst du kurz mit an?«, fragte er, bevor sie etwas sagen konnte, und schob den Kinderwagen voran.
Wie in einem Reflex öffnete sie die Tür weit genug, dass er hindurchkam.
Bat man Menschen um simple Handgriffe, fassten sie zu, ohne lange nachzudenken. Die Hilfsbereitschaft war vor allem bei Frauen tief verankert. Die Fremde nahm den Kinderwagen vorn und trug ihn widerspruchslos mit ihm die Treppe hoch.
Auf der ersten Treppenflucht warf er einen Blick zurück. Gerade fiel die Haustür wieder ins Schloss. Die Posten standen draußen und redeten.
Die Frau strahlte ihn an, als wollte sie ihn heiraten. »Was für ein toller Vater. Man sieht viel zu selten, dass auch mal die Väter ihr Kind spazieren fahren.« Das Tragen strengte sie an. Trotzdem hörte sie nicht auf zu lächeln. »Welche Etage?«
Banderas falscher Nachname hatte in der zweiten Zeile gestanden. Er sagte: »Die dritte. Oje, das tut mir leid, dass ich Sie so ins Schwitzen bringe. Und dass ich Sie verwechselt habe, auch. Ich bin arg kurzsichtig, wissen Sie?«
»Keine Ursache.«
»Die Kleine schläft gerade, und oben machen sie nicht auf. Sind vielleicht gerade einkaufen oder so. Draußen kann ich sie doch nicht stehen lassen. Zum Glück wiegt sie noch nicht so viel.«
»Wie alt ist sie denn?«, fragte die Frau.
»Ein halbes Jahr.«
»Ich hoffe, Sie haben Milch dabei. Oder ist sie schon abgestillt? Sagen Sie gern Bescheid, ich wohne im Ersten, ich kann Ihnen Wasser warm machen.«
»Nicht nötig. Aber vielen Dank.«
Sie stellten den Kinderwagen im dritten Stock ab. Er bedankte sich überschwänglich, und die Frau ging mit dem guten Gefühl, einem geplagten Vater geholfen zu haben, treppab. Nach einigen Stufen blieb sie noch einmal stehen: »Wirklich, es wäre kein Problem. Klingeln Sie einfach bei Weber, ich helfe gern.«
Er nickte und beugte sich wieder über den Kinderwagen, als wolle er bei seiner Tochter nach dem Rechten sehen. In Wahrheit zog er, kaum dass die Frau fort war, die Ampulle und die Pillendose aus der Polsterritze des Kinderwagens.
Dass ihm der KGB zwei verschiedene Gegenmittel verabreichen wollte, ließ ihn zögern. Wenn man ein Gegenmittel erfand, wählte man eine Verabreichungsform, man erwartete doch nicht, dass jemand im Einsatz erst Pillen schluckte und dann noch eine Ampulle zerbrach.
Sie hatten gesagt, er solle die Pillen vorab schlucken. Bereiteten sie den Körper zur Aufnahme des gasförmigen Gegenmittels vor? In der Ampulle war vermutlich Amylnitrit. Was enthielten die Pillen?
Er legte die Ampulle ab und öffnete die Pillendose. Behutsam nahm er eine der Tabletten heraus und drehte sie zwischen den Fingern. Und wenn es kein Gegenmittel war, sondern ein langsam wirkendes Gift? Womöglich waren ihnen die politischen Folgen eines weiteren gescheiterten Mordversuchs zu heikel, und sie bevorzugten es, dass er nach der Tat nicht mehr befragt werden konnte?
… verpflichte ich mich, alle Aufträge des KGB im Kampf gegen die kapitalistischen Angreifer zu erfüllen und über alles, was ich im Zusammenhang damit erfahre, strengstes Stillschweigen zu bewahren. Das hatte er einst unterzeichnet. Für einen Verstoß gegen diese Verpflichtung trifft mich die ganze Strenge der sowjetischen Gesetze.
Beim ersten Einsatz hatte er noch das Gefühl gehabt, einen großen, ernsten Auftrag für das Vaterland zu erfüllen. Und später, als er nach Deutschland kam, hatte er sich in der Gewissheit gesonnt, dass der KGB nicht viele Leute hatte, die fähig waren, die Rolle eines Deutschen zu spielen. Wahrscheinlich konnte man sie an einer Hand abzählen. Er besaß eine Sprachbegabung. Die meisten wurden auch nach Jahren ihren Akzent nicht los. Ihn hielt man problemlos für einen Muttersprachler.
Andererseits mochten es die Führungsoffiziere des KGB nicht, wenn man zu gut wurde, sie hielten jeden für ersetzbar, bis auf sich selbst. Allzu fähige Mitarbeiter erschienen ihnen bedrohlich. Hieß das, dass sie versuchten, ihn umzubringen …? Jemandem, der Mordaufträge erteilte, war auch ein Mord am eigenen Mitarbeiter zuzutrauen.
»Tja, ich bin ein freier Mann«, flüsterte er. »Ein freier Mann.« Er legte die Tablette zurück in die Dose und schloss den Deckel. Die Ampulle musste genügen. Wenn der Mord gelang und er ungesehen davonkam, gab es auch nichts mehr zu »regeln«, was ihn anging.
Sorgfältig wischte er mit einem Taschentuch die Griffleiste des Kinderwagens ab, um Fingerabdrücke zu beseitigen. Vorhin im Laden hatte er die Handschuhe noch nicht getragen. Niemand kaufte mit Handschuhen einen Kinderwagen.
Er holte die Gaspistole heraus. Mit der Waffe in der einen Hand und der in ein Taschentuch eingewickelten Ampulle in der anderen wartete er auf der Zwischenebene des Treppenhauses. Er behielt Banderas Tür im Blick. Irgendwann musste der Kerl herauskommen.
600 Kilometer entfernt zog über Berlin ein eisgrauer Abendhimmel auf. Aus den Schornsteinen qualmte es. Dicht an dicht zogen Autos den Kurfürstendamm entlang. Die älteren Modelle klappten noch Winker aus beim Abbiegen, moderne blinkten schon elektrisch. An den Häuserfronten sprangen Neonröhren an und warben in knalligen Farben für Bier, Versicherungen und Mundwasser. Hier war der Westen, das Leben pulsierte fast wie in den legendären Zwanzigerjahren. Motorenlärm sorgte für ein beständig an- und abschwellendes Rauschen. Die Luft schmeckte nach Staub und Benzin.
Und im Osten? Die U-Bahn untertunnelte die Sektorengrenze, die S-Bahn trickste sie oberirdisch aus. Die Berliner taten so, als wäre es das Natürlichste der Welt: eine Stadt, geteilt in zwei Hälften, und jede Hälfte gehörte zu einer anderen Weltmacht. Der Osten roch muffig nach Braunkohle. Trampelpfade führten über unkrautbewachsene Trümmergrundstücke, die noch nicht geräumt worden waren. An der Stalinallee erhoben sich prachtvolle achtstöckige Wohnblöcke mit Aufzug, Marmortreppen, Balkonen und gefliestem Bad. Die Allee hatte man neunzig Meter breit gebaut, damit sie sich für Paraden eignete. Aber abseits der Prachtstraße trugen die Fassaden der Häuser noch Einschusslöcher, und der Putz bröckelte. Gab es beim Fleischer Würstchen, bildete sich eine Schlange bis zur nächsten Hausecke.
Am vorderen Ende der Stalinallee, bei den Zwillingstürmen des Frankfurter Tors, wurde ein Kino gebaut, das einmal den Namen Kosmos tragen sollte. Nur einen kurzen Fußweg von dort entfernt, in der Boxhagener Straße 25 – grauer Putz, eckige Balkone, eine Annahmestelle für Wäsche im Erdgeschoss und Straßenbahnschienen vor der Tür – stellte Max in der vierten Etage das Polizeiboot auf das Fensterbrett und richtete es sorgfältig am sowjetischen MI-4-Hubschrauber aus. »Wie findest du’s?«
Sie sollten gemütlich beieinandersitzen, dachte Ria. Warum verspürte sie kein Bedürfnis nach seinen Armen? Hieß das, dass sie Max nicht liebte? Sie schüttelte den Gedanken ab. Man sollte sich so etwas nicht dauernd fragen, die Stimmung wechselte eben, an anderen Tagen hatte sie sich durchaus gern in seine Arme gekuschelt.
»Toll«, sagte sie, und pustete auf die grünbraune Oberfläche des Kräutertees. Vorsichtig trank sie einen Schluck.
Max sah hoch zu ihr und lachte. »Du bist eine erbärmliche Lügnerin.« Er stand auf. »Wehe, du wirfst die Modelle ›aus Versehen‹ runter, wenn ich nicht da bin. Das war eine Mordsarbeit. Für die nächsten zwanzig Jahre stehen sie da, versprich mir das.«
Ria verschluckte sich und hustete. »Es ist immer noch meine Wohnung.« Sie stellte die Tasse ab, trat zum Klavier und packte die Noten zusammen. Im Flur schlüpfte sie in die Schuhe, Max kam ihr nach und drückte ihr einen langen, feuchten Kuss auf die Lippen. Behutsam wickelte er ihr seinen karierten Schal um den Hals und stopfte die Enden in ihren Jackenkragen. »Damit du an mich denkst.«
Ich habe Glück mit Max, dachte sie. Noch einmal trat sie in die Wohnküche und trank vom Tee. Die Wärme spülte ihr den Magen aus.
Sie nahm den Stoffbeutel und verließ die Wohnung. Zwei Stockwerke tiefer, im Hochparterre, klopfte sie leise bei Behms. Die Tür ging auf, und der kleine Geralf stand da, er reichte ihr kaum bis zum Bauch. Sie holte den Apfel aus dem Beutel und gab ihn dem Jungen, dann auch noch das Päckchen mit belegten Broten. »Aber sag nichts der Mutter.«
»Mach ich nicht«, versprach Geralf. Sein Gesicht zeigte einen Indianerernst, wie ihn nur Kinder aufbringen können. Er packte das Brot auf der Stelle aus und biss hinein.
Sie fuhr ihm mit der Hand über den Kopf, von vorn, in die Wuschelhaare hinein, und warf einen schnellen Blick in die Wohnung hinter ihm. Im Flur lag kein Spielzeug, die Schuhe waren ordentlich aufgereiht. Das Pendel der Standuhr schwang hin und her, ihr lautes Ticken klang nach Einsamkeit.
»Sie kann nicht anders«, sagte Ria. »Du darfst das nie vergessen, sie liebt dich, auch wenn sie nicht da ist.«
Er hielt im Kauen inne. Dann nuschelte er etwas, das wie »schon gut« klang. Er sah sie nicht an dabei.
Am liebsten hätte sie ihm einen Kuss auf die Stirn gedrückt. Sie ging die letzte Treppe hinunter und hörte, wie Geralf hinter ihr die Tür schloss, lautlos beinahe, viel zu leise für einen Siebenjährigen, es klang wie eine Entschuldigung an die Welt.
Draußen vor dem Haus wickelte sie den Schal ab und steckte ihn in die Jackentasche. Die feine Februarnässe rührte empfindlich kalt an ihren Hals. Heute ertrug sie Max’ Schal nicht.
Die Schienen summten. Die Straßenbahn kam pünktlich, ihr Scheinwerfer leuchtete wie das suchende Auge eines Zyklopen in die feuchtkalte Luft. Ria zahlte beim Schaffner und ging im Wagen nach hinten, bis sie einen freien Sitzplatz fand. Das grüne Kunstleder war noch warm, jemand musste vor Kurzem darauf gesessen haben. Die fremde Körperwärme war ihr unangenehm, kurz erwog sie, wieder aufzustehen und sich einen anderen Platz zu suchen, aber dann hatte sich die alte Wärme schon mit ihrer eigenen Wärme gemischt.
Die Klavierlehrerin würde nach Max fragen. Den Diabelli hatte Ria nicht geübt, den würde sie nach hinten stellen und vorn die Etüde aufschlagen, vielleicht fiel es nicht auf. Am besten fragte sie die Klavierlehrerin gleich zu Beginn nach ihrem schmerzenden Bein, dann kamen sie ins Reden, und es blieb weniger Zeit für den Unterricht. Nächste Woche würde sie den Diabelli ordentlich üben, das schwor sie sich. Die Klavierlehrerin sollte sie nicht wieder ermahnen müssen.
Die Straßenbahn überquerte den Bersarinplatz und fuhr an einem Laden für Haushaltswaren vorbei. Falls es darauf hinauslief, dass sie und Max heirateten, würden sie ein großes Ehebett kaufen, sie brauchte Platz im Bett – wenn sie schlief, durfte nichts sie anrühren, keine Hand, kein Fuß, kein fremdes Knie. Konnte es gut gehen mit Max? Gut genug? Sie würden auf ein Sofa sparen und eines Tages auf einen gebrauchten Fernseher.
Max würde Kinder wollen.
Kinder.
Eine plötzliche Übelkeit stieg in ihr auf. Ria versuchte, sie hinunterzuschlucken, aber es wurde nur schlimmer. Sie zog die Halteschnur. Die Straßenbahn seufzte und hielt ruckelnd in der Dimitroffstraße, die Türen rollten auf. Die kühle Luft tat Ria gut. Sie sah der fortfahrenden Straßenbahn nach. Dann lief sie neben den Schienen wieder nach Hause. Die Noten im Beutel wogen schwer.
Links standen alte Mietshäuser, aus deren Fenstern gelbes Licht floss. Man hörte Kindergeschrei und schnarrende Radiomusik. Viele dieser Wohnungen waren überfüllt. Verheiratete Paare hatten ein Zimmer bei den Eltern und warteten darauf, dass sie die erste eigene Wohnung erhielten, es gab eine Wartezeit von mehreren Jahren. Geschiedene waren gezwungen, weiter zusammenzuleben, weil es keine freien Wohnungen gab. Und sie lebte als Einundzwanzigjährige im vierten Stock, musste zwar die Toilette im Treppenhaus mit den Schädickes teilen, aber wer hatte schon eine eigene Toilette. Manchmal fürchtete sie, Max sei nur wegen der Wohnung mit ihr zusammen. Dass er sein Polizeiboot und den Militärhubschrauber bei ihr gebaut hatte – die Wohnküche roch seit Tagen nach dem Kleber –, war das nicht ein Versuch, sich bei ihr einzunisten? Er meinte es ernst.
Laufmaschendienst, las sie in einem Schaufenster. Ihre Strümpfe werden in meiner Werkstatt schnell und sauber repariert.
Der benachbarte Blumenladen hatte Blattpflanzen mit dunkelgrünen, ledrigen Blättern hinter die Scheibe drapiert und ein einsames Alpenveilchen, dessen lachsfarbene Blüten gegen die Dunkelheit ankämpften. Schnittblumen gab es fast nie, schon gar nicht zu dieser Jahreszeit.
»Seht, wie uns die Sonne lacht!«, hatte eines ihrer Kinderbücher geheißen, die zwei Schlusszeilen des Gedichts darin hatten sich ihr eingeprägt:
Dieser Garten voller Glück –
das ist unsre Republik!
Aus dem Fenster einer Kellerwohnung drang Jazzmusik, das Schlagzeug fauchte, Trompetentöne sprangen fröhlich dazu auf. An die Scheibe waren Papiersterne geklebt, von Kindern mit gelbem Wachsstift bemalt. Hier lebte eine Familie und sah den ganzen Tag die Füße und die Unterschenkel der Vorbeieilenden. Und doch fanden die Kinder Schönheit und verbreiteten ihre Farben weiter.
Sie musste daran denken, wie sie mit Jolanthe, wenn Vater Besuch hatte, heimlich die Pelze, Mäntel und Hüte der Gäste anprobiert hatte, wie sie hatten kichern müssen vor dem Spiegel und sich die Hand auf den Mund gepresst hatten, um nicht erwischt zu werden. Jolanthe, halb verschwunden unter einem viel zu großen Hut, mit einem Mantel, der über ihrem schmalen Kinderkörper hing wie ein dickes Fell und bei jedem ihrer Schritte auf dem Boden schleifte.
Sie schloss die Haustür auf und ging die Stufen hinauf, jede Stufe eine Lebensaufgabe. Gegenüber von Behms öffnete die alte Kuntze, sie hatte ihr mal wieder aufgelauert. »Das ist eine Grenzgängerin«, schimpfte sie, »die sackt drüben Westgeld ein, und hier nutzt sie die kostenlose Krankenversorgung. Und Sie unterstützen das noch!«
Ria tat, als habe sie es nicht gehört, und ging an ihr vorüber. Nur noch zwei Etagen.
»He, ich rede mit Ihnen, Fräulein Nachtmann! Ich weiß doch genau, dass Sie dem Jungen Essen zustecken. Und der Herr, der bei Ihnen wohnt, ist der überhaupt gemeldet?«
Warum war es so schwer, ein gewöhnliches Leben zu führen? Wieso schafften es alle anderen, nur sie nicht? Sie konnte Max nicht heiraten. Genauso wenig irgendjemand anderen.
Sie trat in die Wohnung, zog sich die Schuhe aus und stellte sie ordentlich nebeneinander hin, als würde das etwas helfen.
Max kam in den Flur. »Was ist los? Fährt die Straßenbahn wieder mal nicht?«
»Doch, sie fährt.« Sie hängte ihre Jacke an den Haken und ging in die Wohnküche. Ihr Tee stand noch auf dem Tisch. Er dampfte nicht mehr. Lauwarmer Tee war abscheulich.
Max setzte sich zu ihr. »Ist etwas passiert?«
»Warum hast du mich angesprochen, damals?«
Er machte ein verdutztes Gesicht. »Weil du mir gefallen hast.«
»Aber du kanntest mich doch gar nicht.«
»Niemand kennt einen anderen, wenn er sich verguckt. Das ist es doch gerade. Deine schönen Beine sind mir aufgefallen und das Gesicht und dass du gehst wie eine Katze.«
»Hast du mal eine andere so angesprochen?«
»Was wird das – ein Verhör?« Als er merkte, dass sie auf seine scherzhafte Art nicht einging, wurde er wieder ernst. »Du weißt doch, wie schüchtern ich bin.«
Wie gut kannte sie ihn eigentlich? »Gestern Nacht kamst du mir gar nicht schüchtern vor.«
Er grinste und nahm ihre Hand. »Ria, ich mein’s ernst mit dir. Bitte zweifle nicht daran. Alles wird gut werden. Du hast die Ausbildung geschafft, ab Montag bin ich mit einer Ministerin zusammen, wer kann das schon von sich behaupten?«
»Sekretärin«, korrigierte sie ihn.
»Im Ministerium für Außenhandel«, ergänzte er theatralisch. »Ich bin so stolz auf dich.«
»Ich weiß nicht.«
Er schlug spielerisch auf ihre Hand. »Jetzt mach aber mal einen Punkt.«
»Wenn meine Schwester wüsste, dass ich so eine geworden bin!« Hatte sie das gerade wirklich ausgesprochen? Sie fasste nach dem Rand des Stuhls unter sich und klammerte sich daran fest.
Max sagte leise: »Was ist damals passiert?«
Sie schwieg.
»Was auch immer es war, Ria, deine Schwester hat sicher auch längst ein neues Leben begonnen. Vielleicht ist sie Ingenieurin oder Traktoristin oder lenkt einen Kran. Irgendwann muss man Frieden schließen mit seiner Vergangenheit.«
Sie merkte, dass sie zu zittern begonnen hatte, und klammerte sich noch fester an den Stuhl, weil es ihr vor Max unangenehm war. »Was, wenn ich nie Kinder haben möchte? Würdest du mich trotzdem … Ich meine …«
Einige Momente sah er an ihr vorbei. Dann nickte er. »Ja. Das würde ich, Ria.« Er sah ihr in die Augen. »Aber du solltest in dir aufräumen. Was vor zehn Jahren war, darf dich nicht das ganze Leben lang belasten.«
Sie erstarrte. Ihr Gesicht fror. »Woher weißt du, dass es zehn Jahre sind?« Sie stand auf.
Er schüttelte den Kopf. »Das hab ich nur so dahingesagt. Zehn, zwölf, vierzehn Jahre, was macht das für einen Unterschied?«
»Nein.« Sie trat einen Schritt zurück. »Du hast es nicht dahingesagt. Wer hat dir erzählt, dass es zehn Jahre sind?«
»Niemand. Oder vielleicht haben wir doch mal … Ria, ich verstehe nicht, warum dich das so aufregt.«
»Haben die Stiefeltern dich zu mir geschickt?« Sie flüsterte fast. »Sollst du mich für sie im Auge behalten?«
»Unsinn, ich kenne sie doch überhaupt nicht.«
»Oder die Staatssicherheit?«
»Ich weiß nicht, wovon du redest. Ria, ich …«
»Geh jetzt.«
Er stand auf. »Du steigerst dich da in etwas rein.« Er wollte sie in den Arm nehmen, aber sie stieß ihn von sich. Sie glühte, sie hasste. Die Wut gab ihr Kraft.
Eine Weile stand er unschlüssig da, dann verließ er die Küche. Sie hörte, wie er sich im Flur anzog. Noch einmal erschien er im Türrahmen. »Ich komme morgen und sehe nach dir.«
»Nein, Max. Gib mir den Schlüssel.« Sie streckte die Hand aus.
Erschüttert sah er sie an. Als er merkte, dass sie nicht nachgeben würde, grub er den Ersatzschlüssel, den sie ihm gegeben hatte, aus der Hosentasche und reichte ihn ihr.
»Und jetzt geh.«
»Ria!«
Sie wandte sich von ihm ab.
Fluchend verließ er die Wohnung.
Ria stützte sich an der Stuhllehne ab. Sie bekam plötzlich schlecht Luft. Als es nicht besser wurde, ging sie zum Fensterbrett, nahm das Polizeiboot und den sowjetischen Hubschrauber und warf sie zu Boden, sodass sie in Dutzende Teile zersprangen. Sie schlich ins Schlafzimmer, schleuderte Max’ Decke vom Bett und schlüpfte unter ihre eigene Decke. Sie zog die Beine an den Bauch und weinte ohne einen Laut.
In München klappte die Haustür der Kreittmayrstraße 7 zu. Füße scharrten über den Boden, als würde der Ankömmling etwas Schweres tragen. Seine Schritte waren zu dominant, zu selbstgewiss für eine Frau. Sorokin schlug die Zeitung über den Lauf der Waffe und umschloss mit der Linken das Taschentuch mit der Ampulle. Er hoffte, mit den verschmähten Tabletten keinen tödlichen Fehler gemacht zu haben.
Eine Wohnungstür wurde geöffnet, im falschen Stockwerk. Eine Frauenstimme sagte: »Sie tragen aber schwer heute.« Es war die Stimme der Nachbarin, die ihm mit dem Kinderwagen geholfen hatte.
»Lesya hat Geburtstag«, sagte ein Mann.
»Ach, wie schnell sie groß werden … Heute habe ich so ein süßes Würmchen die Treppe hochgetragen, kaum denkbar, dass es auch mal so groß wird wie Ihre drei.«
»Ja, es geht schnell«, keuchte der Mann. Er kam weiter die Treppe hoch.
Sorokin erhob sich und ging lautlos einen Schritt zurück, hinter die Biegung der Treppenflucht. Er hörte an den knarrenden Stufen, wie der Ankömmling die zweite Etage erreichte. Jetzt läutete er.
In einer fließenden Bewegung ging Sorokin die Treppe hinunter. Der Mann balancierte mehrere Pakete auf den Armen, er war glatzköpfig, das passte, aber war das schmale Gesicht das richtige? »Kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragte Sorokin, damit der Mann sich zu ihm umwandte.
Der Schmollmund, das Grübchen am Kinn, alles stimmte. Sorokin hob die Zeitung und schoss. Aus dem Lauf platzte zischend das Gas, es sprühte in Banderas Gesicht. Bandera ließ die Pakete fallen, riss die Hände hoch, er ächzte. Noch im Vorübergehen zerdrückte Sorokin mit der Linken die Phiole mit dem Gegengift im Taschentuch und hielt es sich unter die Nase. Es roch modrig. Ohne Banderas Todeskampf abzuwarten, ging er weiter. Die Waffe steckte er sich am Rücken in den Hosenbund, sodass die Jacke sie verbarg. Das Taschentuch mit den Scherben versenkte er in der Jackentasche.
Er verließ das Haus. Der Posten sah ihn an.
»Wenn sie mal schläft, dann schläft sie.« Sorokin lachte. »Ich nutze die Gelegenheit, um kurz etwas zu besorgen. Die Tante passt auf.«
2
BND-Führungsoffizier Hähner saß über einer Portion Leber mit Kartoffelpüree und Apfelmus. Niemand konnte das so zubereiten wie seine Großmutter. Vergnügt sah sie ihm beim Essen zu, sie folgte mit den Blicken jedem Bissen. Zum dritten Mal sagte sie: »Ist das schön, wenn ein junger Mensch solchen Appetit hat.«
Er war beinahe vierzig. »Willst du wirklich nichts?«
»Ich nasche nachher vom Apfelmus«, sagte sie.
Das Telefon läutete. Die Großmutter erhob sich mühevoll. »Nanu? Mich ruft doch sonst nie jemand an.«
Er stand auf, wurde aber in der halben Bewegung von der Großmutter zurückbeordert. »Du bleibst schön sitzen und isst, Junge. Der Kartoffelbrei wird kalt.« Sie schlurfte zum Telefon, das weiterläutete. »Jaja, ich komme doch schon«, sagte sie ärgerlich und hob ab. Der schwere Hörer drohte ihr zu entgleiten, sie griff nach, es dauerte etwas, ehe sie die Muschel ordentlich an ihr Ohr geführt hatte. »Wer ist da, bitte?«
Sie sah Hähner an. »Ist für dich.«
Jetzt stand er doch auf. Leber und Kartoffelbrei lagen ihm plötzlich schwer im Magen. Er nahm den Hörer entgegen.
»Hähner.«
Eine leise Stimme fragte: »Sitzen Sie?«
»Nein.«
»›Wintersturm‹ wurde im Treppenhaus vor seiner Wohnungstür gefunden. Tot.«
»Verdammt. Wozu haben wir Posten aufgestellt?« Er presste Zeigefinger und Daumen an die Nasenwurzel. »Gibt es eine Verletzung?«
»Nichts Sichtbares.«
»Lassen Sie ihn in der Gerichtsmedizin toxikologisch untersuchen. Gehen Sie von Mord aus. Die sollen mich in zwei Stunden zu Hause anrufen. Und geben Sie mir die Nummer der Männer, die zu seinem Schutz eingeteilt waren.«
»Die sind völlig fertig.«
»Die Nummer?«
Die leise Stimme diktierte, und er schrieb mit. Ohne ein Wort des Dankes legte er auf.
»Ist was Schlimmes?«, fragte die Großmutter. »Deine Polizeiarbeit hat nie einmal Pause …«
Sie glaubte beharrlich, er sei Kriminalpolizist.
»Gib mir einen Moment.« Der Wählton kurz-lang, kurz-lang, das Morsezeichen für den Buchstaben A, tutete aus dem Hörer. So verdorben war er schon von der Geheimdienstarbeit, dass ihm im Alltäglichen solche Dinge auffielen, das ganz gewöhnliche Freizeichen wurde ihm zum Symbol. Er sah auf seinen Zettel und betätigte die knirschende Wählscheibe, 0811, das war München, sie waren also nicht in Pullach draußen. Er wählte die letzte Ziffer und wartete. Eine Männerstimme meldete sich. Er wartete nicht, bis sie den Namen vollständig gesagt hatte. »Hähner, von Gamma. Haben Sie geschlafen im Dienst?«
Das Gegenüber stotterte eine Entschuldigung, ihm und seinem Kollegen ginge das alles sehr nahe.
»Gibt es einen Tatverdächtigen?«
»Da war einer im Haus, kurz vorher, so ein junger Typ, ungefähr dreißig, der hat getan, als würde er eine der Bewohnerinnen kennen. Hatte einen Kinderwagen dabei. Wir haben das Ding untersucht, es lag nur eine Puppe drin.«
»Fingerabdrücke?«
»Keine.«
So hatte er sich das gedacht. »Haben Sie einen Schuss gehört?«
»Nein, nichts. Aber es fuhren Autos auf der Straße, wenn er einen Schalldämpfer verwendet hat … Allerdings gibt es keine Kugel und keine Schusswunde. Hören Sie, mir tut das so schrecklich leid, und meinem Kollegen auch.«
»Ich hoffe, Sie sitzen schon beim Phantombildzeichner.«
»Also, wir …«
»Sputen Sie sich! Geben Sie das Bild an alle Polizeidienststellen. Der Kerl ist womöglich noch in der Stadt.« Er legte auf.
Die Bank der Straßenbahnhaltestelle wurde Sorokin unbequem. Außerdem war die Tinktur, mit der er sich die Haare blond gefärbt hatte, noch nicht trocken, und das Gestell der Hornbrille kniff, weil kein Optiker sie ausgerichtet hatte. Er hasste diese Verkleidung, aber er hatte keine Wahl. Sein gefälschter Ausweis, den er extra für die Flucht vorbereitet hatte, zeigte ihn mit blonden Haaren und Hornbrille, genau so. Er las weiter den Spiegel, einen Artikel über Kanadas Abwehrmaßnahmen gegen sowjetische Raketen-U-Boote, die unter dem arktischen Eis operierten, und beobachtete dabei den Eingang zum Münchner Hauptbahnhof. Das Polizistenpärchen hielt wohl nicht nach ihm Ausschau, aber was war mit den drei Anzugträgern, die auf der Seite der Taxis beisammenstanden und sich unterhielten? Die waren schon zwanzig Minuten dort und sahen sich immer wieder um.
In den hohen Glasfenstern des Bahnhofsgebäudes blitzte die Abendsonne auf. Der Zeiger der gewaltigen Uhr, die auf der rechten Gebäudehälfte prangte, zog behäbig über die Minutenstriche. Der Interzonenzug fuhr 19:37 Uhr, in zehn Minuten. Unter dem geschwungenen Vordach strömten Passagiere aus dem Bahnhof.
Ein weiterer Anzugträger näherte sich der kleinen Gruppe und wurde freudig empfangen. Sie zogen in den Bahnhof davon. Also doch bloß Geschäftsleute. Er faltete die Zeitschrift zusammen, erhob sich, nahm den Koffer und überquerte die Straße.
Nicht zu schnell gehen. Nicht zu langsam. Nicht zur Seite sehen. Im Gesicht ein Ausdruck der Selbstverständlichkeit. Sie hatten eine gute Personenbeschreibung von ihm, auch wenn jetzt der Schnurrbart fehlte, und man würde genau hier mit ihm rechnen, das beunruhigte ihn.
Sein Blick schweifte über Verkaufsbuden für Tabakwaren, Reiseandenken, Blumen. Dort der Schalter. Der Beamte hinter der Glasscheibe nahm seine Bestellung entgegen. Die tischgroße Druckmaschine spuckte das Pappbillett aus, und der Beamte reichte es durch die Luke. Mit dem Billett trat Sorokin in die Haupthalle. Er suchte das Gleis.
Grün gestrichene Waggons mit rußschwarzem Dach standen in langen Reihen hinter ihren Dampflokomotiven, auch einen Dieselzug mit rot-weißer Schnauze gab es. Werbung für Junghans-Uhren wurde angeleuchtet.
Bevor er in den D-Zug 149 einstieg, sah er zum Bild eines weinroten VT 11 Dieselzugs an der Wand hinauf, hinter dem die Worte »GUTE REISE« angebracht waren.
Er hatte im Wagen noch keinen Sitzplatz gefunden, als draußen bereits eine Trillerpfeife aufschrillte. Die Lokomotive antwortete mit drei Dampfpfiffen. Die Türen krachten zu. Dann rollte der Zug an.
Stefan Hähner heizte seine Wohnung gar nicht erst, jetzt lohnte es sich nicht mehr. Er packte die letzten Sachen in den Koffer. Als das Telefon klingelte, hob er ab. »Haben Sie etwas?«
»Bedauerlicherweise nein. Sieht nach einem natürlichen Tod aus. Vielleicht ist er einfach …«
»Er wurde ermordet.«
»Also, es gab diesen Insulinmord vor vier Jahren. Wir Normalsterblichen vertragen das Insulin nicht, dieselbe Dosis, die einem Zuckerkranken nichts ausmacht und ihm sogar hilft, ist für uns tödlich. Man kann hinterher nichts nachweisen, das Insulin löst sich spurlos im Blut auf. Höchstens findet man eine erhöhte Zuckerdosis in der rechten Herzkammer. Und geweitete Pupillen.«
»Hat Bandera geweitete Pupillen und Zucker in der rechten Herzkammer?«
»Nein.«
»Haben Sie sonst alles geprüft?«
»Es war auch kein E 605. Und ich habe die Mundhöhle genau auf Glassplitter untersucht, für den Fall, dass es ein Suizid war und er eine Glasampulle zerbissen hat. Nichts.«
»Gehen Sie noch mal ran. Und holen Sie Wolfgang Spann hinzu.«
»Herr Spann ist …«
»Holen Sie ihn«, unterbrach er den Rechtsmediziner. »Prüfen Sie mit ihm den Körper Zentimeter für Zentimeter. Irgendwo muss ein Einstichloch sein.« Er sah auf die Uhr. »Morgen Vormittag rufe ich Sie an wegen des Ergebnisses.« Er legte auf und sah auf die Uhr. 21:48 Uhr ging der Nachtzug vom Zoologischen Garten. Er würde am Vormittag um elf in München sein, gegen Mittag konnte er Gehlen in Pullach seine Aufwartung machen.
Er schloss den Koffer und sah zum Fenster. Er hatte Bandera vor Augen, wie er im Kaffee rührte, hörte ihn von seinen Kindern erzählen, Natalia, Andrei und Lesya, und von seiner Frau. »Die morden mir meine Jungs weg«, sagte er leise. »Die morden mir einfach meine Jungs weg.« Er tippte mit vier Fingerspitzen auf das Leder des Koffers. »Verdammte Russen.«
Gegen zehn sah Sorokin aus dem Zugfenster auf die verschwenderische Lichtreklame Nürnbergs. So war der Westen: laut und aufreizend. In allen Farben und Formen warben Unternehmen für ihre Produkte. Er konnte verstehen, dass den Funktionären dieses Wetteifern um die Aufmerksamkeit der Konsumenten verwerflich erschien, dieses unverhohlene Buhlen um ihr Geld. Aber der Erfolg war unverkennbar. Es hatte schon mit den Soldaten angefangen, gleich nach dem Krieg. Die sowjetischen Soldaten trugen ausgewaschene Feldblusen, die amerikanischen eine attraktive Uniform. Die sowjetischen Soldaten waren hohlwangig und hungrig, die amerikanischen verteilten Schokolade, gute Zigaretten und Kaffee.
Der Halbwüchsige im Abteil sprang auf und zog das Fenster herunter. Er reckte den Kopf hinaus. »Nicht Richtung Lokomotive schauen«, mahnte die Mutter, »sonst fliegt dir Ruß in die Augen. Und lehn dich nicht so weit raus!«
Der veloursgepolsterte Sitz des Interzonenzugs war durchgesessen. Am Rücken drückte das Halfter der Makarow. Sorokin stand auf und suchte nach dem Abteilkellner. Er fragte das spärliche Angebot an Spirituosen ab und erwarb einen Doppelkümmel in kleiner Taschenflasche. Damit kehrte er ins Abteil zurück. Er trank. Die hundert Milliliter würden schnell aufgebraucht sein, aber der Alkohol wärmte ihn von innen. Der Junge saß jetzt still auf seinem Platz. Die Mutter sah Sorokin missbilligend an.
Sie fuhren in einen Tunnel. Rauch und Schmutz drangen durch den Fensterspalt ins Abteil. Sorokin schob das Fenster zu. Jetzt herrschte dumpfe Stille.
Sie wussten nicht, wie leicht man starb. Sie begriffen weder die Schönheit des Lebens noch seine Verletzlichkeit.
Der Junge lehnte sich an die Schulter der Mutter, sie deckte ihn mit ihrer Jacke zu.
Männerstimmen im Gang. Er hörte sie gedämpft durch die Holzwand zum Nachbarabteil: »Polizeikontrolle. Ihre Ausweise bitte.«
Sofort war er hellwach. Bis zur Grenze waren es noch zweieinhalb Stunden, das war keine Transportpolizei und keine Routinekontrolle. Er schalt sich einen Idioten, dass er den Kümmel getrunken hatte, so etwas drosselte die Reaktionsgeschwindigkeit. Freundlich wies er auf den freien Platz neben der Frau und dem Jungen und fragte: »Macht es Ihnen etwas aus? Mir wird übel, wenn ich gegen die Fahrtrichtung sitze.«
Die Frau verzog angewidert das Gesicht.
Trotzdem setzte er sich neben sie.
Die Abteiltür wurde aufgeschoben, und just in diesem Moment sagte die Frau schnippisch: »Ist ja auch kein Wunder. Der Schnaps hätte wirklich nicht sein müssen. Vor dem Jungen!«
Sorokin feixte innerlich. Besser konnte es nicht laufen. Sie wirkten wie eine typische Familie.
Aber die drei Uniformierten sahen es offenbar anders. Sie blickten ihm aufmerksam ins Gesicht. Der vordere sagte: »Polizeikontrolle. Ihren Ausweis bitte.« Die hinteren hatten ihre Hände am Pistolenhalfter, er sah es, als er sich vorbeugte, um in der Innentasche nach dem Ausweis zu graben.
Auch die Frau kramte, aber der Polizist sagte: »Nur der Herr.« Das quittierte sie mit einem rechthaberischen Lächeln.
Den vorderen konnte er erschießen. Wenn er es geschickt anstellte, würde die Kugel durch seinen Leib dringen und noch den Dahinterstehenden verletzen, aus dieser Nähe müsste das gelingen. Aber der dritte war ein Problem, und sie versperrten alle drei den Weg nach draußen. Mit dem Messer war er genauso schnell, und es war lautlos. Er hielt seinen Ausweis hin, während er an seiner Seite vorsichtig nach dem Kampfmesser tastete.
Der Polizist verglich das Foto mit ihm. »Herr Semmelrogge?«
»Stimmt etwas nicht?«, fragte er.
»Nennen Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum.«
»Aber es steht doch da drin.«
Die hinteren Polizisten lösten ihre Pistolen aus dem Halfter.
Er sagte gelangweilt: »Sechzehnter November neunzehndreißig.«
»Und Sie fahren nach …?«
»Berlin. Wollen Sie meine Fahrkarte sehen?«
Der Polizist reichte ihm den Ausweis zurück. »Nicht nötig. Gute Fahrt.« Er schob die Abteiltür zu.
Er steckte den Ausweis ein und sah den Polizisten hinterher. Wollten sie sich nur über ihr Vorgehen beraten und ihn mit ihrem Rückzug täuschen? Erst als er vom Nebenabteil die gleiche Frage nach dem Ausweis hörte, nahm er zögerlich die Hand vom Messer.
Die Frau war so weit wie möglich von ihm abgerückt. Sie hielt ihn offenbar für einen Alkoholiker.
In Erlangen stiegen die Polizisten aus. Er sah sie am Bahnsteig stehen und diskutieren. Als der Zug wieder anfuhr, holte er den gefälschten Ausweis hervor und besah ihn. Er hatte darauf geachtet, für das Passfoto andere Kleidung zu tragen. Und er hatte damals die blond gefärbten Haare mühevoll mit Brillantine zum Scheitel gekämmt. Eine allzu große Ähnlichkeit musste bei Passfälschungen vermieden werden, sie fiel auf. War der Ausweis schon vor Jahren ausgestellt worden und hatte man sich seitdem kein bisschen verändert, war das verdächtig.
Um 00:46 Uhr erreichten sie Ludwigsstadt, den letzten Ort im Westen. Als sich der Zug 1:01 Uhr in Bewegung setzte, wechselte Sorokin wieder auf seine Seite des Waggons. Jetzt war kein Theaterspielen mehr notwendig.
Eine Lautsprecheransage ertönte. »Werte Fahrgäste, halten Sie bitte Ihre Dokumente bereit. Wir passieren in wenigen Augenblicken die Zonengrenze.« Im Provinzbahnhof Probstzella kam der Zug zum Halt. Der Bahnsteig war gespenstisch leer, bis auf die Bewaffneten, die mit ihren Gewehren bereitstanden. Kein Passagier stieg ein oder aus, es herrschte Totenstille.
Der Heizer und der Lokführer erholten sich wahrscheinlich von der anstrengenden Bergfahrt über den Frankenwald. Sorokin prüfte den Sitz seiner Jacke. Die Waffen mussten gut verborgen bleiben, er wollte auch bei den Ostdeutschen kein Aufsehen erregen. Er holte seinen Koffer aus dem Gepäcknetz. Dabei konnte die Jacke verrutschen, deshalb machte er es lieber jetzt als unter den Augen der Kontrolleure.
Nach einer Weile öffnete sich die Abteiltür. »Guten Abend. Passkontrolle. Ihre Papiere bitte.« Mit dem Offizier der Staatssicherheit kamen Zollbeamte, die sich die Koffer öffnen ließen und das Gepäck durchsuchten. Beim Jungen fanden sie ein Comic-Heft, das wurde einbehalten.
Dreißig Minuten stand der Zug. Dann ging es weiter. Sie befanden sich jetzt in einer anderen Welt. Saalfeld war nicht Nürnberg, es konnte keine üppige Beleuchtung geben. Aber er erkannte den Unterschied selbst im Schein der spärlichen Laternen: An der Hausecke hatten schwere Geschütze Kerben hineingetrieben wie mit einer Axt. An manchen Stellen waren die Löcher mit Steinen geflickt worden, aber auch die Stuckfassade war von Granatsplittern zersprengt, und sie sah noch aus wie an dem Tag, an dem der Splitterhagel auf die Hauswand niedergegangen war. Dazu die verblassten Inschriften und die Lücken, die in der Straßenzeile gähnten, während im Westen auf den Trümmergrundstücken längst neue Häuser errichtet worden waren. Sicher gab es hier eine Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, eine Liebknechtstraße, Engelsstraße, Rosa-Luxemburg-Straße.
Sie würden gegen acht Uhr in den Berliner Ostbahnhof einfahren, nach zwölfeinhalb Stunden in diesem Abteil mit der mürrisch dreinblickenden Frau und ihrem Sohn. Kurz vor sieben würde es in Drewitz, vor der Grenze nach Westberlin, erneut einen Kontrollhalt geben. Niemand wusste, wo er im Augenblick war, er konnte genauso gut noch in München sein oder in Paris oder Hamburg oder tot. Machte ihn das frei? Er schüttelte einen letzten Tropfen aus dem Flachmann. Unfassbar, dass jemand mit dieser ollen Schachtel einen Sohn gezeugt hatte.
Südlich von Jena rauschten um 2:45 Uhr zwei Nachtzüge mit lichtsprühenden Fenstern aneinander vorüber. Der eine Zug war unterwegs nach Berlin. Darin saß Sorokin, der einen Menschen getötet hatte. Der andere Zug fuhr nach München. Darin saß Hähner, der den Getöteten gekannt hatte. Als der Luftdruck zwischen den Zügen knallte und die Waggons aneinander vorbeidonnerten, hätten sie einander für den Bruchteil einer Sekunde in die Augen blicken können. Dann war es vorbei, und es regierte wieder die Nacht.
3
Ria verließ den Bahnhof Plänterwald. Auf dem Weg zur Laubenkolonie überfiel sie die Angst, den größten Fehler ihres Lebens gemacht zu haben. Wie Max für sie Makkaroni gekocht hatte, der erste Kuss und wie sie beide hatten lachen müssen, der zweite, so viel stürmischere Kuss, die Schneeballschlachten, sein zärtliches Bitten, ob er über Nacht bleiben könne … Er hatte nie nach ihren Eltern gefragt, das war in der Tat eigenartig. Aber er konnte das genauso gut aus Rücksicht unterlassen haben. Sicher hatte er bemerkt, dass sie bei Fragen nach ihrer Vergangenheit einsilbig wurde.
Die Kleingärten kamen in Sicht, Lauben, kahle Büsche, kahle Bäume. Ria ging am Zaun entlang, wie in ihrer Kindheit.
Dort das Gartentor, dahinter die Holzhütte mit dem Dach aus Teerpappe, die alte Badewanne, die als Regenwasserspeicher diente, der Komposthaufen. Am Gartentisch mit der wetterfesten Kunststoffdecke hatte sie Fassbrause getrunken, in der Gerätekammer mit verrosteten Nägeln gespielt. Hier hatte sie begonnen, Vertrauen zu ihren Stiefeltern zu fassen. Hier hatte sie einmal für kurze Zeit nicht an Vater und Mutter und die Schwester gedacht. Die abgeplatzte grüne Farbe der Laube war beruhigend vertraut. Vor dem Beet, das die Stiefmutter gerade mit Hingabe umgrub, hatte sie als Zehnjährige mit aufgeweichten Kekskrümeln Ameisen gefüttert.
»Ria!« Brigitte richtete sich auf. Ihre blauen Augen leuchteten. »Das ist ja toll, dass du uns besuchst.« Sie rief nach Gerd. Der stieg hinten bei den Apfel- und Birnbäumen von der Leiter herunter, die Astschere in der Hand. Die anderen Gärten waren wie ausgestorben. Während die meisten Leute noch Mütze und Handschuhe trugen, werkelten ihre Stiefeltern bereits wieder an den Beeten und Bäumen herum.
Mit dem Handrücken wischte sich Brigitte die Haare aus der Stirn, bemüht, ihr Gesicht nicht allzu sehr zu beschmutzen. »Montag ist der große Tag, stimmt’s? Ach, Kleine.«
Ria hasste es, wenn Gitte sie so nannte. Die Vertraulichkeit stand ihr nicht zu. »Deshalb bin ich hier. Ich wollte mit euch reden.«
Wie konnte sie unverdächtig nach Max fragen? Es passte zu den Stiefeltern, ihr einen Freund als Aufpasser zu schicken. Es passte zum Stufenprogramm der Pioniere für das Leistungsabzeichen »Immer bereit«, zum »Antreten – stillgestanden – rechts um – halt!«, zum »Schützen der roten Fahne, wenn sie in Gefahr ist«, zum Marschieren als Klassenkollektiv am 1. Mai. Es passte zu Fähnchen aus Papier, mit denen man im Vorbeimarschieren den Genossen auf der Tribüne zuzuwinken hatte, in einer Art, die kaum im Zaum zu haltende Freude zum Ausdruck brachte, und weil sie, Ria, das Fähnchen nur lustlos wie einen nassen Waschlappen schwenkte, hatte man sie zur Strafe ein Porträt von Otto Grotewohl tragen lassen.
Das Ministerium war der logische Schlusspunkt der Geraden, auf die Brigitte und Gerd sie gesetzt hatten. Nach Schule und Ausbildung folgte »Mein Arbeitsplatz – mein Kampfplatz für den Frieden«, und es war eine Ehre, dass sie ihn im Ministerium für Außenhandel antreten durfte. Sicher hatten die beiden dafür ordentlich ihre Beziehungen spielen lassen.
In Gedanken ging sie die Gespräche mit Max durch. Dauernd war es in den letzten Wochen um ihre Stelle im Ministerium gegangen. Aber Männer waren sehr auf das Berufliche fixiert, das musste nicht heißen, dass er im Auftrag ihrer Stiefeltern handelte.
Sie sagte: »Wisst ihr noch, der Student, den ich kennengelernt habe?«
Brigitte warf Gerd einen Blick zu. »Dieser … Max?«
»Er hat behauptet, dass er euch kennt.«
»Wirklich, woher denn?«
Sie schien ehrlich interessiert zu sein. Ria setzte sich an den Gartentisch, und auch die Eltern setzten sich. »Irgendwas mit dem VKSK«, log sie. Natürlich waren ihre Stiefeltern im Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter in der Führung tätig, o nein, Führung, das durfte man nicht sagen, es hieß ja extra Fahrerlaubnis und nicht Führerschein, führen war ein böses Naziwort, also waren sie auch nicht in der Führung, sondern in der Leitung. Gerd und Brigitte leiteten, es war ihnen gegeben. Sie leiteten in der SED, sie leiteten im VKSK, und sie leiteten ein fremdes Kind, das gegen seinen Willen in ihre Obhut gegeben worden war.
»Gut möglich«, sagte Gerd. »Bring ihn doch mal mit. Scheint ja etwas Ernstes mit euch zu sein.« Er lächelte. »Wenn du an einem kalten Februarsamstag raus in den Garten kommst, heißt das was.«
Ria versuchte, in den Gesichtern der Stiefeltern zu lesen, fand aber keinerlei Anzeichen darin, dass sie sich ertappt fühlen könnten. Die beiden waren ganz bei sich.
»Erst einmal konzentrierst du dich auf die neue Arbeitsstelle«, bestimmte Brigitte. »So eine Chance bekommt nicht jeder.«
Jemand mit deiner Vergangenheit schon gar nicht, wollte sie das sagen? Wut stieg in Ria auf. Sie hatte die Chance bekommen, Vater und Mutter zu verlieren. Die Chance, von der geliebten Schwester getrennt zu werden. Die Chance, in einer fremden Wohnung zu stehen und Brigitte, damals eine fremde Frau für sie, sagen zu hören: »Das ist jetzt dein neues Zuhause. Wir wollen, dass du Mama und Papa zu uns sagst.«
Sie war kurz davor, zum ersten Mal seit Jahren die eiserne Familienregel zu brechen. Vielleicht wurde es Zeit dafür. Sie fragte: »Wo ist meine Schwester? Wisst ihr es?«
Brigitte erstarrte. Sie schien nicht mehr zu atmen. Gerd kniff die Lippen zusammen. Früher hatten sie Ria ohne Abendbrot ins Bett geschickt, wenn sie nach ihrer Familie fragte, und wenn sie nicht aufhörte zu betteln, hatten sie sie geschlagen.
Schwieg man lange genug zu einem Thema, dann wurde es leblos, es verging, es war wie tot. Aber sie sollten merken, dass es gelebt hatte die ganze Zeit, dass der Gedanke an Jolanthe immer da gewesen war, verborgen zwar, aber unverändert.
»Nein«, brachte Gitte heraus. »Das wissen wir nicht.« Sie hatte plötzlich einen Tränenschleier in den Augen.
Ria sah zu Gerd.
Der schüttelte nur den Kopf. Man sah ihm die Enttäuschung an.
»Kleine, wir haben alles für dich getan«, sagte Brigitte. »Alles. Nur da konnten wir nicht helfen. Vermisst du sie, ja?«
Die Frage tat Ria weh. Hatte Gitte tatsächlich gemeint, die Sehnsucht nach der Familie, die man ihr genommen hatte, konnte ausgerissen werden wie ein Unkraut, das man anschließend verbrannte? War sie für Gitte ein fühlloses Beet, das man nur ausgiebig genug bearbeiten musste?
Gleichzeitig beschämte sie der Zorn, den sie empfand. Brigitte und Gerd hatten ihr auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz Zuckerwatte und kandierte Äpfel gekauft. Sie waren begeistert gewesen, wenn sie mit guten Noten von der Schule nach Hause kam. Gitte hatte Kuchen gebacken zum Geburtstag, und Gerd hatte ihr im Herbst einen Drachen gebaut. Sie hatten alles getan, was man von guten Eltern erwarten konnte. Rias Frage verriet ihnen, dass es nicht genug gewesen war. All die jahrelangen Mühen hatten nicht gereicht. Natürlich enttäuschte sie das.
Ria stand auf, nahm sich Brigittes Spaten und begann, ein noch unbearbeitetes Beet umzugraben. Sie stach den Spaten in die Erde, hob schwere Brocken an, drehte sie um und zog das Spatenblatt darunter hervor, nur um es erneut in die Erde zu stoßen, zwei Handbreit weiter rechts. Sie wusste, dass die Stiefeltern sie anstarrten. »Ist euch klar«, keuchte sie, »dass ich jedes Mal, wenn ich Schwestern sehe, in Tränen ausbrechen könnte? Ich verstehe es einfach nicht, warum man mit aller Macht verhindern will, dass wir uns finden. Was würde denn Schlimmes passieren?«
Die Stiefeltern schwiegen.
Ohne den Blick zu heben, sagte sie: »Vielleicht ist das Ministerium ja gar nicht so schlecht? Die haben in der Regierung doch Karteikarten über jeden von uns. Irgendwo steht da was über Jolanthe. Ich finde meine Schwester schon.«
Irgendwann lösten sich die Stiefeltern aus ihrer Starre und begannen ebenfalls zu arbeiten. Aber das Schweigen im Garten war ungut. Als Ria sich nach zwei Stunden verabschiedete, wirkte Gitte immer noch erschüttert. »Mach keine Dummheiten, Ria.« Sie streckte den Arm aus, wagte dann aber doch nicht, sie zu berühren.
Ria war, als würden sich die Stacheln, die sie nach außen reckte, genauso nach innen kehren. »Ist gut, Mama.«
»Mama«, wiederholte Brigitte leise, als müsste sie das Wort betasten. Eine zarte Röte huschte über ihre Wangen, und sie lächelte tapfer.
Er ließ sich von der Fahrbereitschaft nicht nach Pullach bringen, sondern zum Institut für Gerichtliche Medizin, und fand rasch den richtigen Obduktionssaal. Der scharfe Geruch von Formalinlösung stach Hähner in die Nase. Die Mediziner waren immer noch an Banderas Leiche zugange. Nur sein Gesicht war von einem Tuch bedeckt.
»Darf ich?«, fragte er.
Sie nickten.
Er hob das Tuch vom Gesicht der Leiche. Die Haut des Toten wirkte wächsern, die Mundwinkel waren leicht heruntergezogen. Bandera erschien ihm klein, blass, enttäuscht. Sicher hätte er gern weitergelebt.
Hähner konnte sich eines Schuldgefühls nicht erwehren. Schickte er die Menschen in den Tod?
Spann sagte: »Ein Einstichloch haben wir nicht gefunden. Aber zwei winzige Glassplitter im Gesicht.«
»Diese Schweine.«
»Das ist noch nicht alles.« Er hielt ihm ein kleines graues Organ hin, es lag wie ein Tier in seinen weißen Handschuhhänden. Das Organ war mit einem glatten Schnitt geöffnet worden, an dem er es jetzt mit den Daumen auseinanderbog. »Der Magen. Riechen Sie mal.«
Hähner überwand seinen Würgereiz und roch kurz daran, aber der Formalingestank überdeckte alles.
»Bemerken Sie den Bittermandelgeruch?«
»Nein.«
Der Kollege stand finster dabei, es sah aus, als hielte er die Schultern etwas hochgezogen.
»Es gibt große Unterschiede zwischen den Menschen, ob man diesen speziellen Geruch wahrnehmen kann oder nicht. Das ist angeboren. Manche, wie mein Kollege, spüren erst nach längerer Zeit ein Kratzen im Rachenbereich.«
»Also Blausäure?«
»Richtig, Cyanwasserstoff. Nimmt man Natriumcyanid in salzartiger Substanz zu sich, wird im Magen durch den Verdauungssaft Blausäure freigesetzt. Das dauert. Der Tod tritt nicht schnell ein. Aber die geringe Menge hier im Magen war nicht die Todesursache, er hat nur ein wenig von der Blausäure geschluckt, die sich in seinem Mund gesammelt hatte. Zuerst hat er Blausäuregas eingeatmet. Darauf kam es an. Fünfzig Milligramm genügen, ein Zwanzigstel von einem Gramm, und ein erwachsener Mensch stirbt binnen Sekunden. Der Cyanwasserstoff unterbindet einen lebensnotwendigen biochemischen Vorgang, die Zellatmung, also den Prozess, mit dem jede einzelne Zelle des Körpers für sich Energie herstellt. Das Cyanid bindet ein kritisches Enzym der Zellatmung und macht es damit funktionsunfähig.«
Hähner hatte gewusst, dass schon sechs Bittermandeln ein Kind tödlich vergiften konnten, aber dass die Blausäurevergiftung auch gasförmig geschehen konnte und dann noch schneller wirkte, war ihm neu.
Spann sagte: »Ich vermute, der Täter hat ihm das Blausäuregas mit irgendeiner Apparatur ins Gesicht gesprüht.«
»Danke. Schicken Sie den Befund nach Pullach.«
Wie betäubt kehrte Hähner ins Auto zurück, das ihn in den Vorort brachte.
An der Pforte wurden sie nach kurzer Prüfung eingelassen, das Rolltor öffnete sich, und sie fuhren auf das geheime Gelände, das angeblich zur Bundesvermögensverwaltung gehörte, Abteilung Sondervermögen, Außenstelle Pullach. Früher hatten die BND-Mitarbeiter samt ihren Familien hier gelebt, mit eigener Schule, eigenem Schwimmbad, Ärzten, Friseur und Einkaufsmöglichkeiten, umgeben von den hohen Mauern mit Stacheldraht. Ein autarkes Städtchen, das auf keiner Karte verzeichnet war. Er selbst hatte die Schlussphase noch miterlebt, mit dem Hickhack, wenn das Kind von BND-Kollegen auf eine reguläre Schule außerhalb der Mauern wechselte und die Schulbehörde verwirrt nachhakte, weil es die Schule, auf der es bisher gewesen war, gar nicht gab, oder weil die zur Täuschung angegebene Schule, auf der es gewesen sein sollte, noch nie von diesem Schüler gehört hatte. Sogar vor den amtlichen deutschen Stellen hielt man die Arbeit des BND geheim.
Inzwischen wohnten alle Beschäftigten außerhalb, viele von ihnen waren unter Decknamen gemeldet und hatten den Decknamen natürlich auch auf das Klingelschild geschrieben. Für die Außenwelt hießen sie so und gingen einem regulären Beruf nach. Für Wohnungen gab es auf dem Gelände keinen Platz mehr bei rund achthundert Angestellten.
Vor dem »Weißen Haus« hielt das Auto, und er stieg aus. Der steinerne Adler über dem Haupteingang trug kein Hakenkreuz mehr in seinen Klauen, aber man sah dem Gelände noch an, dass es einst die Reichssiedlung Rudolf Heß gewesen war, benannt nach dem »Stellvertreter des Führers«, ein rechteckiges Ensemble von dreißig Ein- und Zweifamilienhäusern, alles exakt ausgemessen und in symmetrischer Anordnung um einen begrünten Rechteckplatz platziert, am Kopfende die frühere Villa von Martin Bormann. Das »Weiße Haus« strahlte unter dem blauen Himmel, und die breite Front mit den großen Sprossenfenstern wirkte einladend.