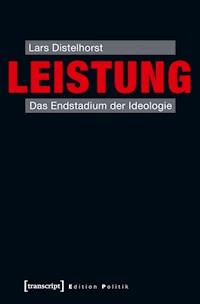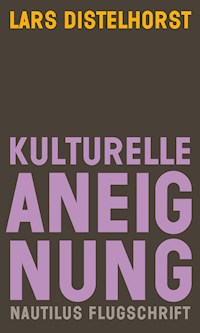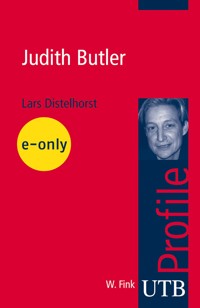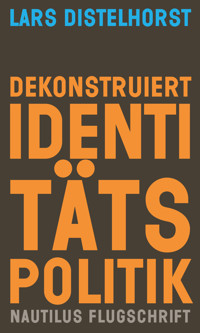
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nautilus Flugschrift
- Sprache: Deutsch
Noch vor wenigen Jahren stand die Identitätspolitik mit ihrer Kritik an Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Betroffene fanden zueinander und forderten gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Themen wie die deutsche Kolonialgeschichte oder die rassistische Durchsetzung der Alltagssprache waren in aller Munde, bislang gültige Ordnungskriterien wurden in Frage gestellt. Dann begann sich das politische Gewicht zu verschieben. »Woke« wurde zu einem Schimpfwort von rechts, und in Praxis und Methoden identitätspolitischer Anliegen zeigten sich Schwächen: ein unterkomplexes Verständnis der Performativität von Sprache, die Missachtung wissenschaftlicher Standards, die Ausklammerung ökonomischer Zusammenhänge und die Reproduktion zentraler neoliberaler Versatzstücke. Spätestens seit dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 und seiner antisemitischen Relativierung scheinen breite Teile der Bewegung auf den politischen Bankrott zuzusteuern. Wie konnte es dazu kommen? Lars Distelhorst nimmt die philosophischen Grundannahmen und Methoden der Identitätspolitik unter die Lupe und wagt einen Neuansatz. Eine Umkehr im Denken lohnt sich, denn die neoliberale Ökonomisierung und ihre Machtmechanismen sind nicht nur tief in unsere Subjektivität vorgedrungen, sondern haben die bisherigen Errungenschaften der Identitätspolitik auch erfolgreich vereinnahmt. Dagegen gilt es, Identität neu zu politisieren – als Werkzeug einer emanzipativen Kritik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARS DISTELHORST, geboren 1972 in Georgsmarienhütte, hat an der Universität Bremen Politikwissenschaft studiert und promovierte an der FU Berlin über Geschlechterpolitik. Er ist Professor für Sozialwissenschaft an der Fachhochschule des Mittelstands Berlin. Zuletzt erschien Kulturelle Aneignung (2021).
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49a
D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus GmbH 2025
Erstausgabe Mai 2025
Umschlaggestaltung: Maja Bechert
www.majabechert.de
Satz: Corinna Theis-Hammad
www.cth-buchdesign.de
Porträt des Autors auf S. 2:
© Die Hoffotografen GmbH
1. Auflage
ePub ISBN 978-3-96054-390-9
Inhalt
Einleitung
Geschichte einer kulturellen Aneignung
Akademische Affären und die Magie der Sprache
Über die Performativität der Sprache
Die Sprecherposition und der Apfel
Erfahrung und repressive Toleranz
Der vergessene Materialismus
Vom Autoritarismus …
… zum Antisemitismus
Herren, Knechte und Klassen
Intersektionalität und Vergesellschaftung
Das universelle Moment der Identität
Nachwort
Anmerkungen
Literatur- und Quellenverzeichnis
»Es gibt nichts Natürlicheres, als sich für den Ausgangspunkt von allem zu halten, erwählt als Zentrum der Welt; auf diese Weise ist man in der Lage, die Welt zu verdammen, ohne ihr trügerisches Geschwätz auch nur hören zuwollen.«
(GuyDebord)
»Nur über das Leiden kann noch gerettet werden, wasschon längst verloren ist: die phantasmatische Hoffnung, dass die eigene Subjektstruktur doch nicht ganz so sehrvon Gesellschaft durchdrungen ist, sondern ihr selbstbestimmt und echt gegenübersteht. Eine solche Haltungentlarvt sich aber gerade über ihre Beteuerung widerspruchsloser Authentizität: Die Unwahrheit steckt imSubstrat von Echtheit selber, dem Individuum.«
(Theodor. W. Adorno)
Einleitung
»Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten.«1
Mit diesen Worten beginnt bekanntlich das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, 1847 als Programm für den »Bund der Kommunisten« einstimmig angenommen, 1848 in London als eigenständige Schrift publiziert, kurz vor der Februarrevolution in Frankreich und der Märzrevolution im Deutschen Bund. Bis heute zählt es zu den zehn meistverkauften Büchern der Welt.2 Die drängenden Probleme der damaligen Zeit standen im Zeichen des sich entwickelnden Kapitalismus: die Armut der Arbeiterklasse, menschenverachtende Arbeits- und von äußerster Enge geprägte Wohnbedingungen sowie von Gewalt gekennzeichnete politische Herrschaftsverhältnisse. Diese Misere konnte, so Marx und Engels, nur durch eine proletarische Revolution überwunden werden, in deren Zuge die Kontrolle über die Produktionsmittel in die Hände der Arbeiterklasse gelangen, eine »Diktatur des Proletariats« und schließlich der Kommunismus als Reich der Freiheit errichtet würde. Die Hoffnung auf eine Revolution ist lange her und das Reich der Freiheit lässt nach einigen krachend gescheiterten Versuchen noch immer auf sich warten.
Wenn Marx und Engels heute lebten – was würden sie wohl schreiben? Angesichts der politischen Stimmung wäre es durchaus denkbar, dass sie ihr Manifest wie folgt beginnen würden: »Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst der Identitätspolitik.« Die drängende Aktualität des Themas wäre den beiden sicher nicht entgangen. Auch die Rede von dem in einer »heiligen Hetzjagd« begriffenen Bündnis gegen dieses Gespenst kann auf die heutige Zeit übertragen werden. Sichtet man die aktuellen Publikationen zum Thema Identitätspolitik, ist man erstaunt über die Vielzahl der Veröffentlichungen, die sich über die politischen Lager hinweg über dessen Fruchtlosigkeit einig und bemüht sind, es auf das politische Abstellgleis zu schieben.
Verglichen mit der kommunistischen Weltrevolution ist Identitätspolitik eigentlich eine unaufgeregte Angelegenheit: Sie bezeichnet die seit den späten 60er Jahren einsetzenden politischen Bemühungen (der Stonewall-Aufstand 1969 in New York kann hier als historischer Beginn betrachtet werden), sozialen Randgruppen ein höheres Maß an sozialer Anerkennung zu verschaffen und ihnen dadurch eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Im Zuge der erhöhten Aufmerksamkeit für die Diskriminierung marginalisierter Menschen wie z. B. der Schwarzen Bevölkerung in den USA, der migrantischen Bevölkerungsteile in den europäischen Staaten, Menschen, die von Heterosexualität und binären Geschlechterzuordnungen abweichen oder Menschen mit sogenannten Behinderungen fordert Identitätspolitik statt der Überwindung des Kapitalismus wesentlich pragmatischer nur die volle Integration ausgeschlossener Gruppen in die bestehende Gesellschaft, deren Ressourcen fair verteilt und allen zugutekommen sollten. Das bedeutet vor allem einen diskriminierungsfreien Umgang auf der zwischenmenschlichen Ebene, die restlose Gleichstellung in rechtlicher Hinsicht sowie die Würdigung des Beitrags marginalisierter Menschen zum Funktionieren der Gesellschaft.
Die wesentliche theoretische Grundlage der Identitätspolitik stellt bis heute die philosophische Strömung des Poststrukturalismus dar. Dieser entstand Ende der 60er Jahre und richtete sein Augenmerk vor allem auf die kritische Hinterfragung bis dahin nicht in Frage gestellter Weisen wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung und für die Gesellschaften des globalen Nordens zentraler sozialer Ordnungskategorien wie z. B. race und Gender. Das wichtigste Argument in diesem Rahmen war die These, unsere soziale Wirklichkeit sei nicht objektiv erkennbar, sondern werde erst im Rahmen gesellschaftlicher Diskurse hergestellt bzw. konstruiert (daher auch der oft für dieses Denken verwendete Begriff des Konstruktivismus), die bis in die Tiefe von nur schwer erkennbaren Machtmechanismen durchzogen seien und dadurch nicht zuletzt auch Ausschlüsse und Diskriminierung produzieren würden. Um diese Formen der Ungerechtigkeit abzubauen, sehen es Autor*innen und Aktivist*innen aus dem Umfeld der Identitätspolitik bis heute als ihre Aufgabe, gesellschaftlich etablierte Diskurse über race und Gender (und mittlerweile auch Behinderung, Klassismus, Adipositas usw.) zu hinterfragen oder – wie es in diesem Zusammenhang heißt – zu dekonstruieren. Zentral ist dabei auch der Begriff der Intersektionalität. Er bezeichnet die Überlagerung und das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungsformen und wurde ursprünglich mit Blick auf die Erfahrungen Schwarzer Frauen in die Diskussion eingeführt, die innerhalb der Schwarzen Bewegung als Frauen und innerhalb der feministischen Bewegung als Schwarze Menschen ausgegrenzt wurden.3 Mit kritischem Blick auf die hinter vermeintlicher Normalität versteckten Unterdrückungsmechanismen fragt der Begriff gezielt nach blinden Flecken in der Kritik von Ausbeutung und Ausschließung und versucht, Schieflagen in gesellschaftlichen Anerkennungsverhältnissen zu beseitigen.4
Was bei nüchterner Betrachtung eine folgerichtige Entwicklung innerhalb der kritischen Sozial- und Geisteswissenschaften sowie des linken politischen Engagements darzustellen scheint, wird heute allerdings oft als Irrweg dieser Theorie und Praxis dargestellt. Kritiker*innen der Identitätspolitik erscheint sie vor allem als Bewegung, die sich aus Schwarzen Aktivist*innen, jungen Feminist*innen oder LGBTQIA+-Personen zusammensetzt, lautstark die Unterdrückung in all ihren vermeintlichen Schattierungen anklagt, sich dabei in kämpferischer Rhetorik gegen angeblich privilegierte Menschen wendet (als sprichwörtliches Musterbeispiel: der viel zitierte »alte weiße Mann«) und im Namen von Inklusion und sozialer Gerechtigkeit revolutionäre Veränderungen in der Kultur und vor allem der Sprache, die als Wurzel allen Übels gesehen wird, durchzusetzen versucht. Das führe, so die Kritiker*innen, im günstigen Fall zu amüsanten und im schlechten zu grotesken Ergebnissen. Entsprechend breit scheint den Kritiker*innen von links bis rechts die vom identitätspolitischen Diskurs dargebotene offene Flanke.
Beginnen wir mit einem Blick nach links. Susan Neiman kritisiert die identitätspolitische Abkehr von Aufklärung und Universalismus und die dadurch entstehende Konzeptlosigkeit, die dem gesellschaftlichen Rechtsruck in die Hände spiele.5 Caroline Fourest betont vor allem die Auswüchse der Identitätspolitik an den Universitäten, durch die ihr zufolge ein Klima gesellschaftlicher Zensur entstehe, in dem Gegenargumente und Diskussion nicht länger gewünscht seien und die Linke sich selbst demontiere (dieses Argument wird auch von konservativen und rechten Autor*innen vertreten).6 In eine ähnliche Richtung weisen die Überlegungen von Helen Pluckrose und James Lindsay, denen zufolge aus dem Poststrukturalismus eine »aktivistische Wissenschaft« geworden ist, die anstelle von Wahrheit vor allem um Deutungshoheit bemüht sei, eine Bedrohung für die Wissenschaftsfreiheit darstelle und zur Ausblendung drängender sozialer Probleme führe, unter der nicht zuletzt die von ihr selbst ins Feld geführten Minderheiten zu leiden hätten.7 Als das größte dieser Probleme betrachtet Catherine Liu die sich immer weiter öffnende soziale Schere und die Verarmung breiter Bevölkerungsteile, die durch eine einseitige Schwerpunktlegung auf das Thema Identität aus dem Fokus linker Politik geraten würden.8 Diese Kritik des Verlustes am Allgemeinen orientierter Fragestellungen öffnen Bernd Stegemann9 und Yascha Mounk10 schließlich noch weiter, indem sie sich mit den Widersprüchen der Identitätspolitik beschäftigen, um schließlich ein neues Plädoyer für Universalismus und humanistische Werte zu formulieren. Den umgekehrten Weg beschreitet schließlich Jens Balzer, der in seinem Essay After Woke11 wie bereits zuvor in Ethik der Appropriation12 eine Rückkehr zu den Wurzeln des Poststrukturalismus, des Postkolonialismus und des Queerfeminismus fordert, um das Hybride und Unabgeschlossene von Identität wieder in den Vordergrund zu rücken und so gegen deren aktuelle essentialistische Vereinnahmung in Schutz zu nehmen.
Aus dem konservativen bis rechtskonservativen Lager sind die Klagen bezeichnenderweise durchaus ähnlich. John McWhorter interpretiert die Identitätspolitik und ihren Fokus auf soziale Gerechtigkeit für Minderheiten als eine neue Form der Religion, die um einige simple »Dogmen« gestrickt sei (die er tabellarisch auflistet) und zur Blindheit gegenüber den eigentlichen Problemen der Schwarzen Bevölkerung in der USA führe sowie Schwarzen Jugendlichen den Mut zu autonomer Selbstentfaltung nehme.13 In verschärfter Form nimmt Douglas Murray diese Vorlage auf. Für ihn stellt die Diskussion über Identität und ihr Fokus auf Minderheiten eine Art des Massenwahns dar, der nach dem Niedergang des Marxismus und anderer Ideologien als Ersatzreligion fungiere, die Kultur dominiere, Abweichler*innen mit drakonischen Strafen belege und wie ein totalitäres System funktioniere.14 Wie ein Echo darauf erscheint die Argumentation Zana Ramadanis und Peter Köpfs, die in der Identitätspolitik das Wirken einer neuen Elite ohne demokratische Legitimation ausmachen, die von ihren Schlüsselpositionen in Universitäten, Parteien und Medien tief in die Gesellschaft hineinwirke und dadurch sowohl die Demokratie zerstöre als auch der extremen Rechten einen roten Teppich ausrolle.15
Diese Liste der Kritiker*innen ist nicht im Ansatz vollständig und ließe sich um ein Vielfaches verlängern. Der Gesamteindruck würde sich dadurch allerdings kaum ändern, denn die wesentlichen Argumente und Anklagen wiederholen sich in beiden politischen Lagern: Beschädigung der Wissenschaft, Verbreitung von Zensur, Ignoranz gegenüber dem eigentlich Wichtigen, Erzeugung eines Klimas der Angst, Spaltung der Gesellschaft, Zerstörung der Demokratie.
Beim Lesen dieser und anderer Bücher schleicht sich recht bald der Verdacht ein, es handle sich bei ihnen um die ausformulierte und um Zitate ergänzte Ausführung eines Standpunktes, der bereits im Vorfeld der Arbeit festgelegt war und im Zuge der Niederschrift zu keinem Augenblick ins Wanken gekommen ist – also eher um Plädoyers denn um ergebnisoffene Untersuchungen. Fourest sucht sich zum Beispiel zur Verdeutlichung ihrer Argumentation immer diejenigen skurrilen Ereignisse heraus, bei denen sich wohl auch viele Vertreter*innen identitätspolitischer Standpunkte an den Kopf fassen würden, und stellt sie als repräsentativ für die Gesamtheit dar. Ähnliche Strategien finden sich auch in den meisten anderen Büchern zum Thema. Der Ton ist häufig polemisch und pocht, wie es für jede Form der Polemik der Fall ist, auf die vermeintlich für alle sichtbare Selbstevidenz des eigenen Standpunktes, statt sauber zu argumentieren und sich dadurch angreifbar zu machen. In dieser Hinsicht hat diese Kritik viel mit dem gemein, was sie der Identitätspolitik oft unbelegt unterstellt.
Doch dieses Buch soll keine Kritik der Kritik werden, und so einfach ist diese auch nicht zu entsorgen. Von poststrukturalistischer Philosophie und postkolonialer Theorie als Grundlage der Identitätspolitik bleibt in den zu Spiegel-Bestsellern avancierten Büchern bekannter Autor*innen der identitätspolitischen Bewegung (wie denen von Kübra Gümüṣay oder Tupoka Ogette) kaum etwas übrig, und dieses Wenige verkommt spätestens in der öffentlichen Diskussion dann oft auch noch zu Spruchweisheiten, die den von McWhorter als religiöse Gebote bezeichneten Dogmen durchaus nahekommen. Auch dass heute eine unbedachte Sprachwahl oder Widerspruch gegen zentrale Feststellungen der Identitätspolitik (wie z. B. die soziale Konstruiertheit von Geschlecht) im akademischen Milieu zu Ausgrenzung führen können, ist nicht zu bestreiten – wie die Ereignisse um den abgesagten Vortrag zum Thema biologische Zweigeschlechtlichkeit von Marie Luise Vollbrecht (die zuvor einen von vielen Menschen als transfeindlich und reaktionär wahrgenommenen Beitrag über die aktuelle Genderdebatte in der WELT veröffentlicht hatte) während der Langen Nacht der Wissenschaft an der Berliner Humboldt Universität zeigen. Und nach zahlreichen einschlägigen Kommentaren und Beifallsbekundungen im Anschluss an das Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 kann der in weiten Teilen der (identitätspolitischen) Linken verbreitete Antisemitismus nicht mehr bestritten werden (auf diese Thematik wird im Kapitel über Antisemitismus intensiv eingegangen).
Irgendetwas scheint mit der Identitätspolitik nicht mehr zu stimmen. Und das ist fatal. Denn Identität ist das politische Thema der Stunde. Es verbirgt sich hinter den partei- und länderübergreifend mit erschreckender Brutalität geführten Debatten um Migration und Flucht, von der »Ausländer raus«-Attitüde der AfD über die englische Diskussion um Abschiebungen nach Ruanda bis hin zu den ständig ergänzten Gesetzen zur europäischen Grenzsicherung. Es steckt hinter der Omnipräsenz des Themas Klimaschutz, das bei vielen Menschen vor allem Ängste vor Wohlstandsverlust, tiefen Eingriffen in ihren gewohnten Lebensstil und nicht zuletzt vor Katastrophen globalen Ausmaßes auslöst. Und es findet sich zwischen den Zeilen der Diskussion über wachsende soziale Ungerechtigkeit, die vor allem auch eine Frage nach Anerkennung, Partizipation und Handlungsmacht von Menschen ist.
Vor allem aber ist Identität aus dem Grund das Thema der Stunde, weil die Gesellschaften des globalen Nordens sich in einer fortgeschrittenen Phase der neoliberalen Ökonomisierung befinden, die schon seit langem auch den Menschen als Subjekt einschließt. Die Literatur über den stärker werdenden Zwang zu Selbstoptimierung, Flexibilisierung und lebenslangem Kompetenzerwerb ist kaum noch zu überblicken. Keine Diskussion über den Kapitalismus oder soziale Gerechtigkeit kann heute noch ohne den Identitätsbegriff geführt werden, da die Marktmechanismen auch in der Psyche der Subjekte verankert werden und diese Stück für Stück erobern – unsere Identität also tief von kapitalistischen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen durchdrungen ist. Deshalb muss Kapitalismuskritik heute auch eine Kritik der Mechanismen umfassen, mittels derer wir innerhalb des modernen Kapitalismus zu Subjekten gemacht werden. Denn wenn Menschen ihre eigene Entfremdung erst zu genießen beginnen, weil sie diese nicht mehr durchschauen, ist es für jede Form von Emanzipation zu spät. Um Identitätspolitik kommen wir also nicht herum.
Dieses Buch möchte ausgehend vom Befund der zentralen politischen Stellung des Themas Identität eine Kritik der Identitätspolitik formulieren, denn Auseinandersetzung und Kritik sind unabdingbar, um die Argumente des Gegenübers ernst zu nehmen und ihnen, nicht zuletzt im Widerspruch, gerecht zu werden. Menschen ernst zu nehmen, bedeutet immer auch, sowohl mit ihnen als auch gegen sie zu diskutieren, um Standpunkte und Argumente aneinander zu messen. Im Anschluss daran wird der Versuch unternommen, ein alternatives Verständnis des Begriffs der Identität zu entwickeln, das Ausgangspunkt für eine emanzipative Theorie und Praxis über die Grenzen von Identitätskategorien hinweg sein kann und so die Möglichkeit zu politischem Austausch und gemeinsamem Handeln schafft. Auch wenn die Kritik an der Identitätspolitik auf dem Weg dorthin mitunter sehr weitreichend ist und recht hart scheinen mag, folgt sie dadurch doch dem Grundgedanken der Dekonstruktion, Argumente und Denkstrukturen kritisch in ihre Einzelteile zu zerlegen, um sie ihrem Geist entsprechend anschließend neu zusammenzusetzen und so einen konstruktiven Beitrag zur Debatte zu leisten.
Das Buch möchte auch klären, wie das Thema Identität von der politischen Rechten besetzt werden konnte, die in ihm das Schlachtfeld ausmacht, auf dem sie siegreich zu neuer Bedeutung emporsteigen wird. Ihre aktuellen Erfolge geben ihr in dieser Strategie leider Recht. Angesichts seiner Relevanz muss die identitätspolitische Linke sich die Frage stellen, warum sie diesem Trend offensichtlich so wenig entgegenzusetzen hat.
Genau diese Frage stellt sich auch dieses Buch. Um sie zu beantworten, werden zunächst die Rolle der Sprache in der identitätspolitischen Diskussion und dabei vor allem deren zentrale theoretische Ansätze aus Linguistik und Philosophie betrachtet. Durch die einseitige Fixierung auf eine sprachlich vermittelte soziale Konstruktion – so die These – geraten die materiellen Grundlagen von Erfahrung und mit ihnen die ökonomischen Strukturen aus dem Blick. Daraus folgen potentiell autoritäre Tendenzen (die, wie zu sehen sein wird, sogar in Antisemitismus umschlagen können), da infolge dieses Reduktionismus keine Alternative zur bestehenden Gesellschaft entwickelt werden kann, die über eine Forderung nach Einhaltung moralischer Gebote und Inklusion hinausgeht. In den für die Identitätspolitik zentralen Begriffen der Anerkennung, der Intersektionalität und des Universellen sind allerdings Auswege aus diesem Dilemma angelegt, die zudem das Potential zu einer grundlegenden Veränderung hin zu einer freien Gesellschaft in sich bergen.
Geschichte einer kulturellen Aneignung
Bei der Lektüre von Artikeln über die Geschichte des Begriffs »woke« kristallisieren sich schnell zentrale Daten heraus. In einem Artikel für die Webseite des Legal Defense Fund der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) verweist die Autorin Isheena Robinson auf den Aufruf »Wake up Ethiopia! Wake up Africa!« in einer Aphorismen- und Ideensammlung von Marcus Garvey aus dem Jahr 1923. Auch wenn es sich hier noch um einen allgemein gehaltenen Appell und nicht um eine Neudefinition handelt, erkennt Robinson darin das erste Auftauchen des Begriffs.1 Garvey vertrat eine radikal antikolonialistische Position und gründete 1914 in New York die UNIA-ACL (Universal Negro Improvement Association and African Communities League), mit der er sich im Geiste des Panafrikanismus für eine Auswanderung der Schwarzen Bevölkerung nach Afrika engagierte. Das »Wacht auf« (das Wort »woke« geht auf das englische Verb »wake« zurück) kommt der Aufforderung gleich, Hoffnungen auf ein glückliches Leben in den USA zu begraben und die Schlussfolgerung zu akzeptieren, ein menschenwürdiges Leben sei für Schwarze Menschen aus den USA nur auf dem afrikanischen Kontinent möglich.
Von zentraler Relevanz für die frühe Geschichte von »woke« ist neben Garveys Buch vor allem der Song »Scottsboro Boys« des Bluesmusikers Hudson William Ledbetter (auch bekannt unter dem Namen »Lead Belly«) aus dem Jahr 1938. Die »Scottsboro Boys« waren neun Schwarze Jugendliche namens Ozzie Powell, Willie Roberson, Eugene Williams, Olen Montgomery, Andy Wright, Roy Wright, Clarence Norris, Charlie Weems und Haywood Patterson. 1931 fuhren sie in Tennessee auf einem Güterzug zwischen Chattanooga und Memphis (viele arme Menschen nutzten damals illegal die Güterzüge in den USA, um zu reisen) und wurden dabei von einer Gruppe weißer Jugendlicher angegriffen, die der Meinung waren, der Zug sei nur für Weiße. Diese zogen in der darauffolgenden Auseinandersetzung allerdings den Kürzeren und wurden deswegen umgehend beim lokalen Sheriff vorstellig, wo sie behaupteten, von einer Gruppe Schwarzer Teenager angegriffen worden zu sein. Die Polizei stoppte den Zug und verhaftete die neun Jugendlichen. Ebenfalls festgenommen wurden Victoria Price und Ruby Bates, zwei junge weiße Frauen, die ebenfalls unentdeckt auf den Güterzug geklettert waren. Mit einer Anzeige wegen Landstreicherei und verbotener sexueller Aktivität konfrontiert, sagten sie bei der polizeilichen Vernehmung aus, Opfer einer Vergewaltigung durch die Schwarzen Jugendlichen geworden zu sein.2
Im daraufhin in Scottsboro geführten Prozess wurden acht der neun Schwarzen Jugendlichen nach kurzem Prozess von einer ausschließlich weißen Jury zum Tode verurteilt. Die NAACP und die Communist Party USA (CPUSA) prangerten den Prozess an und stellten ihn ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Es folgten jahrelange juristische Auseinandersetzungen, in denen mehrmals Gerichtsurteile durch den Obersten Gerichtshof aufgehoben und Grundsatzurteile gesprochen wurden, durch die sich die Stellung von Angeklagten gegenüber der Justiz signifikant verbesserte. Die acht zum Tode Verurteilten bekamen schließlich zwar die Todesstrafe erlassen, saßen zum Teil aber jahrzehntelang im Gefängnis; für einige von ihnen erfolgte die Begnadigung erst 2013 posthum.3
Anders als auf vielen Internetseiten behauptet, taucht das Wort »woke« nicht direkt im Text des Liedes auf, sondern in einem Radiointerview, das in der Albumversion auf Lead Bellys Song folgt. Dort sagt er unter anderem: »I advise everybody, be a little careful when they go along through there – best stay woke, keep their eyes open.«4 Der Begriff ist hier also als eine Mahnung an die afroamerikanische Bevölkerung gedacht, in den Südstaaten (und wohl auch allgemein in den USA) die Augen offen zu halten, um nicht wegen rassistisch motivierter Anklagen im Gefängnis zu verschwinden oder auf dem elektrischen Stuhl zu landen.
Als weitere Station der Begriffsgeschichte von »woke« nennt Isheena Robinson den Streik der Schwarzen Minenarbeiter 1940 in West Virginia, die gegen ihre im Vergleich zu weißen Arbeitern schlechtere Bezahlung protestierten.5Ihr zufolge hat im Kontext dieses Streiks einer der Schwarzen Gewerkschafter gesagt: »We were asleep. But we will stay woke from now on.« Doch der Ausspruch wird in ihrem Artikel leider ohne Quellenangabe zitiert und auf den zahlreichen Internetseiten über die bewegte Geschichte der Arbeitskämpfe der Minenarbeiter in Virginia ist über dieses Ereignis nichts zu finden.
Ein Artikel von J. Saunders Redding aus den 1940ern weist jedoch in Robinsons Richtung. Reddings war der erste Schwarze Professor an einer der Ivy-League-Universitäten der USA und schrieb zahlreiche Bücher über afroamerikanische Kultur, Literatur und Geschichte. In einem Artikel für The Atlantic mit dem Titel »A Negro Speaks for His People« widmet er sich dem wachsenden Selbstvertrauen der für ihre Rechte kämpfenden Schwarzen Bevölkerung im Süden der USA und geht dabei auf die mit zunehmender Schärfe geführten Gewerkschaftskämpfe ein.6 Allerdings betont er vor allem den wachsenden Zusammenhalt zwischen weißen und Schwarzen Arbeitern, die angesichts der drückenden Klassenfrage mehr und mehr ihre gemeinsamen Interessen erkennen würden. In diesem Zusammenhang zitiert er auch die Worte eines Schwarzen Gewerkschafters: »Let me tell you, buddy. Waking up is a damn sight harder than going to sleep, but we’ll stay woke up longer.«7 Ob die beiden Autor*innen sich hier auf den selben Gewerkschafter beziehen und nur die damit verbundene Geschichte unterschiedlich erzählen, lässt sich nicht rekonstruieren, da in beiden Fällen weder Name noch Kontext näher angegeben werden.
Mit dem Essay »If You’re Woke You Dig It« von William Melvin Kelley in der New York Times vom 20. Mai 1962 erscheint mehr als 20 Jahre später allerdings ein unbestrittener Meilenstein in der Begriffsgeschichte des Wortes »woke«.8 In seinem Essay beschreibt Kelley, wie er in der New Yorker U-Bahn sitzt und seine Augen auf ein Schild fallen, das die Passagiere in mehr als 20 Sprachen dazu auffordert, auf Sauberkeit zu achten. In einer als »Beatnik« bezeichneten Sprache (vielleicht ein Scherz des U-Bahnbetreibers, um auch junge Menschen zu erreichen) steht dort zu lesen: »Hey cats, this is your swinging-wheels, so dig it and keep it boss.« Die gegen Ende der 50er Jahre in den USA entstandene Beatnik-Kultur wandte sich gegen die vorherrschende konservative bürgerliche Lebensweise und fand ihren literarischen Ausdruck in den Werken überwiegend weißer Autoren wie Jack Kerouac, William S. Burroughs oder Allen Ginsberg (Schwarze Autor*innen wie Amiri Baraka gab es auch, als literarische Strömung war Beat jedoch von weißen Stimmen dominiert). Kelley zufolge ließ sich der Ursprung des Jargons der Beatnik-Kultur derart leicht auf das Idiom der Schwarzen Community New Yorks zurückführen, dass auch die Beatniks selbst jederzeit eingeräumt hätten, ihre Sprache sei nur geliehen. Im weiteren Verlauf seines Artikels zeichnet er die Bewegung der Sprache zwischen Schwarzer (Sub-)Kultur und (weißem) Mainstream nach, die sich auf der einen Seite durch eine ständige Adaption des Schwarzen Idioms durch die Mehrheitsgesellschaft auszeichnet, auf der anderen Seite durch die unentwegte Neuerfindung desselben innerhalb der Schwarzen Kultur.9
Diese Bedeutungsebene ist heute prägend für die Interpretation dieses frühen Textes. So sieht Brianna Perry in der von Kelley beschriebenen Dynamik zwischen Schwarzer Kultur und Mainstream vor allem eine Art Nötigung des Schwarzes Idioms, sich immer wieder neu zu erfinden, um den »Geiern der Kultur« und des weißen Mainstreams zu entgehen. Schwarze Menschen brächten das koloniale Englisch durch eine gegenkulturelle Aneignung in eine revolutionäre Form, und gleichzeitig bedürfe es lediglich eines weißen Menschen, um die semantische Kraft eines Wortes auszulöschen.10 Perry interpretiert Kelleys Essay also vor dem Hintergrund des Begriffs der kulturellen Aneignung, der Enteignung einer unterdrückten Kultur durch eine »Dominanzkultur«11, und plädiert darauf basierend dafür, Schwarzes Englisch solle Eigentum Schwarzer Menschen sein (auch wenn unklar bleibt, wen sie genau meint, da das Eigentum an ein nicht näher bezeichnetes »wir« gebunden wird, auch räumt sie die Aussichtslosigkeit dieses Anspruchs noch im Folgesatz ein). Das nur im Titel von Kelleys Essay vorkommende »woke« interpretiert sie vor diesem Hintergrund als eine Mahnung an Schwarze Menschen, sich ein kritisches Bewusstsein zu bewahren und sensibel für die politische Dimension »Schwarzer Sprache« zu sein.12
In den 60er Jahren und Anfang der 70er taucht der Begriff »woke« auch noch an anderen Stellen auf. Martin Luther King ermahnte 1965 die Studierenden des Oberlin College in einer Rede mit dem Titel »Remaining Awake Through a Revolution«, nichts sei tragischer, als eine Revolution zu verschlafen, und die große Herausforderung der Zeit bestehe darin, angesichts der sozialen Umwälzungen wach zu bleiben.13 1970 veröffentlichte die heute als Pioniere des Hip-Hop gefeierte Band »The Last Poets« den Song »Wake Up N*****« und 1972 ließ der Dramatiker Barry Earl Beckham in seinem Stück »Garvey Lives!« eine seiner Figuren sagen: »I been sleeping all my life. And now that Mr. Garvey done woke me up, I’m gon’ stay woke.«14 Anschließend wird es den verfügbaren Chroniken zufolge erst einmal still um den Begriff.
Erst 2008 kehrt er mit dem Song »Master Teacher« der US-amerikanischen Soul-Sängerin Erykah Badu zurück. Der Text des Liedes handelt von der Suche nach sich selbst und einer besseren Welt und betont die Notwendigkeit, falschen Versprechungen weltlicher Autoritäten und anderer Menschen gegenüber »wach« zu bleiben. Kommt der Begriff in den zuvor genannten Quellen eher am Rande oder nur indirekt vor, stellt Badu ihn ins Zentrum, lässt den Text um ihn kreisen und wiederholt ihn insgesamt 45 Mal während des knapp siebenminütigen Songs. Das Lied katapultierte den Begriff in die öffentliche Diskussion und verwandelte ihn von einem Bestandteil des Schwarzen Idioms in den USA in eine allgemein gebrauchte Bezeichnung für die Sensibilität gegenüber Unterdrückungsverhältnissen. Die Sängerin hat in Interviews deutlich gemacht, ihn selbst in genau diesem Sinn zu verstehen.15 Allerdings wurde »woke« auch damals schon gebraucht, um die Onlineaktivitäten wohlmeinender Weißer zu bezeichnen, die sich mit ihrer Kritik an Unterdrückungsverhältnissen in den sozialen Medien einen Namen machten, während zahlreiche Schwarze Aktivist*innen mit Blick auf dieses Treiben kritisierten, vielen gehe es dabei offensichtlich mehr um die Zahl ihrer Follower als um eine Veränderung systemischer Machtstrukturen.16
Doch seine kritische Stoßrichtung behielt der Begriff zunächst bei. Als 2014 in Ferguson der afroamerikanische Schüler Michael Brown von dem Polizisten Darren Wilson erschossen wurde und eine Grand Jury beschloss, kein Verfahren gegen den Täter zu eröffnen, kam es zu massiven Protesten, im Zuge derer die ein Jahr zuvor gegründete Bewegung »Black Lives Matter« und mit ihr der von Badu geprägte Slogan »Stay Woke« plötzlich im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit standen.17 2017 wurde der Begriff schließlich ins Oxford Dictionary aufgenommen, das ihn als Aufmerksamkeit gegenüber rassistischer und sozialer Diskriminierung und Ungerechtigkeit definiert, und auf diesem Wege als eigenständiges Wort in den institutionell definierten Bestand der englischen Sprache integriert.
Eine positive Entwicklung, möchte man meinen: Ein machtkritischer Begriff aus einer hochpolitisierten Subkultur erobert Stück für Stück das Terrain der Öffentlichkeit und dringt in das Bewusstsein der Mehrheitsbevölkerung vor, die, nun sensibilisiert, zuvor als Selbstverständlichkeit hingenommene Zustände und auch sich selbst in Frage stellt, wodurch verkrustete Verhältnisse ins Rutschen geraten und diskriminierte Minderheiten mehr Luft zum Atmen bekommen. Doch diese Interpretation der Begriffsgeschichte ist offensichtlich naiv. Während dieser Text entsteht, hat Donald Trump das zweite Mal und deutlicher noch als 2016 die Präsidentschaftswahl der USA gewonnen, wird Italien von einer neofaschistischen Koalition regiert, herrschen in Ungarn nach wie vor rechtskonservative Kräfte, sitzt Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei fest im Sattel, verleibt Wladimir Putin sich Teile der Ukraine ein, rufen Menschen auf den Straßen Europas und der USA nach der Abschaffung des israelischen Staates, steigt die Zahl antisemitischer Straftaten landesweit wie lange nicht mehr und setzt sich im Westen mehr und mehr (wie Achille Mbembe es trefflich formuliert hat) eine »Politik der Feindschaft«18 durch, in deren Namen die Bundeswehr »kriegstüchtig« gemacht wird, um der neuen Bedrohung aus dem Osten zu trotzen, während die Mauern Europas immer höher gezogen werden, damit schließlich noch das letzte Boot mit Geflüchteten an ihnen zerschellt. All dies wird nicht selten auch als finaler Sieg über die angeblich im Begriff »woke« zusammengefassten politischen Gedanken und Forderungen gefeiert, wie sich mit besonderer Deutlichkeit in den USA zeigt, wo etwa Donald Trump Jr. wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl auf X postete: »Woke is dead don’t let it rear its ugly head ever again. It’s over!!«19 (Woke ist tot! Lasst es nie wieder sein hässliches Haupt erheben. Es ist vorbei!!)
Einschlägige Diskriminierungsstudien wie etwa die Leipziger Autoritarismusstudie geben keineswegs Anlass zu der Annahme, der Siegeszug des Begriffs »woke« auch in Deutschland hätte das öffentliche Bewusstsein signifikant verschoben. So lässt sich zwar seit Jahren ein kontinuierlicher Rückgang in der Verbreitung eines geschlossenen rechten Weltbildes verzeichnen, gleichzeitig aber befindet sich die Zustimmung zur Demokratie in Deutschland mit nicht einmal 42 Prozent auf einem Rekordtief, Islamophobie und Antiziganismus erreichen Zustimmungswerte von teilweise um die 50 Prozent und die Ablehnung zentraler Aussagen des Feminismus bleibt mit bis zu 35 Prozent auf hohem Niveau.20
Die Bedeutung des Begriffs »woke« hat sich in diesem Kontext in einen von konservativen und rechten Kreisen verwendeten Kampfbegriff verwandelt und dient heute nach seiner kulturellen Aneignung durch die politische Gegenseite vor allem der Disqualifizierung emanzipatorischer Forderungen aus der identitätspolitischen Bewegung. In der deutschen Diskussion wird das Konzept der kulturellen Aneignung oft missverstanden, weil der Begriff auf eine schlechte Übersetzung zurückgeht, in der das englische »appropriation« mit »Aneignung« gleichgesetzt wird. Während das deutsche »Aneignung« ein ethisch-moralisch betrachtet weitgehend neutraler Begriff ist, trifft dies auf das englische »appropriation« nicht zu, da es sowohl auf den Akt der Aneignung als auch auf die mangelnde Zustimmung der enteigneten Partei verweist. Diese Form des kulturellen Diebstahls äußert sich auch in der Rekodierung von Begriffen, die zentral für die Repräsentation einer politischen Partei oder Gruppierung sind, um ihnen das identitätsstiftende Vokabular zu nehmen und den Anspruch auf Hegemonie streitig zu machen.21 Als Reaktion auf die »Black Lives Matter«-Bewegung entstandene Sprüche wie »All Lives Matter« oder auch »Blue Lives Matter« (womit die blauen Uniformen der Polizei gemeint sind) können hier als weitere Beispiele dienen.
»Woke« hat so das gleiche Schicksal ereilt wie viele andere Begriffe, die dem Schwarzen Idiom der USA entstammen und in den Mündern weißer Hipster verschliffen wurden, bis nichts mehr von ihnen übrig blieb als die hohle Phrase eines selbstverliebten Lifestyles. Doch hier ist noch mehr passiert. Der Begriff hat nicht nur Eingang in die weiße Mehrheitskultur des globalen Nordens gefunden, sondern wurde von den Gegner*innen identitätspolitischer Bestrebungen okkupiert, semantisch verkehrt und in ein Mittel der Denunziation emanzipatorischer Anliegen verwandelt. Bislang ist jeder Versuch gescheitert, ihn zurückzuerobern und wieder zu einem Werkzeug progressiver Politik zu machen.22Wie aber war das möglich, und warum hat insbesondere die identitätspolitische Bewegung als durchaus wirkmächtige Fraktion der politischen Linken dieser Dynamik nichts entgegenzusetzen?
Wirft man einen genaueren Blick in die genannten Texte zur Geschichte des Begriffs »woke«, fällt auf, dass diese neben dem Fokus auf rassistische Diskriminierung noch eine weitere Bedeutungsebene besitzen, die heute deutlich weniger im Fokus steht. So enthält Kelleys Artikel »If You’re Woke You Dig It« aus der New York Times z. B. zahlreiche Passagen, die in eine gänzlich andere Richtung weisen als die von Perry ins Zentrum gerückte Enteignung des in New York gesprochenen Schwarzen Idioms. Zwar konstatiert auch Kelley, dieses sei früher benutzt worden, um der Kontrolle durch weiße Menschen zu entgehen, hält eine solche Strategie mit Blick auf das New York der 60er aber für nicht mehr zeitgemäß. Als Beispiel verweist er auf die gewählte Ausdrucksweise Schwarzer Jazzmusiker, deren Ziel darin bestehe, vom Mittelstand akzeptiert zu werden, und denen die Schlampigkeit der Beatniks allenfalls Geringschätzung entlocke. Ganz allgemein würden Schwarze Menschen in den USA alles vermeiden, was den Weißen Gelegenheit gäbe, sie weiterhin an den Rand der Gesellschaft zu drängen, schließlich bestehe ihr Ziel darin, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu werden, in einer guten Nachbarschaft zu leben, ein schönes Auto zu fahren und ihre Kinder in eine anständige Schule zu schicken. Wenn, so fährt er fort, das Schwarze Idiom nach wie vor von Schwarzen Menschen in den USA gesprochen werde, so aus drei Gründen: weil sie stolz auf die Urheberschaft dieser Variante des Englischen seien, weil sie durch das Sprechen eine Form von Nähe zu anderen Schwarzen Menschen herstellen könnten, und weil dies oft die einzige Form des Englischen sei, die sie in ihrer Nachbarschaft kennenlernten.23
Bei gründlicher Lektüre von Kelleys Text wird deutlich, wie viel Perry davon ignorieren musste, um ihn ausschließlich als Kritik der kulturellen Aneignung des Schwarzen Idioms darzustellen. Wie auch immer man Kelleys pauschale Äußerungen über die Haltung und die Wünsche der Schwarzen Bevölkerung New Yorks bewerten mag, fällt bei der Lektüre unweigerlich die enge Verbindung von race und Klasse ins Auge, die ihm zufolge ebenso für die Abgrenzung Schwarzer Jazzmusiker von den weißen Beatniks verantwortlich ist wie für die seiner Meinung nach auf einen Mangel an Bildung und Integration zurückzuführende, im Grunde atavistische Weiterführung des Schwarzen Idioms. Bereits in diesem früheren Text werden race und Klasse also in einen intersektionalen Zusammenhang gestellt. Dieselbe Verbindung findet sich auch bei Martin Luther King in seiner 1965 nach dem Marsch von Selma nach Montgomery gehaltenen Rede »Our God is Marching On!«24 King stellt fest, die rassistische Segregation sei nicht das simple Resultat von Hass zwischen weißen und Schwarzen Menschen. Vielmehr erkennt er in der Einführung der Segregation eine politische Strategie der Bourbon-Demokraten, die unter den Bedingungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts den billigen Zugang zu Arbeitskräften im Süden durch eine Spaltung der Schwarzen und weißen Arbeiter erhalten wollten. So war es King zufolge möglich, den Widerstand weißer Plantagenarbeiter zu brechen, die sich über zu niedrige Löhne beschwerten, indem man ihnen drohte, sie durch noch billigere Schwarze Arbeitskräfte zu ersetzen. Dem »Erwachen« der weißen und Schwarzen Arbeiter sei so ein Riegel vorgeschoben worden, denn von nun an konnten die weißen Arbeiter sich, so schlecht es ihnen auch ging, damit trösten, immerhin Weiße und damit etwas Besseres zu sein. Genau diese Trennung zu überwinden, sei das Ziel, fährt King fort, denn erst dann könne eine Gesellschaft entstehen, in der wir unabhängig von race einfach als Menschen leben könnten.25
Auf die Verflechtung von race und Klasse verweist auch Stephen L. Carter in seinem 2022 erschienenen Artikel »›Woke‹ Is a Political Term With a Long and Complicated History«. In seinen Augen ist die üblicherweise beschriebene historische Entwicklung des Begriffs irreführend. Marcus Garvey habe den Begriff »woke« von ihm vorhergehenden Protagonisten der Schwarzen Bewegung übernommen, die sich für das Wahlrecht und eine Ausweitung des politischen Aktivismus einsetzten. Und der immer wieder angeführte Song von Lead Belly (in dessen Outro bzw. »Nachwort« der Begriff genannt wird) stelle wahrscheinlich eine Übernahme des circa zehn Jahre zuvor erschienenen Liedes »Sawmill Moan« des Bluessängers Willard »Ramblin« Thomas dar, in dem es unter anderem geheißen habe: »If I don’t go crazy, I’m sure gonna lose my mind ’cause I can’t sleep for dreamin’, sure can’t stay woke for cryin.« Auf den ersten Blick erscheine dieses Lied als Klage über eine verlorene Liebe, Historiker sähen darin aber einen versteckten Protest gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Sägewerken der Südstaaten. Für diese Annahme spreche weiterhin, fährt Carter fort, dass die Metapher des Aufwachens schon lange ein fester Bestandteil der Rhetorik der Arbeiterbewegung gewesen sei. Schwarze Aktivist*innen hätten ihn zwar übernommen, doch würde er bis heute weiter für die Mobilisierung in Arbeitskämpfen benutzt.26