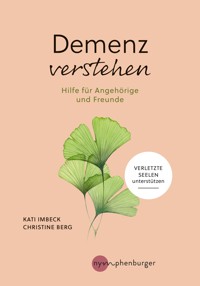
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Diagnose Demenz: Eine einschneidende Veränderung, nicht nur für die Betroffenen, auch für ihre Freunde, Partner und Angehörigen. Dieses Buch bietet viele Anregungen für mehr Gelassenheit im Umgang mit Menschen mit Demenz und trägt mit Fragebögen und Übungen sowie zahlreichen Erfahrungsberichten zu gelingender Kommunikation bei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kati Imbeck/Christine Berg
Demenz verstehen
Hilfe für Angehörige und Freunde
Vorwort
Hoffnung ist eben nicht Optimismus, ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat – ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.
(Václav Havel, tschechischer Schriftsteller und Politiker)
Demenz ist mehr als vergesslich sein oder die richtigen Wörter nicht auf Anhieb zu finden. Während wir von Kindheit an zu Vernunftmenschen erzogen werden und darum ringen, die Kontrolle über unsere körperlichen und geistigen Vorgänge zu erlangen, geht eben diese Führung bei einer demenziellen Veränderung nach und nach verloren. Eine Vorstellung, die die meisten Menschen als eine existenzielle Bedrohung empfinden. Und so ist das Voranschreiten der Demenz für die Betroffenen und alle begleitenden Personen, ob Lebenspartner, Angehörige, Freunde oder Nachbarn und Kollegen, in der Regel ausgesprochen verstörend.
Es ist aber auch möglich, dass dieser Prozess etwas Befreiendes mit sich bringt. Eigenschaften und Eigenarten können verstärkt auftreten oder sich ins Gegenteil verkehren. Mitunter zeigen sich Verhaltensweisen, die sich dieser Mensch nie erlaubt oder zugestanden hat. Manche bisher sehr kontrolliert und bestimmend auftretende Personen werden möglicherweise weich und nachsichtig, nachgiebige Menschen zeigen eine gewisse Autorität und Deutlichkeit. Verdrängte und lange vergessene Begebenheiten und Erlebnisse tauchen vielleicht wieder auf und werden intensiv aufs Neue durchlebt.
Zugleich kann eine Demenz auch Perspektiven eröffnen. Der Mensch ist ein lebenslanges Entwicklungswesen – das gilt auch für Menschen mit Demenz. Diese können im Verlauf der demenziellen Veränderung bisher ungeahnte Erkenntnisse oder Fähigkeiten erlangen sowie Vorlieben an den Tag legen – sei es, in einer Gruppe Theater spielen, ein zuvor nie probiertes Gericht als neues Lieblingsessen entdecken oder Beziehungen knüpfen und neue Freundschaften schließen. Wie auch immer sich die Demenz bei Ihrem Partner, Angehörigen oder Freund äußert – der Betroffene begibt sich auf eine Reise ins Ungewisse. Wir möchten Sie ermuntern, ihn dabei aufmerksam, neugierig und liebevoll zu begleiten und einen Rahmen zu schaffen, der ihm diesen Weg erleichtert.
Uns ist bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Sicherlich werden Ihnen zahlreiche Fragen, Herausforderungen und Hürden begegnen. Mit diesem Ratgeber möchten wir Sie dabei unterstützen, Antworten und Hilfe bei der Bewältigung zu finden. Wir möchten Sie aber auch ermuntern, stets auf Ihre persönliche Wahrnehmung und Ihr Urteilsvermögen zu vertrauen. Denn in vielen Fällen gibt es bei der Begleitung von Menschen mit Demenz kein Patentrezept. Vielmehr hat es den größten Wert für den Betroffenen, individuell auf ihn einzugehen, in seine Welt einzutauchen und für ihn da zu sein.
Lassen Sie sich bitte auch nicht zu sehr davon beeindrucken, was in Ihrer Umwelt als normal oder davon abweichend gilt. Demenz ist längst ein weit verbreitetes gesellschaftliches Phänomen. Und wenn sich ein Betroffener manchmal eigentümlich verhält, ist das noch lange kein Grund, sich dafür zu schämen und sich in den eigenen vier Wänden zu verstecken. Seien Sie selbstbewusst und ermutigen Sie Ihren Angehörigen, offen mit der demenziellen Veränderung umzugehen.
In dieses Werk eingeflossen sind unsere persönlichen und beruflichen Erfahrungen als Angehörige und professionelle Begleiterinnen von Menschen mit Demenz. Wenn unser eigener Erfahrungsschatz zu einem Aspekt nicht ausreichte oder wir schon so sehr in einem Thema drinsteckten, dass ein unvoreingenommener Blick vonnöten war, haben wir Rat bei hilfreichen Geistern in Familie und Umfeld gesucht – und gefunden. Allen Unterstützern möchten wir an dieser Stelle herzlich für die inspirierenden Gespräche und ehrlichen Rückmeldungen danken.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet, grundsätzlich sind alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung gemeint. Die verkürzte Form beinhaltet keine Wertung.
KAPITEL 1
Leben mit Demenz: ein Überblick
Vergesslichkeit oder Demenz?
Den Haustürschlüssel verlegt, einen Namen vergessen oder sich im Tag geirrt – das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Vor allem mit zunehmendem Alter ist es vollkommen normal, dass nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Leistungsfähigkeit allmählich nachlässt. Doch wo hört die altersbedingte Schusseligkeit auf und welche Anzeichen deuten auf eine beginnende Demenz hin?
Den Unterschied zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Denn für gewöhnlich macht sich eine Demenz nicht plötzlich bemerkbar, sondern ist ein schleichender Prozess. Im Gegensatz zur altersbedingten Vergesslichkeit lässt bei Demenz allerdings in der Regel nicht nur die Gedächtnisleistung nach, sondern es schwinden nach und nach auch andere Funktionen des Gehirns, die auch als kognitive Fähigkeiten bezeichnet werden. So haben Menschen mit Demenz unter anderem häufig Sprach- und Verständnisschwierigkeiten, können neue Informationen nicht mehr so gut verarbeiten und haben Probleme, über einen längeren Zeitraum aufmerksam zu sein.
MENSCHEN MIT DEMENZ IN DEUTSCHLAND
In Deutschland leben rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, heißt es in einer Information des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ, Stand: 2022). Die meisten Betroffenen sind über 65 Jahre alt. Bedingt durch den demografischen Wandel ist davon auszugehen, dass die Zahl in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen wird. Prognosen zufolge wird die Zahl der Menschen mit Demenz bis zum Jahr 2050 voraussichtlich auf 2,8 Millionen steigen– vorausgesetzt, es gibt in der Zwischenzeit keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse in Sachen Therapie und Prävention.
Oft gehen mit einer Demenz verschiedene Formen der Desorientierung einher, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Ist eine Person zeitlich desorientiert, kennt sie zum Beispiel die Uhrzeit, das Datum, den Wochentag oder die Jahreszeit nicht. Auch fällt es ihr schwer, Zeitspannen abzuschätzen, sodass wenige Minuten mitunter wie eine Ewigkeit erscheinen. Bei der örtlichen Desorientierung ist die Fähigkeit eingeschränkt, sich an bekannten oder neuen Orten zurechtzufinden. Die Betrof fenen verlaufen sich oder erkennen das Haus nicht mehr, in dem sie leben. Wer situativ desorientiert ist, hat Probleme, das Geschehen um sich herum richtig einzuordnen. So kann es vorkommen, dass eine Person beim Arzt im Wartezimmer sitzt, sich aber am Bahnhof wähnt und verzweifelt nach ihrer Fahrkarte sucht. Eine weitere Form ist die personelle Desorientierung. Diese macht sich beispielsweise bemerkbar, wenn Menschen mit Demenz sich nicht mehr an ihre eigenen persönlichen Daten wie den Namen, das Geburtsdatum, den Beruf oder Familienstand erinnern. Auch die Fähigkeit, bekannte Menschen zu erkennen, ist häufig eingeschränkt.
15 Beispiele für typische Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz:
Kein Gefühl für die Zeit haben, das Datum und Jahr nicht kennen
Immer wieder dieselbe Frage stellen und die Antwort vergessen oder innerhalb kurzer Zeit mehrmals dasselbe erzählen
Viel von der Vergangenheit sprechen und Ereignisse, die kürzlich passiert sind, vergessen
Gegenstände an unpassende Orte legen, etwa die Geldbörse in den Kühlschrank
Nicht mehr mit Geld umgehen können, zum Beispiel mehrmals am Tag in der Bank Geld abheben
Stockend, in kurzen, knappen Sätzen sprechen, Sätze nicht beenden oder einen einfacheren Wortschatz benutzen
Die Bedeutung von Gegenständen verwechseln und Dinge tun, wie im Supermarkt mit Knöpfen bezahlen
Kleidung falsch herum, mehrfach oder in der falschen Reihenfolge anziehen, sich für die falsche Jahreszeit kleiden, also beispielsweise Sandalen im Winter anziehen oder Ähnliches
Handlungen auslassen oder nicht zu Ende führen, beispielsweise Kartoffeln ohne Wasser aufsetzen oder auf dem Herd vergessen
Sich verlaufen, vor allem an unvertrauten Orten und in fremden Umgebungen
Ein falsches Alter angeben oder vergessen, dass sie verheiratet sind und Kinder haben
Bekannte Personen oder Orte nicht mehr erkennen
Sich zurückziehen, Hobbys und soziale Aktivitäten einstellen und zu Hause mehr Zeit als sonst stillsitzen, liegen, Fernsehen schauen oder Ähnliches
Schneller als sonst ermüden, sich nicht mehr längere Zeit auf eine Sache oder ein Gespräch konzentrieren können
Stimmungsschwankungen, Niedergeschlagenheit, ungewohnt ruheloses, aggressives oder auch misstrauisches Verhalten
Fritz und Irma
Als Fritz 69 Jahre alt ist, beginnt er, sich eigentümlich zu verhalten. Der vormals gesellige und wortgewandte Lehrer für Deutsch und Latein zieht sich mehr und mehr von seiner 63-jährigen Frau Irma und den gemeinsamen Freunden zurück. Wenn sie Gäste haben, verlässt er oft ohne Erklärung den Raum. Irma lässt ihn gewähren und findet ihn später in seinem Lieblingssessel im Arbeitszimmer. Dort sitzt er immer häufiger stundenlang und blickt mit unglücklichem Gesichtsausdruck ins Leere. Auch die Lust am Lesen, früher eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, hat er verloren.
Demenz ist keine Krankheit
Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied, den Sie kennen sollten: Eine Demenz ist keine Krankheit, sondern ein Syndrom. Dieses wird charakterisiert durch ein Bündel von Symptomen, zum Beispiel den Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, Desorientierung oder einer eingeschränkten Auffassungsgabe. Schuld daran können verschiedene Ursachen sein. Alzheimer ist der häufigste, aber nicht der einzige Grund. Ein einfaches Gedankenspiel verdeutlicht die Systematik: Stellen Sie sich vor, das Demenzsyndrom ist das Getreide – dann ist Alzheimer Weizen, andere Ursachen (zu denen wir auf den nächsten Seiten noch kommen) sind Roggen oder Dinkel.
Das Bewusstsein ist (anders als beispielsweise beim akuten Verwirrtheitszustand Delir) für gewöhnlich nicht getrübt. Mit der geistigen Beeinträchtigung gehen in der Regel Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation einher.
DEMENZ-DEFINITION NACH ICD-10
Der internationalen Klassifikation von Erkrankungen (ICD-10, International Classification of Diseases) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge ist Demenz ein Syndrom, dem eine Krankheit des Gehirns zugrunde liegt. Bei den Betroffenen sind viele sogenannte kortikale (in der Gehirnrinde verortete) Funktionen gestört. Diese schließen ein:
GedächtnisDenkvermögenOrientierungssinnAuffassungsgabeRechenfähigkeitLernfähigkeitSprache UrteilsvermögenUnterschiedliche Formen der demenziellen Veränderung
In der internationalen Klassifikation von Erkrankungen (ICD-10, International Classification of Diseases) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mehr als 20 Krankheiten gelistet, die einer Demenz zugrunde liegen können. Zahlen zur Häufigkeit der verschiedenen Demenzformen variieren in der Literatur zum Teil stark.
Nach Angaben der Alzheimer Gesellschaft, die sich auf eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2007 beziehen, ist in 30 Prozent der Fälle Alzheimer die Ursache. Zehn Prozent der Betroffenen haben demnach Gefäßkrankheiten, bei denen es unter anderem zu Durchblutungsstörungen im Gehirn kommt. Bei 34 Prozent ist den Angaben zufolge von einer Mischform aus Alzheimer und Gefäßkrankheiten auszugehen. Alle übrigen Ursachen zusammen machen demnach einen Anteil von 26 Prozent aus.
Wir fokussieren uns auf die beiden häufigsten irreversiblen Demenzformen: Alzheimer und gefäßbedingte (vaskuläre) Demenz. Irreversibel bedeutet, dass sie unumkehrbar sind. Die Fähigkeiten der Betroffenen nehmen immer weiter ab und können in der Regel nicht wiedererlangt werden. Ausgewählte weitere und zumeist seltenere Demenzformen stellen wir in einem kurzen Überblick vor.
Alzheimer
Bei der Alzheimer-Krankheit kommt es zu einem Verlust von Nervenzellen im Gehirn sowie der Kontaktstellen (Synapsen), über die sie miteinander verbunden sind. Betroffen davon sind in den meisten Fällen der Schläfenlappen und der Scheitellappen – also die Bereiche des Gehirns, die wir für ein funktionierendes Gedächtnis sowie unsere Sprach- und Orientierungsfähigkeit brauchen. Der Beginn ist in der Regel schleichend, das heißt, es fängt an mit einer leichten Beeinträchtigung, in den meisten Fällen des Kurzzeitgedächtnisses.
Nach und nach, mitunter erst Jahre später, machen sich im alltäglichen Leben immer mehr Beeinträchtigungen bemerkbar. Neben dem Gedächtnisverlust haben Betroffene oft Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Neue Informationen zu verarbeiten, fällt ihnen schwer, ebenso wie Dinge planen und Probleme lösen. Sie finden sich nicht mehr so gut in ihrer Umgebung zurecht und das Zeitgefühl schwindet. Mögliche Begleiterscheinungen sind zudem unter anderem Unruhe, Antriebslosigkeit, Depressionen oder Aggressivität.
Der Verlauf ist bei allen Menschen unterschiedlich, wird aber durch einen stetigen Abbau der geistigen Fähigkeiten charakterisiert. Irgendwann sind die Einschränkungen so gravierend, dass ein eigenständiges Leben ohne Unterstützung nicht mehr möglich ist.
ALOIS ALZHEIMER
Der Psychiater und Hirnpathologe Alois Alzheimer wies 1906 erstmals die für Alzheimer typischen Veränderungen im Gehirn nach. Er dokumentierte den Fall der Patientin Auguste Deter, die im Alter von 51 Jahren von ihrem Mann in die „Städtische Anstalt für Irre und Epileptische“ in Frankfurt eingeliefert wurde.
Diese litt an „geistigem Verfall“, der sich unter anderem durch Gedächtnisstörungen und Verfolgungswahn äußerte. Als er nach ihrem Tod ihr Gehirn sezierte, entdeckte er unter anderem die charakteristischen Eiweißablagerungen (Amyloid-Plaques und neurofibrilläre Bündel), die noch heute eine Rolle in der Demenzforschung spielen. 1910 fand die vormals als „Greisenblödsinn“ bekannte „Alzheimersche Krankheit“ erstmals Erwähnung im „Lehrbuch für Studierende und Ärzte“.





























