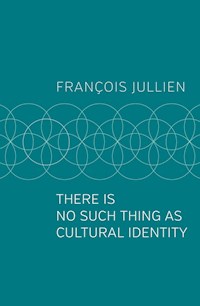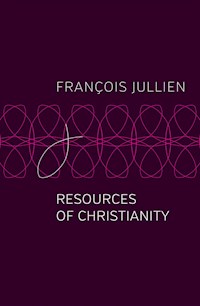Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was heißt es, einen Gedanken zu fassen, einen Gedanken zudem, der einem entfernten Denken entstammt? François Jullien erkundet die Wege ins Innere der chinesischen Geisteswelt und stellt die Frage nach der Möglichkeit, Zutritt zu ihr zu erlangen. Ihre Begriffe nachzuzeichnen, ihre Geschichte zu rekonstruieren genügt dafür nicht. Erst wenn wir unser Denken wirklich hinter uns lassen, können wir uns auf alternative Wege des Geistes begeben. Anhand der konzentrierten Lektüre des ersten Satzes der chinesischen Spruchsammlung »Yi-Jing« veranschaulicht Jullien, was es heißt, verschiedene Wege des Denkens zu beschreiten – einen Text von innen her zu lesen und sich ihm von außen, von der Bibel und griechischer Philosophie her zu nähern. Im Laufe der Lektüre richtet sich zwischen beiden Interpretationszugängen eine Schwelle auf, eine Schwelle jedoch, die uns einlädt, sie zu überschreiten und einzutreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Denkzugänge
Mögliche Wege des Geistes
François Jullien
DenkzugängeMögliche Wege des Geistes
Aus dem Französischen von Till Bardoux
Inhalt
Hinweis an den Leser
I Was heißt es, sich (auf ein Denken) einzulassen?
II Das Anderswo Chinas
III Überholtes oder nebenherlaufendes Denken?
IV Der erste Satz
V Ein erster Satz auf Chinesisch
VI Kommentar
VII Hebräischer Zugang
VIII Hellenischer Zugang
IX Unsere Alternativen auflösen
X Wo fängt der Anfang an?
XI Weder Gott noch Mythos: welcher andere mögliche Weg?
XII Nicht dass, wenn der Mythos nicht interessiert, Gott allen Raum einnähme …
XIII Griechisches Werkzeug / Chinesische Formel
XIV Übersetzung
XV Gibt es noch »Tradition«?
Finale: Über eine Mutation der Wahrheit
Hinweis zu den Quellenangaben
Anmerkungen
Seltsam, doch alles in allem logisch, dass ich erst jetzt zu der Frage komme, mit der ich in der Werkstatt meines Schaffens hätte beginnen müssen. Seltsam, dass ich, nachdem ich jahrelang zwischen den Denkweisen Chinas und Europas hin- und hergereist bin, erst heute bei dieser – grundlegenden – Frage Halt mache, die mich zwar immer beunruhigt hat, die ich aber noch nie, zumindest nie direkt, in Angriff genommen habe: Was heißt es, sich Zugänge zu einem Denken zu erschließen? Doch zugleich sage ich, dass es auch logisch ist, dass ich mich ihrer, obwohl es sich um die Ausgangsfrage handelt, mit solcher Verspätung annehme, da man bekanntlich die Frage nach dem Anfang erst im Nachhinein und rückblickend angehen kann. Beim Schreibprozess verhält es sich ganz genau so: Verfasst man die Einleitung zu einem Buch nicht dann, wenn es beendet ist?
Wer würde heute im Okzident nicht den Wunsch hegen, sich Zugänge zum Denken des fernsten »Orients« zu erschließen? Doch wie soll man Zugang zu ihm finden? Man weiß nur zu gut, dass sich kein Denken, wie immer man es auch angehen mag, einfach so zusammenfassen lässt, und das chinesische, so vielfältig und immens, schon gar nicht. Nur zu gut weiß man auch, dass die Hauptbegriffe eines Denkens nicht direkt übersetzbar sind; dass auch seine Betrachtung nach Schulen, durch Klassifizierung und Katalogisierung, das Wesentliche nicht festzuhalten vermag, und dass ein Verfolgen seiner historischen Entwicklung, von einem Ende zum anderen, ebenfalls nicht genügt. Jedes Mal wird man außerhalb der internen, selbstbezüglichen Rechtfertigung bleiben, die sich dieses Denken gibt. Denn von wo aus hat es begonnen? Wenn ich nun diese Frage stelle – wie kann man sich Zugänge zum chinesischen Denken erschließen? –, wende ich mich zudem an Nicht-Sinologen, als könnten diese selbst Chinesisch lesen. Dazu werde ich mich an der methodischen Lektüre eines chinesischen Satzes versuchen, eines einzigen, eines ersten Satzes, indem ich schrittweise die Elemente herausarbeite, die es erlauben, ihn zugleich von innen (vom chinesischen Denken her) und von außen (vom Westen her) zu lesen. Denn wirksame »Zugänge« kann man sich zu einem Denken nur erschließen, indem man damit beginnt, mit ihm zu arbeiten, das heißt, indem man sich an ihm entlang selbst befragt.
Der Satz, dessen Lektüre ich hier beginnen möchte, ist der erste, der sich im chinesischen Denken selbst mit dem Anfang befasst. Ich schlage vor, ihn sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne zu lesen: in seiner Buchstäblichkeit (doch was heißt »Buchstäblichkeit«, wenn es weder Buchstaben noch Grammatik gibt?) und auch mit Abstand, indem man die Distanz vergrößert und die Kontraste zur Geltung bringt. Auf diese Weise aus der Ferne zu lesen, indem man zurücktritt, heißt aber nicht, grob und oberflächlich zu lesen. Im Gegenteil, es heißt zu versuchen, beim Lesen noch näher heranzugehen und über diesen Umweg die vorgefassten Meinungen und Grundannahmen auszuloten, die sich dort eingegraben und abgelagert haben. Um diesen Satz hervorzuheben und ihn, da man sich sonst keinen Zugang zu ihm erschließen würde, aus der Behaglichkeit seiner »Evidenz« heraustreten zu lassen, werde ich ihn deshalb sowohl vom Anfang der Genesis, also von biblischer Seite her lesen, als auch ausgehend vom Beginn der griechischen Theogonie und aus mythologischer Perspektive. Was mich, indem ich diesen Sichtweisen einer nach der anderen folge, zwangsläufig zu der Frage führen wird, die uns vom lokalen Charakter jener praktischen Arbeiten umgehend zum anderen Extrem tragen wird, da ich mir keine allgemeingültigere Frage als diese vorstellen kann: Wie steht es um die »möglichen Wege« des Denkens?
Denn muss man sich nicht nunmehr folgende Arbeit vornehmen: eine »Phänomenologie des Geistes« zu schreiben, die nicht mehr europäisch wäre?
Hier stößt die Philosophie an ihre Grenze. Liegt hier etwa ihr blinder Fleck? Jedenfalls scheitert sie, die behauptet, über alles – »das Ganze« – zu reflektieren, hier an der Reflexion ihrer selbst.
Zweifeln, heißt es immer wieder, wachsam zweifeln sei der Zugang zur Philosophie. Aber weiß man, woran man zu zweifeln hat? So methodisch oder hyperbolisch man den »Zweifel« auch auffassen mag, setzt er doch immer irgendeine vorhergehende, vorgelagerte Setzung voraus, von der aus man zweifelt, an der selbst aber gerade deshalb niemand zweifelt – an der zu zweifeln niemandem in den Sinn kommt: Auf sie hat man keinen Zugriff. Das, woran man zweifelt, hält uns anders gesagt bereits in seinem Bann, im Netz seines Ungedachten. Man mag also zweifeln so viel man will, so wie es Descartes auf heroische Weise tut, man zweifelt doch immer noch in seiner Sprache und in seinen Begriffen. Zweifeln lässt uns noch immer bei uns selbst bleiben. Über das, woran ich nicht zweifeln kann, das heißt, woran zu zweifeln mir nicht in den Sinn kommt, kann ich mir nur bei der Begegnung mit einem anderen Denken bewusst werden: indem ich mich selbst verunsichern lasse und mich von allem – ungeahnten – Verhaftetsein meines Denkens lossage. Soll damit gesagt sein, dass Descartes, der doch eifrig Europa bereiste, nicht genug auf Reisen war? Man kann tatsächlich das Willkürliche des eigenen Denkens nur aus der Deckung jagen, indem man es verlässt; und sich zu diesem Zweck auf ein anderes Denken einlässt. Aber was kann dieses strategische Anderswo sein, das uns jene Halteleinen kappen lässt, die wir nicht in Betracht ziehen? Wo lässt es sich finden?
Was aber heißt es, sich auf ein Denken »einzulassen«? Ich unterbreite hier den Vorschlag, sich auf das chinesische Denken einzulassen, um einen Abstand einzuführen, der uns enthüllt, wie wir denken, innerhalb welcher Setzungen wir »zweifeln«: ein Abstand, der uns nicht nur über unsere Fragen nachdenken lässt, sondern mehr noch über das, was sie möglich gemacht hat und uns so sehr an sie bindet, dass wir sie für notwendig halten. Doch das chinesische Denken ist wirklich derart unermesslich – wird man mit seiner Erkundung je an ein Ende gelangen? Und wer wüsste andererseits nicht, dass der Leser von heute in Eile ist? Sind nicht selbst jene Reisen in die Ferne, für die man sich einst im Hinblick auf die zahlreichen zu überbrückenden Stunden mit reichlich Büchern ausstattete, inzwischen zu schnell geworden? Hat man noch die Muße für diese geduldigen Investitionen? Vielleicht steht Ihnen nur dieser eine Abend zur Verfügung … Glücklicherweise geht es in diesem Fall nicht darum, das chinesische Denken umfassend zu »kennen«, ein unendliches Unterfangen, für das zwei Leben nötig wären; sondern um etwas ganz anderes: lediglich darum, eine Schwelle zu überschreiten, sich »einzulassen«.
IWas heißt es, sich (auf ein Denken) einzulassen?
Sich einlassen heißt im buchstäblichsten Sinn zunächst einmal eintreten: von einem Draußen in ein Drinnen gelangen. Das chinesische Denken ist nun in der Tat sehr lange außerhalb unseres europäischen Denkens geblieben und umgekehrt. Ein solches Außen bemerkt man gleichermaßen in der Sprache und in der Geschichte. Lassen wir diese Ausgangsdaten, die zwar ein jeder kennt, doch vielleicht ohne deren Tragweite zu ermessen, Revue passieren. Sie sind die Rechtfertigung für den Umweg über China, auf dem wir unser Unzweifelhaftes und unser Ungedachtes angehen wollen. Erinnern wir uns zuerst daran, dass das Chinesische nicht zur großen Familie der indoeuropäischen Sprachen gehört, während wir mit Indien noch über das Sanskrit, die Schwestersprache des Griechischen und Lateinischen, in Verbindung stehen. Dass die chinesische Schrift ideographisch und nicht phonetisch ist, und vor allem, dass sie unter allen Sprachen als einzige bis heute ideographisch geblieben ist, lässt zudem bereits ihren singulären Bezug zur Mündlichkeit ebenso wie eine nicht gelockerte Abhängigkeit von der gestaltgebenden Macht des Duktus erahnen. Wie konnte – und musste – das ihr Denken prägen? Andererseits dauerte es bis zu unserer Renaissance, dass Europa in China an Land ging; und wirklich entwickelt haben sich die Beziehungen zwischen den zwei Enden des großen Kontinents erst mit dem Aufschwung des Handelsverkehrs im 19. Jahrhundert, im Vergleich zur Geschichte dieser Zivilisationen demnach reichlich verspätet – und die eine von ihnen zwingt dann gleich der anderen ihren Imperialismus auf. Heute beginnen sich die Herrschaftsbeziehungen zwischen den beiden Polen umzukehren. Trotzdem, die Frage bleibt: Wie sehr wird (oder auch nicht, das wird von uns abhängen) unter den existierenden Machtverhältnissen und Hegemoniebestrebungen von der einen oder von der anderen Seite das Denken des jeweiligen Gegenübers intellektuell durchdrungen? Oder wird man sich mit einem bloßen Anschein der Durchdringung begnügen?
Es hatte freilich schon zur Zeit der Römer die Seidenstraße gegeben, aber wussten die Römer, dass die importierten Güter aus China kamen, made in China? Welche Spuren haben sie im Denken hinterlassen? Es gab freilich auch Marco Polo, zwei Jahrhunderte vor den Missionaren, doch Marco Polo reiste auf dem Landweg: Das seltsame Schauspiel der Sitten, der Lebensweisen und Gesellschaftsformen, der Königreiche und der Sprachen, der Höfe und der Armeen wiederholte sich unablässig neu vor ihm, kontinuierlich, je nach der entsprechenden Landschaft – durch kaum merklichen Übergang, ohne abrupte Brüche; ohne dass es ein Ereignis im eigentlichen Sinn gäbe; ohne dass ein plötzliches Aufkreuzen wirklich möglich wäre. Als dann im 16. Jahrhundert die Missionare auf Schiffen anheuern und eines schönen Tages in einem Hafen in Südchina vor Anker gehen, ist das eine ganz andere Sache. An Land gehen heißt sein Schiff verlassen und eines Tages auf neuer Erde Fuß fassen: Dort sind Sie, der Sie plötzlich aus einem »Anderswo« auftauchen, noch über nichts auf dem Laufenden, und man hat Sie nicht erwartet.
Auch im Denken impliziert sich einlassen, dass man sich bewegt; etwas hinter sich lassen, um anderswo eindringen zu können. Auf ein Denken lässt man sich ein wie auf einen Verein, eine Bruderschaft oder eine Partei: Man kann nicht beitreten ohne ein gewisses Akzeptieren, zumindest temporär, auf Probe – hat man mir nicht oft genug meine vermeintliche »Anhänglichkeit« an die »Immanenz« des chinesischen Denkens vorgeworfen? Oder so, wie man sich auf die Angelegenheiten von jemandem einlässt, angefangen damit, sich persönlich für sie zu interessieren und sie sogar zu seinen eigenen zu machen und sich um sie zu kümmern. Sich auf die Gefühle eines anderen, auf seine Nöte und auf seine Sorgen einzulassen, heißt zu akzeptieren, sich an seine Stelle zu versetzen und seine Sicht der Dinge zu übernehmen: Das geht nicht ohne Teilen und stilles Einvernehmen, es bedarf einer Komplizenschaft. Sich auf das chinesische Denken einzulassen, heißt also damit zu beginnen, sich von dessen Blickpunkt aus zu hinterfragen, gemäß dessen impliziten Voraussetzungen und dessen Erwartungen. Nun wissen Sie über dieses Denken zumindest eines, was uns von Beginn an in Verlegenheit bringt: dass es zu den ältesten gehört, sich über einen sehr weiten Raum und eine lange Zeit erstreckt hat; und auch, dass es in jüngster Zeit immer massiver unter einen fremden Einfluss geraten ist, den unseren, aber sich ungeachtet dessen noch heute, und selbst noch überlagert und verfälscht, als solches behauptet. Daraus ist zu folgern, was gewiss eine der wichtigsten Tatsachen für unsere Generation darstellt: Wir werden uns in Europa nicht mehr auf den Horizont des europäischen Denkens beschränken können. Wir müssen unser Zuhause verlassen und unseren philosophischen Atavismus abschütteln – uns anderswo »umschauen«, was bereits bei den Griechen, erinnern wir uns, die erste Bedeutung von »Theorie« war, bevor sie platt spekulativ wurde.
Doch wie kann man sich zu diesem Denken Zugänge erschließen? Es dauert ja bekanntlich so lange, bedarf solcher Geduld, »Berufserfahrung« und Gedächtnisleistung, um die Initiation in die klassische Sprache Chinas zu vollziehen und sich in den unermesslich tiefen Wald ihrer Texte und Kommentare zu wagen. Umso mehr, als diese Sprache nicht die Bequemlichkeiten der unseren bietet: Sie hat keine Morphologie – weder Konjugation noch Deklination – und quasi keine Syntax, zumindest nicht im klassischen Chinesisch. Man kann also nicht anders vorgehen, als es die chinesischen Schriftgelehrten während so vieler Jahrhunderte selbst getan haben: auswendig lernen und rezitieren. Vor allem lässt sich, wie schnell verständlich wird, ein solches Denken nicht kurz zusammenfassen. Kein Überfliegen – Abriss, Extrakt, digest – kann uns Zugang verschaffen, denn eine solche Reduktion führen Sie anhand von Begriffen durch, die von Anfang an die Ihren sind; Sie verfahren, ohne diese in Unordnung zu bringen, ohne sich selbst zu bewegen, ohne loszulassen: Sie sind in Ihren Ausgangskategorien verhaftet geblieben – Sie entdecken nicht. Wäre es dann nicht naheliegend, die wichtigsten chinesischen Begriffe (tao, yin und yang usw.) tabellarisch zu präsentieren, indem man sie auflistet und ein Glossar zu ihnen zusammenstellt? Dann aber geschieht eins von beiden: Entweder Sie lassen sie unübersetzt in einem fernen Exotismus schillern; oder Sie stutzen bei Ihrem Übersetzungsversuch deren Inhalt in einer fremden Sprache (der Ihren) zurecht und reißen die Begriffe aus ihren Zusammenhängen, lösen sie ab von ihrem implizit Mitgemeinten: Sie teilen nicht mehr. Außerdem wird dieses Denken nur ein mehr oder weniger deformiertes Faksimile unserer eigenen philosophischen Konzepte liefern. Sie haben noch immer keinen Weg gebahnt, noch keine Schwelle gefunden, die »Zugang« gewähren würde.
Stattdessen die Geschichte des chinesischen Denkens konstruieren zu wollen, um in es einzuführen, gibt ein Sicherheit vermittelndes Gefühl von Totalität: Man würde es von Anfang bis Ende erfassen, entlang seines Verlaufs, in seinem kleinsten Woher und Wohin; so würde man der Kammlinie seiner Entwicklung folgen. Doch kann man außer Acht lassen, dass es sich dabei um eine spezifisch westliche Darstellungsform handelt, sprich um eine Inszenierung, die jener starken, konstitutiven, aus schallenden Brüchen und Konfrontationen gemachten Historizität Rechnung trägt, die der europäischen Philosophie eigen ist? Die Chinesen selbst haben sich ihr erst durch die Schule des Okzidents zugewandt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als sie auch jenen von ihnen so schlecht übersetzten Begriff der »Philosophie« entlehnten: zhe-xue, »Weisheit-Studium« (»Nachahmung-Anwendung«, tetsu-gaku auf Japanisch) – wo bleibt da das Begehren, der erôs der Philosophie? Wer also garantiert uns, dass uns eine solche Geschichte, indem sie innerhalb des Denkens Positionen aufstellt, Thesen hervorkehrt, Debatten und Widersprüche konstruiert (gewiss hat es von Zeit zu Zeit in China auch Debatten gegeben), nicht auf Abstand hält zu den stillschweigenden Einverständnissen, den unablässig »wiederaufgewärmten Offenkundigkeiten«, die laut Konfuzius den – implizit geteilten, jedoch daher für uns außer Reichweite bleibenden – Übereinkunft stiftenden Grund dieses Denkens gewebt haben? Eben deshalb zögern wir auch, es »Philosophie« zu nennen.
Und hegt man schließlich den Wunsch, die Diversität der Schulen durch methodisches Bemühen um Klassifizierung zum Vorschein kommen zu lassen (»Konfuzianismus« / »Taoismus« / »Buddhismus« …), dann verstärkt man mit diesen Rubriken noch auf drastische Weise Trennungen, die in China mehr noch als anderswo nur als Anhaltspunkt dienen, um Verwandtschaftsbezüge herzustellen: (philosophische) Schule nennt sich dort jia, »Familie«. Solche Tabellarisierungen reihen ein (rückversichern), aber geben nicht zu denken; unter ihren Etiketten bleiben sie ihrer Materie äußerlich. Ich will sagen: Sie helfen uns nicht, uns des chinesischen Denkens zu bedienen, um uns selbst zu hinterfragen; und auch wenn man dann von »chinesischem Denken« spricht, denkt man noch immer in seiner eigenen Sprache, gemäß seinen eigenen Werkzeugen. Auf die eine wie auf die andere Weise sind Sie immer noch draußen geblieben, bei sich, haben Sie sich noch immer nicht bewegt: Sie haben sich nicht »eingelassen«.
IIDas Anderswo Chinas
Wir müssen tatsächlich die Größenordnung dieses chinesischen Anderswo besser ausloten. (Das ist umso nötiger, als unter der Flagge der Globalisierung inzwischen überall Standardkategorien in Anschlag gebracht werden, die sämtliche Landschaften – auch die mentalen – mit ihren Stereotypen sättigen, wobei sie die Tendenz aufweisen, ihre Uniformität für Universalität auszugeben; die Tendenz also, dem, was nur eine Erleichterung der Produktion und ihrer medialen Vermarktung ist, den Anschein einer logischen, grundsätzlichen Legitimität zu geben, indem ihm ein Seinmüssen zugeschrieben wird.) Gelingt uns das nicht, wird ganz im Gegenteil das Besondere isoliert, eingepfercht, zum Klischee gemacht, wird Erhaltengebliebenes überhöht und in eine künstliche Folklore verwandelt: einen Köder für Touristen. Auch müssen wir heute – gegen Widerstände – eine Geographie dieses Anderswo und dieser möglichen Wege des Denkens erstellen. Was um Gottes Willen nicht heißt, in der Suche nach einer Pseudoidentität die Kulturen ängstlich auf sich selbst hin abzuschließen, sondern durchaus das Gegenteil: ihre Ressourcen für jedwede Intelligenz zu erforschen und sie zu erschließen. So wie ich »Intelligenz« verstehe, ist sie keine feststehende Fähigkeit mit erstarrten oder meinetwegen auch »transzendentalen« Kategorien, wie im klassischen Verständnis, sondern sie ist rege und entfaltet sich, schreitet voran im Zuge der durchlaufenen Intelligibilitäten. Und je weiter nun diese Intelligibilitäten voneinander entfernt sind, umso mehr geben sie einem zu entdecken und zu durchlaufen.
Beginnen wir auf besser markiertem Terrain. Was Indien betrifft, so haben uns die Arbeiten der vorherigen Generation (in Frankreich vor allem von Dumézil und Benveniste) gezeigt, wo die Gemeinsamkeiten mit uns Europäern liegen, im Hinblick auf semantische Elemente ebenso wie auf logische Bezüge, auf mentale Repräsentationen ebenso wie auf soziale Funktionen. Man darf ebenfalls annehmen, dass sich zu Zeiten des klassischen Altertums das Denken beiderseits des Indus durch Kontiguität gegenseitig beeinflusst hat, zum Beispiel von den Gymnosophisten auf Plotin. Mit dem Islam, dessen Sprache einer anderen Familie angehört, teilen wir – noch immer das europäische, genauer genommen das christliche »Wir« – die Religion des Buches, die biblische Abstammung, die Idee eines Schöpfergottes: Spirituell verbindet uns das Absolute einer uns durch eine Offenbarung überlieferten Botschaft; und außerdem haben sich die Geschichten Europas und des Islams unaufhörlich vermischt. Aristoteles ist uns durch die Araber überliefert; Thomas von Aquin lässt sich von Averroes inspirieren; der islamische Monotheismus baut auf seinen Vorgängern auf. Und selbst die Figur des europäischen Intellektuellen geht in ihren ersten Grundzügen auf das maurische Andalusien zurück. Doch wie hat man jenseits dieses Horizontes gedacht? Sollte man in diesem »Anderswo« – denn ein Anderswo ist es – anders gedacht haben?
Als Entweder-Oder läuft die Frage in aller Grobheit auf Folgendes hinaus: Sind die verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt nicht ebenso gut auch unendlich abgewandelte Antworten auf die gleichen Fragen, die wir uns stellen – die wir uns unmöglich nicht stellen können? In diesem Fall beliefe sich ihr Inventar auf eine breitgefächerte Palette. Oder aber können wir nur in jenen von uns zwischen den Kulturen zutage gebrachten Abständen entdecken, was es mit dem »Menschlichen« auf sich hat? Besser gesagt, können wir nur entdecken, worum es dabei »geht«, wovon es »ausgeht«, indem wir es (in dem Bewusstsein, dass es sich dann in ebenjenen mannigfachen Gegenüberstellungen befindet) geduldig Zug um Zug identifizieren? Mit dem Bild des Gehens soll dabei der offene, fortschreitende, nicht definitive Charakter dieses Entdeckens bewahrt werden. Ohne weitere Aufstellung von Vorabdefinitionen, vor allem keiner des »Men- schen«, die immer ideologisch ist – was augenscheinlich an die Universalität der Fragen selbst rührt.
Lässt sich Kants Kurzformel – »Was kann ich wissen?« / »Was soll ich tun?« / »Was darf ich hoffen?« – so umstandslos exportieren? Lassen sich denn diese Fragen, die die allerabstraktesten sein und alles Hypothetische so gut wie möglich in ihrem Dreieck fassen wollen, deshalb schon von ihren semantischen Faltungen loslösen? Und lassen sie sich folglich von den vorgefassten theoretischen Annahmen isolieren, von denen sie aufgeworfen wurden? Tatsächlich können wir nicht einmal sicher sein, dass »wissen« (oder »erkennen«) und »tun« (oder »handeln«), Schlüsselbegriffe unserer klassischen Philosophie, sich a priori in anderen Sprachen wiederfinden, und man kann sich vorstellen, dass dies beim eschatologischen »hoffen« noch um vieles fraglicher ist … Bleiben diese drei Selbstbefragungen nicht in einer impliziten Voraussetzung stecken, der sie nicht auf den Grund gehen, solange sie keinen (äußeren) Anhaltspunkt haben, um sie zu reflektieren? Führt uns folglich dieses Verschiedenartige – aus dem Verschiedenartigen der Kulturen – nicht auf unsere eigenen Fragen zurück und zwingt uns, sie zu überarbeiten? Was China betrifft, frage ich mich sogar: Ist es überhaupt notwendig, dass wir mittels Fragen denken? Heißt Denken immer, ein Rätsel zu beantworten, die Sphinx zu befragen, den Abgrund auszuloten, wie es im Abendland seit den Griechen mit großer Leidenschaft gewollt wurde?
Es stimmt allerdings, dass eine Disziplin geboren wurde, als sich der Okzident in seiner Rolle als Erforscher des Anderswo und Kolonisator der Ressourcen der Verschiedenartigkeit über die Kulturen der ganzen Welt kundig gemacht hat – die »Anthropologie«. Doch hat man sie nicht zu voreilig und zu sehr zu ihrem Vorteil so benannt? Hält sie denn ihre Versprechen? Und warum überhaupt hat die Philosophie aus jenem Anderswo, das sie uns entdeckt, so wenig Nutzen gezogen? Im Gegensatz zur Kunst beispielsweise, die sich von ihm inspirieren ließ. Wieso hat sich die Philosophie ihrerseits so wenig an ihm erneuert? Oder nur an ihren Rändern: schon bei Montaigne (doch ist Montaigne »Philosoph«?). Das heißt, warum behalten wir für diese Untersuchung über die kulturelle Diversität jenen beschränkten, ausschnitthaften Modus bei, ohne mit ihr unser Universelles zu erneuern? Ohne aus ihr den Schlüssel zu dem zu machen, was »Humanität« ist – oder vielmehr sein kann?
Fortan wird es unmöglich sein, weiter mit Hegel bis zum Überdruss zu wiederholen, dass die Philosophie zuerst im Orient zum Vorschein gekommen sei (»Orient« in einem weitgefassten Sinn: oriens, der Osten (auch der Ferne Osten), dort wo die Sonne aufgeht, der Tag anbricht), doch durch eine seltsam hinausgezögerte Geburt erst in Griechenland die Bühne betrat, mit der Entdeckung des philosophischen Begriffs und seiner Operativität, die das Allgemeine mit dem Einzelnen verband; oder mit Husserl, dass zwar alle Kulturen gleichermaßen anthropologische »Variationen«, also prinzipiell gleichgestellt seien, doch nur eine, die europäische, das heikle Schicksal einer Selbstzuwendung und Selbstreflexion erfahren habe; oder mit Merleau-Ponty, dass der in der »Kindheit« der Philosophie verbliebene Orient mit derselben nur eine »indirekte« Beziehung unterhalten könne (obwohl wir nur zu gut wissen, wie viel wir von den Kindern zu lernen haben!). Nein, wir werden nicht mehr von einer Geophilosophie ausgehen können, wie es sogar Deleuze noch getan hat, das heißt, für das außereuropäische Denken an einem Stadium des »Vorphilosophischen« festzuhalten, da es nicht die Immanenzebene erreiche, usw. Wenn wir es aber weiter so halten, dann urteilen wir über dieses Denken immer nur nach unseren Erwartungen, oder sagen wir eher, nach unseren implizit gebliebenen Vor-Erwartungen, die unseren »Vor-Urteilen« lange vorausgehen und die als solche zunächst einmal aufzuspüren wären, was Descartes nicht bedacht hatte; und brauen uns bei der Kontaktaufnahme mit diesen »Anderen« noch immer nur Klischees und Etiketten zusammen, ohne in die bei ihnen wirkenden Zusammenhänge einzudringen und ohne unsere vorgefassten Annahmen zu hinterfragen – welche denn? Folglich auch ohne ausgehend von ihnen unser eigenes Ungedachtes zu ergründen: Eingelassen auf diese Gedanken von draußen haben wir uns noch immer nicht.
Die Philosophen unter meinen Freunden entgegnen mir für gewöhnlich Folgendes: Seit es ihre philosophischen Schulen gibt, haben die Griechen die möglichen Wege des Denkens entfaltet, indem sie systematisch seine Widersprüche herausgearbeitet haben. So Heraklit gegenüber Parmenides, oder Epikur gegen Platon (oder der Materialismus gegenüber dem Idealismus usw.). Konnte man seine Optionen denn radikaler wählen, und stecken diese Gegensätze nicht das gesamte Feld des Denkbaren ab? Das heißt, kühn gesprochen, gehen sie und die Ausübung der Vernunft selbst nicht fließend ineinander über? Ja, antworte ich darauf, die Griechen haben wohl alle Möglichkeiten erfasst, doch sind diese auf gewisse Weise konfiguriert, bereits vor-gefaltet aufgrund gewisser getroffener Entscheidungen, die sie nicht bedachten, an denen sie nicht zweifelten, die sie nicht vermuteten, über die sie nicht erstaunt waren – die zu bedenken sie nicht bedachten. Es stimmt, dass man ohne Falte