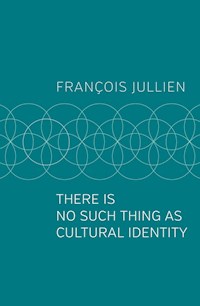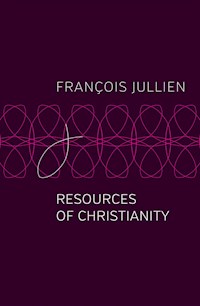Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Asiathek
- Sprache: Deutsch
»Vom Sein zum Leben« versteht Francois Jullien als kritisches Resümee seiner lebenslangen Beschäftigung mit dem chinesischen Denken und Sprechen. Anhand von 20 Begriffspaaren entfaltet er die Differenzen der beiden Kultur- und Denkräume: In höchst originellen Essays stellt er beispielsweise »Kohärenz« dem »Sinn« gegenüber, »Beharrlichkeit« dem »Willen«, »Zuverlässigkeit« der »Aufrichtigkeit«, »Aufschwung« dem »Stillstand«. Doch Jullien begnügt sich nicht, das eine Konzept mit Hilfe des anderen zu erleuchten und damit die zugehörige Kultur zu verstehen. Er geht in diesem Buch einen Schritt weiter, versucht von beiden Abstand zu nehmen und eine dritte Position zu gewinnen, die ihm ermöglicht eine eigenen philosophischen Entwurf zu entwickeln. Ein Buch für alle, die China verstehen, aber dabei nicht in Exotismus schwelgen wollen, und für alle, die die Lust am eigenen Denken nicht verloren haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANÇOIS JULLIEN
Vom Sein zum Leben
Euro-chinesisches Lexikon des Denkens
Aus dem Französischenvon Erwin Landrichter
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
I. Neigung (vs. Kausalität)
II. Potenzial der Situation (vs. Initiative des Subjekts)
III. Disponibilität (vs. Freiheit)
IV. Zuverlässigkeit (vs. Aufrichtigkeit)
V. Beharrlichkeit (vs. Wille)
VI. Schräges (vs. Frontales)
VII. Kniff (vs. Methode)
VIII. Beeinflussung (vs. Überredung)
IX. Kohärenz (vs. Sinn)
X. Einvernehmen (vs. Erkenntnis)
XI. Reifung (vs. Modellierung)
XII. Regulierung (vs. Offenbarung)
XIII. Stille Verwandlung (vs. Lautstarkes Ereignis)
XIV. Evasiv (vs. Bestimmendes Zuweisen)
XV. Allusiv (vs. Allegorisch)
XVI. Ambigue (vs. Äquivok)
XVII. Zwischen (vs. Jenseits)
XVIII. Aufschwung (vs. Stillstand)
XIX. Nichtverschieben (vs. Aufzuschieben wissen)
XX. Ressource (vs. Wahrheit)
Subjekt/Situation
Von einer Gabelung im Denken
Nachwort
Vom Abstand zum Gemeinsamen
Anmerkungen
Im Lauf der Arbeit kommt ein Zeitpunkt – ein Moment im Leben vielleicht? –, wo es angebracht erscheint, die verschiedenen Fäden miteinander zu verbinden oder, so könnte man auch sagen, sich einen Überblick über seine Baustelle zu verschaffen. Ein Moment des kritischen Resümees, so wie ihn ein Gärtner erlebt, wenn er einen Rundgang durch seinen Garten macht, um zu sehen, was darin gedeiht, was Wurzeln geschlagen hat und was nicht, in welchem Zustand sich die Pflanzen befinden, welcher Boden einer erneuten Bearbeitung bedarf, wo ausgerissen und wo neu gepflanzt werden muss.
Bei einer philosophischen Baustelle geht es darum, den Zustand seiner Konzepte1zusammenzufassen und zu sehen, wozu sie wohl dienen könnten. Es sind hier Konzepte aus der Begegnung von chinesischem und europäischem Denken hervorgegangen, oder genauer gesagt: aus dem chinesischen und dem europäischen Sprechen-Denken [langue-pensée], denn selbst wenn es nicht von der jeweiligen Sprache determiniert wird, so beutet das Denken nicht minder deren Ressourcen aus. Die Konzepte, die ich hier vorlege, sind aus dieser Begegnung entstanden, dienen jedoch zugleich auch dazu, diese Begegnung überhaupt erst zu konzipieren, d. h. sie zuallererst möglich zu machen. Genau darin liegt tatsächlich die Schwierigkeit: Eine Begegnung dieser Sprachen und Denkweisen sollte Werkzeuge in der Art produzieren, dass ohne sie diese Begegnung gar nicht stattfinden könnte – das Resultat ist demnach auch die Vorbedingung. Wie aber kann man zwischen den Denkweisen denken, d. h. ohne in der einen oder anderen eingesperrt zu bleiben, sondern sich von der einen durch und querverlaufend zur anderen zu lösen, um ihnen zu erlauben, sich füreinander zu inter-pretieren? Ich werde hier so vorgehen, dass ich abwechselnd bei der einen und bei der anderen vorbeischaue, und zwar sowohl von der einen Seite her als auch von der anderen, lateral also, jedoch ohne mich auf eine der beiden festzulegen, qua hinc, qua hac heißt das im Lateinischen oder umgangssprachlich im Französischen »cahin-caha«. Ja, einmal so, einmal so, sich hin- und herwindend. Diese Vorgehensweise ist nicht sehr glorios, aber die einzig logische, wenn man nicht der üblichen Illusion verfallen will, sich eine unmögliche Überstülpung (einer unmittelbar direkten Übersetzung dieser Sprachen und Denkweisen) anzumaßen: wenn man die notwendigen Voraussetzungen zur beiderseitigen Anbahnung eines wechselseitigen Anhörens schaffen will. Anderenfalls würde man ja gleich zu Beginn die Kategorien und Vorausentscheidungen der eigenen Sprache und des eigenen Denkens, die jedoch ungedacht bleiben, auf dieses Anderweitige der Sprache und des Denkens projizieren und könnte einander dann wohl kaum noch tatsächlich begegnen.
Mit anderen Worten: Ich glaube nicht, dass man vom Westen her das chinesische Denken direkt oder frontal »vorstellen«, es resümieren, einen Gesamtüberblick bzw. ein handliches Digest davon verfassen oder gar seine Geschichte schreiben kann. Man bleibt unvermeidlich und ohne es zu bemerken von den implizierten Entscheidungen seiner eigenen Sprache und seines Denkens abhängig und würde letztlich stets bloß ein Faksimile dessen vorfinden, was man bereits gedacht hat, mit mehr oder weniger großen Abweichungen. Es hat keinerlei Verstörung stattgefunden, man hat nicht Abstand genommen. Man hat »das Europa mit seinen alten Brüstungen« nicht verlassen. Die einzige Strategie, die ich sehe, um dieser Aporie zu entgehen, ist, eine schrittweise Gegenüberstellung vorzunehmen, lateral, wie ich bereits sagte, mit aufeinander folgenden Seitenschritten, durch miteinander verknüpfte Verschiebungen und Verstörungen, durch Ent- und Rekategorisierungen, Masche für Masche knüpfend von einem Konzept zum nächsten, sodass diese im Fortgang ein Lexikon ergeben.
Die Lemmata dieses Lexikons sind keine auf ihre Allgemeinheit vertrauende Begriffe, sondern konzeptuelle Abstände [écarts], die eine nur allzu schnell zugestandene Allgemeinheit rissig werden lassen und dadurch ein Dazwischen unter diesen Sprachen und Denkweisen öffnen. In weiterer Folge wird es nicht darum gehen, zu »vergleichen«, indem versucht wird, die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu identifizieren, um das eine wie das andere Denken zu charakterisieren – diese Identifizierungen wären ebenso vergeblich wie unmöglich. Vielmehr wird durch die Organisation einer Gegenüberstellung dieser Sprachen und Denkweisen eine wechselseitige Betrachtung möglich, aus der eine Reflexion der einen durch die andere resultiert, und zwar simultan und beiderseits. Da es dem Abstand eigen ist, nicht wie die Unterscheidung durch die Einteilung in Gleiches und Anderes Ordnung zu schaffen, sondern Verwirrung zu stiften, indem er herauszufinden auffordert, wie groß er ist, wird er durch die sich eröffnende Distanz das Denken wieder in Spannung versetzen, also wieder in seiner Arbeit aktivieren. Auch sind diese Konzepte nicht retrospektiv, indem sie eine Bilanz der beiden bisherigen Traditionen ziehen, sondern prospektiv: Indem sie eine Dissidenz innerhalb der Philosophie in Gang setzen und in weiterer Folge eine schrittweise Rekonfiguration des Denkbaren, rufen sie zu einem Denken auf, das sich der auf beiden Seiten zur Verfügung stehenden Ressourcen bedient und dabei die festgefahrenen Bahnen der einen wie auch der anderen zugunsten eines Neuanfangs verlässt. Wenn man Schweiß und Frust (Arbeit) auf sich nimmt, aber auch Lust, Leidenschaft und »Frohsinn« zulässt – die »Fröhliche Wissenschaft« steht im Gegensatz zu dem, was die sinologische Gelehrsamkeit nur allzu oft an Freudlosigkeit an sich hat –, kann das Denken wieder zur Initiative finden, dann kann es aufs Neue etwas wagen.
Konzept heißt so viel wie Werkzeug. Jedes hier geschmiedete Konzept ist nun eines im Hinblick auf ein anderes (versus ein anderes), das zunächst das semantische oder funktionale Äquivalent von ihm zu sein scheint, das sich aber durch den Abstand als das Gegensätzliche oder als Antonym von ihm herausstellt. Dergleichen Konzepte »entfalten« das Denken, d. h. sie öffnen die markierten und verfestigten »Faltungen« wieder. Sie haben daher keine spezifische Anwendung oder ein bereits im Vorhinein zugewiesenes Gebiet. Dafür lassen sie nach und nach, über den einen oder anderen indirekten Zugang, Rissbildungen in dem Ganzen erkennen, die es zu erforschen gilt: Rissbildungen zwischen dem, was sich im Rahmen des europäischen Denkens als Dominanz des Subjekts erweist, und dem, was wir in Europa nur mit dem armseligen, zu restriktiven Ausdruck Situation bezeichnen (zu restriktiv, weil eben nicht losgelöst von der Perspektive des Subjekts) – diese Alternative gilt es zu konstruieren. Dabei sind die Konzepte dieser Zwischenwelt Vagabunden. Sie sind zu allem zu gebrauchen, sie durchqueren ganz munter die traditionellen Gebiete der Geschichte, der Moral, der Politik oder Ästhetik, sie wandern von der Ersten Philosophie bis zur Denkweise des Managements. Sie sind sowohl theoretisch als auch praktisch, oder genauer gesagt: Sie beginnen, den Gegensatz von »Theorie« und »Praxis« aufzuweichen. Ich würde sagen, sie sind eher strategisch. Indem sie die Ressourcen der einen und anderen Sprache, des einen und anderen Denkens nutzen, dienen sie dazu, eine Strategie sowohl von Leben [vivre] als auch von Denken auszuarbeiten.
Welche Perspektive entfaltet sich im Zuge dieses Ablaufs, welche Geschichte gibt sich darin zu erkennen? Da profiliert sich nach und nach, dem Faden folgend, mit dem ich Masche für Masche zwischen dem Sprechen-Denken Chinas und dem Europas stricke, ein Ausgang aus der »Frage des Seins«, der sich zugleich als ein Zugang zum Denken von Leben herausstellt. Man kann tatsächlich nicht »weggehen« (etwas dekonstruieren), ohne anderswo hineinzugehen (etwas zu entdecken). Wenn nun Leben sich nicht mit der Begrifflichkeit von »Sein«, d. h. von Wissen, erfassen lässt, in der das europäische Denken, zumindest die Mehrheit der Philosophie, gedacht hat – wie kann man es dann angehen? Oder anders gesagt: Wenn »leben« sich nicht zum Gegenstand des Denkens machen lässt, weil man von Anfang an darin befasst und daher ohne Distanz zu ihm ist, wie kann man dann Zugang dazu finden? Schließlich ist es doch wahr, dass wir nichts anderes anstreben als zu leben.
I
Neigung (vs. Kausalität)
– 1 –
Wir mussten, um die Dinge zu denken, das Sein und das Werden trennen. »Wir« – sind das nur die Griechen? Und wenn ich sage: »die Dinge«, so handelt es sich selbstverständlich genauso um Lebewesen wie um Dinge, unabhängig von ihrer Natur und ihrem Verhalten – der Terminus möchte durch seine Unbestimmtheit so allgemein wie möglich sein. In einer allerersten Geste – und sie scheint durch die Vorgehensweise des Geistes geboten – unterscheiden wir zwischen dem Statischen und dem Dynamischen, zwischen stabilem und bewegtem Zustand, wobei sich Letzterer durch die Veränderung, die in ihm stattfindet, sogar als widersprüchlich erweist. Nicht dass wir die Dinge unausweichlich durch Sprachzwänge stabilisieren – in Frankreich ist das die Frage Bergsons –, aber wir betrachten einerseits die Situation und andererseits ihre Entwicklung. Von daher kommt es, dass wir die Dinge nicht in ihrer Konfiguration und zugleich in ihrer Transformation sehen können und dass wir niemals ausreichend an ein Ding herankommen – eben weil es kein in irgendeiner Weise isolierbares »es« ist –, wo wir doch wissen (wodurch wir wissen), dass Reelles vor sich geht oder sich spannt, aber eben nicht ist (res: das substanzielle »Ding«). Wir wissen nur, dass es erfolgt. Das heißt, dass wir nicht so sehr den Übergang vom einen zum anderen als vielmehr die Untrennbarkeit von beiden in einem schwarzen Loch belassen: dass die Dinge sich aus dem konstituieren, aus dem sie sich entwickeln. Was sich genauso umgekehrt lesen lässt: Sie entwickeln sich aus dem, was sie konstituiert. Um die Termini von früher wieder aufzunehmen, könnte man sagen: Das Ereignis ist in der Struktur.
Neigung [propension] scheint mir der geeignetste Terminus zu sein, um diesem Mangel abzuhelfen, nämlich diese Untrennbarkeit zu bezeichnen und einzugrenzen. Er würde diesem Undenkbaren am nächsten kommen, um zu sagen, wie die Dinge von dem, was sie »sind«, herbeigeführt werden und das »sind«, was sie herbeiführt: wie die Disposition in ihnen die Neigung impliziert und wie zugleich die Neigung selbst die Disposition konstituiert – wie die Entwicklung also nicht nur in der Konfiguration enthalten ist, sondern eins mit ihr ist und in ihr aufgeht. Dafür habe ich einige Bestätigung in einem Terminus des chinesischen Denkens der Antike gefunden, nämlich im shi. Das ist kein streng umrissener Begriff, der aber auf verschiedensten Gebieten Verwendung findet, von der Strategie bis zur Theorie der Machtausübung, von der Ästhetik bis zu grundlegenden Gedanken zur Geschichte und Philosophie, und ich war im Laufe der Lektüre der Texte erstaunt, dass er genauso oft mit »Situation« wie mit »Evolution«, mit »Bedingung« ebenso wie mit »Verlauf« übersetzt wurde.
Bis zu welchem, von der Intelligenz nie völlig geklärten, Punkt verbinden sich diese Begriffspaare miteinander, sodass sie sich als kommunizierend, ja sogar als äquivalent erweisen? »Tendenz« wäre noch zu sehr auf Seiten von Entwicklung, um brauchbar zu sein; es ließe das Situative zu wenig zur Geltung kommen; dieser Terminus wird nur allzu oft auch ins Psychologische hineingestopft, und zwar zu genetisch. Aus »Neigung« dagegen – der Terminus Propension ist eher ausgefallen, aber Leibniz hat ihn gekannt – hören wir heraus, dass die Dinge nicht »sind«, aber dass sie (sich) »neigen«, dass sie sich entsprechend ihrer Neigung spalten und dass gerade das ihr »Weiterkommen« ausmacht; dass sie durch ihre Gewichtung [pesée] (pendere) je nach Situation nicht zu kippen aufhören und durch diesen Elan und Schwung ihre Zukunft pro-duzieren; dass sie von vornherein danach streben, sich zu rekonfigurieren, aus dem einfachen Grund, weil sie stets nicht ein »Seiendes«, sondern ein Sich-Neigen sind. Stets: Die Welt besteht nur daraus, dass sich alles ständig und in gewisser Weise »nach vorne neigt« – pro-pendere – und so ihre Erneuerung produziert.
Wenn man von diesem Vokabular Gebrauch macht, hat man den Eindruck, in eine Art materialistische und deterministische Theorie zurückzufallen, wie wir sie in Europa immer wieder seit der Antike entwickelt haben. Genau das ist aber nicht der Fall – und eben hier kann uns das Denken von Neigung etwas Neues bringen, insofern es beginnt, uns von unseren Erwartungen wegzurücken. Interessant an diesem Konzept – oder besser: an dem, woraus ein Konzept zu machen wäre – ist, dass es uns von den Explikationen befreit, uns also aus dem Regime der Kausalität entlässt, das über das europäische Wissen geherrscht hat, um uns in eine beständige Implikation einzuführen. Die Griechen haben ausgehend von »Ursache« und »Prinzip« gedacht, von einer vorangehenden Ursache und einem wirkenden Prinzip (aitiaαἰτία und archēἀρχή sind die zwei einleitenden Termini des aristotelischen Vokabulars2). Wir dringen, anders gesagt, durch die »Ursache« zum »Ding« vor, dieses bezieht seine Wahrheit von jener, und wir »geben Rechenschaft« von welchem Seienden auch immer (das berühmte logon didonai der Griechen) nur durch etwas ihm Äußeres – was, zumindest auf symbolische Weise, das Ex- von Explikation verdeutlicht. »Kenntnis« ist so viel wie »die Ursachen der Dinge kennen«. Rerum cognoscere causas heißt im Lateinischen sentenziös eine Formel, die das Mysterium der Welt angeblich entschleiert, indem es dieses dem explanativen Regime unterwirft. Gott selbst – Platon sieht darin bereits eine Evidenz – wird als »erste Ursache« gesetzt, über die man nicht hinauszugehen imstande sei und von der ausgehend sich alles aneinanderreihen und »erklären« ließe (oder auch, im Phaidon, die »Idee« als »Ursache«).
– 2 –
Es liegt demnach hier, in der Kausalität, eine Wirkung der Intelligenz oder der Klarheit vor, die sich in allem fortsetzt, mit dessen Stempel die Griechen alles Wirkliche versehen haben (damit es als »wirklich« anerkannt wird, gemäß der Zweiteilung »verursachend«/»verursacht«). Die kausale Verbindung ist als solche archetypisch, so sehr trifft es nämlich zu, dass die Rolle des Verstands eben darin besteht, in einer Weise Beziehungen herzustellen und zwei Dinge zu »verbinden«, wobei das eine außerhalb des anderen behalten wird und zugleich dieses hervorruft – alles nach dem Modell: Das Feuer ist die Ursache dafür, dass das Wasser kocht. Nun hat die Kausalität das europäische Denken so sehr dominiert, dass wir diesen Rahmen und dieses große explanative Regime, diesen mächtigen Hebel vor allem des physikalischen Wissens, nicht verlassen haben und es bis in unsere Moderne nicht beargwöhnt wurde – mit Ausnahme von Hume und Nietzsche, deren Größe gerade darin liegt, es hinterfragt zu haben. Was unsere Moderne ausmacht, ist eben zum Teil der Versuch, sich von diesem Joch der Verkettungen zu lösen, indem sie den Gedanken wagt, dass dieses einzig unsere »Gewohnheit« als Rechtfertigung haben könnte. Was sie ausmacht, ist der Versuch, den Geist von der großartigen Antriebsfeder der Kausalität zu emanzipieren, und zwar bereits in der Physik, vor allem aber in der an ihr scheiternden Meta-Physik, die zu sorglos glaubte, ihr Gebäude auf diesem Kunstgriff errichten zu können.
Einige chinesische Denker am Ende der Antike (jene, die man die Späten Mohisten nannte) haben sehr wohl ebenfalls die Kausalität gedacht und sie sogar an den Beginn ihres Kanons gestellt, doch muss man sogleich bemerken, dass sie im Rahmen der chinesischen Tradition eine Sonderstellung einnehmen. Sie, die durch ihr Interesse an der Wissenschaft, der Physik und Optik, wie auch mit ihrer Forderung nach einer Definition sowie der Strenge ihrer Widerlegungsregeln den Griechen so nahe zu stehen scheinen, haben sich niemals mit dem dao, dem »Weg«, abgegeben: Wie weit haben sie sich von der Logik des Prozessualen, die unter dem Thema des »Wegs« das chinesische Denken dominiert hat, entfernt? Jedenfalls lässt sich bei ihnen die Möglichkeit eines Denkens erahnen, die die chinesische Tradition in ihrer Gesamtheit nicht entwickelt hat. Zweifellos gehörten sie selbst dem Milieu von Handwerkern oder »Technikern« an und nicht jenem der Berater des Hofes und der Literaten. Überdies wurden uns ihre Texte nur in Bruchstücken überliefert, da sie in China erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiedergefunden wurden, wiederentdeckt zur selben Zeit, in der es auch zur Begegnung mit dem europäischen Denken kam. Das reicht, um zu verstehen, weshalb das erkannte Mögliche der Kausalität nicht dazu geführt hat, sich im Kontext des chinesischen Denkens zu entwickeln; oder weshalb ein anderes Mögliches die Oberhand gewann, das nicht versucht hat, die Welt zu erklären, auf ihr großes Warum zu antworten und sich dagegen darauf konzentrierte, ihren geringsten Neigungen auf scharfsinnige Art auf die Spur zu kommen, um sich ihre Wendungen zu eigen zu machen und so in einen Einklang zu ihrem »Funktionieren« zu gelangen. Auf diese Weise wendet es sich ab von dem, was wir Physik und Metaphysik nennen, braucht es weder einen Gott als »Ursache« der Welt noch den Gedanken der Freiheit als »Ursache« des Subjektwillens.
In Termini von Neigung und nicht mehr jenen von Kausalität zu denken, heißt nicht nur, das Regime von Explikation zugunsten eines Regimes der Implikation zu verlassen oder auch von einer externen zu einer internen Begründung überzugehen, die sich als Immanenz versteht, sondern lässt uns, im weitesten Sinn, von der Klarheit durch ein »Abkoppeln« (der Elemente) und »Entkoppeln« (der Gegenteile), jener des Seins und seiner Konstruktion, in die Logik des zugleich Stufenlosen und auch Korrelierenden und insofern unendlich im Prozesshaften Verschränkten hineinkippen. Man muss verstehen, dass das Prozessuale radikal von dem zu trennen ist, was wir traditionellerweise unter »Werden« begreifen, da Letzteres stets im Schatten des Seins und als seine Ableitung oder sein Vergehen verstanden wird. Entweder war das Werden eine Degeneration, Opfer seines Verderbens, weil das Sein im zeitlichen Verlauf in der Geruhsamkeit der Identität versackte, oder es war, im Gegenteil, als »Potenz« (dynamis) auf ein Ziel ausgerichtet und bestrebt, dieses zu verwirklichen (die energeia des Aristoteles). Die Neigung dagegen deutet auf eine Entfaltung hin, die durch keinen Verlust ausgelöst wird, aber auch von keiner Berufung gekennzeichnet ist, die von vorne herbeigeführt wird, aber nicht zu etwas hin (dieses *zu3 der Verwirklichung und des Ziels). Vielmehr wirkt sie einzig durch die Weise, wie eine Situation dazu tendiert, »sich zu neigen«, indem sie ihre Richtung einschlägt, ihre Verlängerung induziert und ihre Erneuerung produziert.
Daraus folgt, dass die für das Erfassen von Neigung erforderliche Intelligenzmodalität nicht die der »Verbindung« ist (der »synthetischen«, jene des Verstands im Kant’schen Sinn), sondern, sagen wir einmal, eine des umsichtigen Einschätzungsvermögens [discernement] (häufige Bedeutung von zhi); ein Einschätzungsvermögen, das in jedem Faden oder jeder Faser einer Situation den »Ansatz« einer Verwandlung aufzuspüren vermag (der Begriff des ji aus der Antike im chinesischen Buch der Wandlungen). Statt Zustände zu analysieren, geht es also darum, Phasen und Etappen auf eine Weise zu beobachten, die es erlaubt, die im Entstehen begriffene Mutation bereits in der gegenwärtigen wahrzunehmen, und zwar in ihren Grundzügen [linéaments] (der Begriff von xiang). »Kontextuelle« Intelligenz hat man sie genannt, sowohl ab- und verzweigend als auch zusammenfassend, denn man muss jederzeit herausfinden, wie die Konfiguration in eine bestimmte Richtung zu kippen sich anschickt und das aufgrund der Verhältnisse und Variablen, die das Ganze ausmachen, durch den Effekt ihrer Paarbildung, eben das, was wir »Situation« nennen – Situation, ein Terminus, der von Neuem gedacht werden muss. Von nun an wird man sich nicht mehr damit zufriedengeben, die singuläre Verursachung einer Wirkung zu verfolgen. Alles ist immer nur ein von seinen Polaritäten her konditioniertes Spiel korrelierender Faktoren, aus dem sich ein Richtungswechsel ergibt – förmlich sekretiert, der aus einer winzigen, kaum aufkeimenden Möglichkeit zu einer immer wahrscheinlicheren wird, bis er sich dann tatsächlich aktualisiert.
– 3 –
Der Eintritt in die Logik der Neigung bringt nun die große, übrigens bewundernswürdige, europäische Inszenierung der Wahlmöglichkeit und ihrer Freiheit ins Wanken. Die griechische Frage bezüglich der Ethik ist jene nach der Ursache meines Handelns. Damit ich nicht in die Fänge einer deterministischen Erklärung gerate, muss ich wohl eine Unterbrechung in ihrer Rationalität schaffen, indem ich so etwas wie eine »Abwandlung« voraussetze, die aber zufällig (clinamen) ist und so wirkt, dass sie durch ihre eigene Ursache »die unendliche Aufeinanderfolge der Ursachen verhindert«, wie Lukrez das sagen wird, und so Platz für die Möglichkeit eines Willens macht.4 Wenn ich, wie das die Griechen gemacht haben, im Verlauf meines Verhaltens ein besonderes Segment herausschneide und isoliere, dem ich einen Anfang und ein Ende zuschreibe und das ich »Handlung« (praxis) nenne und diese von nun an nur eine Mehrzahl von Anfügungen zur Folge hat (»eine« Handlung – »unbestimmt viele« Handlungen), dann kann ich es nicht vermeiden, Fragen zur Herleitung und Begründung einer derartigen, sich als Entität konstituierenden Einheit von »Handlung« zu stellen. Ich kann nicht umhin, mir die Frage zu stellen, ob ich diese Handlung, isoliert wie sie ist, durch eine interne oder externe Kausalität vollzogen habe, durch eine, die von mir abhängig ist oder nicht, »aus freien Stücken« oder »unfreiwillig« (ekōn/akōnἑκών/ἄκων). Es ist die erste Klippe der Moral zu Beginn der Verantwortung. Tatsächlich hat die griechische Tragödie diese Frage noch vor der Philosophie thematisiert: Ajax (bei Sophokles), der sich in sein Schwert stürzt – hat er das von sich aus gemacht oder war er Opfer eines von anderswo herrührenden Wahnsinns, einer göttlichen Rache?
Wenn sich der Westen so sehr an die Freiheit geklammert und aus ihr sein Ideal gemacht hat, so sicher deshalb, weil er sich Gedanken über die jedem Einzelnen gegebene Fähigkeit machte, seine eigene Ursache zu sein, unabhängig von aller äußeren Bestimmung, d. h. seinen Grund in »sich selbst« zu finden, causa sui zu sein, sagt Spinoza zu Beginn seiner Ethik.5 In dem Augenblick aber, in dem ich nicht mehr in den Termini des isolierbaren, atomisierbaren Seins (oder Handelns) denke, sondern in jenen des kontinuierlichen Verlaufs (dessen, was ich mein Verhalten nenne: »Verlauf der Welt«, »Verlauf des Verhaltens«, tian-xing, ren-xing, , sagen parallel die Chinesen), kann die Frage nur mehr lauten: Durch welche ununterbrochene Inklination in dem, was meine ununterbrochene, wechselseitige Anregung mit der Welt ausmacht (xiang-gan), bin ich dabei, den Wert meines Verhaltens zu modifizieren – ihn zu erhöhen oder zu erniedrigen? Eine derartige Neigung ist trotz allem keineswegs deterministisch (die Kehrseite unserer Freiheit, die als solche nichts verschiebt), aber der Anteil an Wahlmöglichkeit und Initiative wird im Lauf dieses Prozesses so sehr verdünnt, dass er kaum merkbar selektiv ist: Diese »Wahl« kommt nur dort, wo es letztendlich »hinneigt« und hineinkippt, zum Ausdruck – also in Form eines Resultats. Die Frage, die sich dann stellt, ist: Wie kann man dieses, dem Verhalten Vorausliegende fördern und qualifizieren, von dem in weiterer Folge die Moralität meines Benehmens durch Neigung herrührt? Wie kann der geringste »Ansatz« eines in mir entdeckten moralischen Verhaltens – wie etwa das Unglück anderer plötzlich »unerträglich« zu finden, so bei Menzius6 – weiter entfaltet und diese Neigung zum Guten hin »gleich dem Wasser, das abwärts neigt«, durch Schaffung günstiger Bedingungen »kultiviert« werden? Wenn schließlich das gesamte Benehmen nur mehr Ausdruck dieser moralischen Neigung ist, die Tugend somit spontan wird und weder Zwang noch Anstrengung bedarf,7 dann ist man »weise« geworden.
Ebenso verhält es sich mit dem Verständnis von Geschichte. Statt sie in Ereignisse zu atomisieren, von denen man durch das Feststellen ihrer Ursachen deren Verkettung deutlich machen will, verfolgt man sie über eine lange Zeit hinweg – in ihrer »langen Dauer« [longue durée], wie Braudel sagt – in ihren Kraftlinien und ihrer »Gesamtneigung« (da shi nennt sie Wang Fuzhi8). Auch Montesquieu, dem bereits mit der zu bestimmten und daher zu zerstückelnden Vorgehensweise der Kausalität nicht gut zumute war, spielte darauf an, als er von »allgemeiner Ursache« sprach, die er später durch den »hauptsächlichen Gang« ersetzte, um die berühmten Ursachen »der Größe der Römer und ihres Niedergangs« zu beschreiben.9 Die Geschichte ist nicht aus einem unendlichen Gewimmel unmöglich zu inventarisierender Ursachen gemacht, die zurückzuverfolgen man irgendwann einmal willkürlich aufhört, sondern aus Neigungen, die stets umfassend sind, ob man sie nun in größerem oder kleinerem Maßstab betrachtet, und die sich ständig verstärken und dann umkehren, oder besser noch: die bereits diskret sich umzukehren beginnen, während sie sich verstärkend ausbreiten. Man kann nur künstlich feststellen, wann »das« angefangen hat, und muss bemerken, dass selbst die hervorstechenden Ereignisse nur Modifikationen und die ausgewiesenen Situationen eigentlich immer nur Übergänge sind.
So wäre man heute, wo der Terminus »Krise« in aller Munde ist und angeblich die Wahrheit unserer Zeit auf den Punkt bringt, in heilsamem Zweifel zu fragen berechtigt: Wann hat die »Krise« in Europa eigentlich begonnen? Sollte man analysierend die »Ursachen« aufzählen? Nun, wenn sie eines Tages begonnen hat, so sagt man sich, dann wird sie auch eines Tages aufhören. Jeder markierte Anfang ruft auch nach einem deutlichen Ende, wo doch jedes Segment zwei Endpunkte hat … Bald wird man dieses Theaters von Vorhang hoch und Vorhang runter, dieser leichtfertigen und scheinbar heilsamen Vorstellung von einem Eintritt und einem Austritt aus einem »Tunnel« überdrüssig. Wie kann man nicht dieser Neigung des Ensembles gewahr werden, der entsprechend sich das wirtschaftliche und politische Potenzial in ständiger Modifikation verschiebt, von der Situation wie auf einer Flutwelle getragen, und zwar vor allem von Westen in Richtung Fernen Osten? Diese Wende wird in der Folge noch andere Richtungsänderungen kennen, die sich bereits abzeichnen.
II
Potenzial der Situation (vs. Initiative des Subjekts)
– 1 –
Was die europäische Philosophie auszeichnete und zurückblickend letztlich ihr Schicksal war, ist, dass sie auf die Idee kam, ihren Anfang in einem Ich-Subjekt zu verankern. Diese Feststellung ist – leider! – zu banal, um sie ausreichend zu reflektieren: dass, wenn ich denke, ich zu denken beginne, und zwar nicht die Welt oder die »Dinge«, sondern dieses »Ich«, das denkt; dass dieses Subjekt sich selbst als erstes Objekt und sich selbst genügend setzt, und die »Welt« erst daran anschließend, quasi als Folge, an die Reihe kommt. An dieses »Ich denke«, an dieses inselhafte cogito, dessen Grundzüge bei Augustinus zu finden sind, hat Descartes anzuknüpfen verstanden, wodurch, so Hegel, das »Land der Wahrheit« in Sicht geriet. Dass der zu zweifeln beginnende Philosoph entdeckt, sein Denken sei ungewiss und schlecht abgesichert, ist offensichtlich zweitrangig in Anbetracht dieses ursprünglichen »Ichs«, auf das er sich, um anzufangen, wie auf einen Felsen retten konnte, oder mehr noch: Dieser Zweifel selbst ist wesentlich, denn es ist dieses Ich in »ich zweifle«, das sich als das jenige erweist, woran ich nicht zweifeln kann, so sehr ich mich auch anstrenge. Wovon hat sich Descartes unwissentlich nun gleich zu Beginn durch diesen hyperbolischen Zweifel getrennt, der mit einem Schlag alles zu umfassen meint und von dem ausgehend man selbstverständlich nicht abgehalten wird, die Welt und jedes Ding wieder auf seinem Platz zu finden? Was er später nach Belieben einzufangen trachtet, kann er nur in Abhängigkeit zu diesem anfänglichen ego und von nun an nicht mehr als Gesamtheit denken: Was ist es, das er nur mehr in dieser Faltung des Subjekts wird denken können? Was hat Descartes also im Endeffekt mit einem meisterhaften Schlag in das Ungedachte versenkt?
Gewöhnlich lautete die ihn feierlich verurteilende Antwort darauf, dass Descartes sich gleich von Anfang an von dem Anderen radikal abgeschnitten hat, damit den gemeinsamen Ursprung von Du und Ich, von dem Anderen und dem Subjekt verfehlte und sich dadurch in einen Solipsismus einsperrte. Es stimmt, dass Descartes sich gleich zu Beginn von der hebräischen Art des gegenseitigen Betrachtens abwandte – aber wäre das alles, was er mit seiner Art zu beginnen verloren hat? Ich fürchte, dass ihm noch etwas anderes abhandengekommen ist, etwas, das man seither nur mehr beiläufig in Betracht zieht und das seinerseits, während »Gott« immer noch da blieb, um dem Status des Anderen eine Stütze zu verschaffen, nur mehr der Zerstückelung des Empirismus anheimgefallen ist; etwas, das man in Europa nur in Bastelarbeit wieder instand zu setzen versuchen kann und was ich selbst nur mit dem bereits angeführten Terminus von »Situation« beginnen kann einzufangen. Subjekt oder Situation: Auch hier ist das europäische Denken, unwissentlich, abgezweigt. Wenn die moderne Philosophie, und sei es auch nur ein wenig bedauernd, von dem entscheidenden Ort des cogito sich abwendet und seither sich so sehr anstrengt, sich von ihrem Fehler reinzuwaschen, indem sie das große Andere in Erinnerung ruft und lobpreist, so hat sie vielleicht dem, was ebenfalls, aber weniger auffällig vernachlässigt wurde, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie nicht wusste, wie sie das hätte aufgreifen können. So sehr hat man in Europa ununterbrochen das Eine, das Subjekt, auf Kosten des kleinen Anderen gedacht, dass es ohne Name und Gesicht geblieben ist und das, was wir, so gut es eben geht, als »Situation« bezeichnen, nur in einer unbefriedigenden Aufholjagd und behelfsmäßig hat in Betracht ziehen können.
Subjekt oder Situation: Diese Gegenüberstellung wird im Hinblick auf das chinesische Denken seltsamerweise klarer. Man denke nur an das, was wir »Landschaft« nennen und was im Großen und Ganzen nichts anderes als die natürliche und ursprüngliche Modalität einer »Situation« darstellt. Dieser Begriff wurde in Europa zur Zeit der Renaissance entdeckt, als jenes Dispositiv des Subjekts sich zu installieren begann, das Descartes dann so meisterhaft auszunutzen verstand. Die Landschaft ist, so besagt noch das gegenwärtige Wörterbuch, »der Teil des Landes, den die Natur einem Betrachter darbietet«10, wobei dieser das Land von seiner Perspektive aus einteilt und der Horizont sich in Relation zu seiner Position verändert. Das Subjekt steht, anders gesagt, vor der Landschaft, ihr äußerlich, und bleibt autonom; es kompromittiert sich nicht mit ihr. China sagt statt Landschaft: »Berg(e)-Gewässer« (shan-shui): zugleich das, was nach oben ragt (der Berg), und das, was nach unten drängt (das Wasser); oder das, was unbewegt und regungslos bleibt (der Berg), und das, was nicht aufhört, sich zu kräuseln oder zu fließen (das Wasser); oder das, was eine Form hat und ein Relief bildet (der Berg), und das, was seiner Natur nach keine Form hat und sich der Form der Dinge anpasst (das Wasser); oder auch das, was sich frontal dem Blick darbietet (der Berg), und das, dessen Geräusche aus verschiedenen Richtungen an das Ohr dringen (das Wasser) …
Man sagt im Chinesischen aber auch »Wind-Licht« (feng-jing): also einerseits das, was nicht aufhört vorbeizuziehen und zu beleben, aber nicht sichtbar ist (der Wind), und andererseits das, was sichtbar macht und die Lebenskraft fördert (das Licht). Indem sie dies sagt, oder besser noch: macht, benennt die chinesische Sprache stets eine Korrelation von Faktoren, die in Interaktion treten und eine Polarität bilden. »Subjektartiges« ist nicht abwesend, sondern darin quasi eingetaucht: Es ist von Anfang an Teil dieses sich bildenden Spannungsfelds, von dem es sich nicht lösen kann. Anders gesagt: Das Subjekt taucht weder in autonomer Positur auf, wie es die Selbstgenügsamkeit des »Ich denke« exemplifiziert, noch projiziert es seinen Standpunkt auf die Welt, indem es diese von seiner Abgehobenheit her wie ein Panorama entrollt und als Objekt setzt (»vor« sich »hingeworfen«: »ob«-»jekt«), auf das der Blick stößt und das sich ganz souverän »ob-servieren« lässt. Landschaft verdankt sich demnach nicht der Initiative eines Subjekts, wie es der berühmte Anfang von Descartes einführt, sondern begreift sich als wechselseitiger Einsatz wirksamer, sich sowohl gegensätzlich als auch komplementär erweisender Vermögen, in dem »Subjektartiges« impliziert ist. Situation bezeichnet vorläufig einmal dieses Netz unbegrenzter Implikationen, in dessen Rahmen sich jeder unmittelbar erfasst, dessen Konfiguration sich durch verschiedene Spannungsfelder abzeichnet und aus dem man sich nur durch Abstraktion befreit.
– 2 –
Nun könnte man den Gedanken von Situation weiter entfalten, und zwar im Rückgriff auf den chinesischen Terminus, von dem ich ausgegangen bin und der, indem er den Gegensatz von Statischem und Dynamischem auflöst, anfänglich, in den Kriegskünsten des alten China, das Potenzial der auszunutzenden Situation bezeichnete (shi, übersetzt sowohl mit »Bedingung« als auch mit »Entwicklung«). Der hier sich öffnende Abstand ist zweifach: Einerseits wird die Situation von Anfang an als das eingebrachte Vermögen verstanden; andererseits wird sie ganz ursprünglich angegangen, nicht spekulativ, sondern dem Gebrauch oder der Funktion entsprechend, die sich aus ihr herleiten. Übrigens übersetze ich diesen chinesischen Terminus vor allem in Bezug auf ein gleichnamiges Theorem der europäischen Physik, das uns lehrt, mit welcher Kraft das Wasser, entsprechend der Masse des gestauten Volumens und der Neigung des unter ihm befindlichen Grundes, abfließen wird.
Nun ist das genau dasselbe Bild, das man zu Beginn im Sunzi11 findet: Der gute General, so heißt es dort, manövriert seine Truppen so wie das auf einer Anhöhe aufgestaute Wasser, dem man plötzlich einen Durchbruch verschafft – es wird alles auf seinem Weg mit sich fortreißen. Die Strategie besteht, anders gesagt, in nichts anderem als der Nutzung einer günstigen Situation, die man schrittweise so zu verändern vermag, dass daraus eine vorteilhafte Neigung entsteht, aus der die Wirkung ohne weitere Anstrengung hervorbricht und sich wie von selbst ergibt.
Sobald sich die Situation nicht nur als ein Rahmen bzw. Kontext erweist, sondern aktiv als ein Potenzial, restrukturiert sich bei der Gelegenheit auch ihre Beziehung zu einem »Subjekt«. Der Stratege wird dann nicht mehr derjenige sein, der im Hinblick auf seine Ziele einen Plan auf die Situation projiziert, indem er zuerst seinen Verstand zur Erfassung des Sollzustands mobilisiert und sodann seinen Willen gebraucht, um diesen zu verwirklichen (mit alledem, was dieses »Verwirklichen« an Erzwungenem impliziert) – »Verstand« und »Wille«, das waren die zwei wichtigsten Fähigkeiten des Subjekts im klassischen Zeitalter in Europa. Dagegen ist der wahre Stratege derjenige, der die konkrete Situation, in der er sich befindet und die nicht nur eine ist, die er sich in seinem Geist idealiter vorgestellt hat, umfassend einzuschätzen weiß, d. h. dass er sich aus ihr sowohl zu befreien als auch die günstigen, »zukunftsträchtigen« Faktoren aufzudecken versteht, mit deren Hilfe er kontinuierlich und für die anderen unmerklich an Neigung gewinnen und so die Situation zu seinen Gunsten verändern kann.
So gesehen muss die Effizienz nicht ausschließlich von mir herrühren, dem konzipierenden und wollenden Subjekt der Initiative, das einen Idealplan konstruiert, um ihn dann, entsprechend dem guten alten Verhältnis von Theorie und Praxis, von dem Europa noch immer nicht losgekommen ist, in beharrlicher Verbissenheit in die Tat umzusetzen. Effizienz kann direkt aus der Situation hervorgehen, wenn ich das für mich günstige Potenzial in ihr zu diagnostizieren vermag und schrittweise auszunutzen weiß. Die Situation wird dann nicht mehr diese störrische und widerständige Gegebenheit sein, der ich meinen bereits zuvor ausgearbeiteten Plan aufzwingen muss, sondern eine Goldmine, deren Adern ich erkunden werde, ein Feld von Ressourcen, dessen Furchen ich wie einem Netz verschiedenster Opportunitäten folge, auf denen ich zu »surfen« lerne. »Surfen« oder nach, wie man sagt, »tragfähigen« Faktoren suchen: Man wird eines Tages diesen der Erfahrung entsprungenen Vorstellungen mehr Augenmerk schenken müssen, experientia reclamante, bildlichen Vorstellungen von dem, was nicht mehr aktiv oder heroisch, sondern nachgiebig-weich und fließend ist, und sie in unser Reflexionsfeld einbeziehen. Deshalb lehrt uns das Sunzi gleich zu Beginn, das Potenzial der zwischen meinem Gegner und mir entstandenen Situation »zu bewerten« (»einschätzen« ist die alte Bedeutung von ji), und zwar so, dass ich Punkt für Punkt herausfinde, zu wessen Gunsten oder Ungunsten sich die Faktoren neigen, die sich darin zusammenfügen (auf welcher Seite das Verhältnis zwischen Fürst und General oder zwischen Fürst und Volk besser ist; oder auf welcher Seite die Spione besser sind usw.). Statt also einen Plan aufzustellen, zeichne ich ein Diagramm der infrage kommenden Faktoren und Vektoren, wobei es darauf ankommt, dass ich vor Aufnahme des Kampfes das Potenzial der Situation massiv zu meinen Gunsten verändere. Wenn ich dann endlich den Kampf aufnehme, habe ich bereits gewonnen; der Feind ist bereits besiegt.
– 3 –
Wenn ich nun auf die europäische Lexik zurückgreife, so bezeichnet »Situation« »die Gesamtheit von Umständen, in denen man sich befindet« – so als wäre das ausreichend. »Umstände« zerstückeln jedoch die Situation endlos durch den Plural, der unterteilt und aneinanderreiht (räumlich, zeitlich, je nach Gesichtspunkt usw.). Des Weiteren ist Umstand [circonstance] ein schwacher Begriff, als letzte Fallstufe im Lateinischen gereiht, dessen europäisches Bedeutungsfeld zur Genüge seinen nebensächlichen und zusammengesetzten Charakter zu erkennen gibt. »Circon«-»stance« (ebenso peri-stasisπερί-στασις im Griechischen, *Um-stand im Deutschen): Der Umstand ist das, was »rundherum« »steht«. Aber worum herum, wenn genau genommen doch die Perspektive eines souveränen Subjekts es ist, die von vornherein dominiert? Weit davon entfernt, so neutral zu sein, wie es den Anschein hat, ist *Um-stand ein Terminus, der, zu Unrecht, zugleich stabilisiert und an den Rand drängt, wobei sich das Subjekt wie eine Insel präsentiert, gegen die eine strömende Flut von Umständen brandet. Auch sind, so stellte Clausewitz fest, die Umstände unweigerlich eine Quelle von »Reibung«, tauchen sie doch unerwartet vor dem bereits zuvor ausgearbeiteten Plan auf und sind schuld daran, dass dieser sich zunehmend als fehlerhaft erweist und auf Schwierigkeiten stößt.12 Denkt man nun die Situation als Potenzial, so macht man aus diesem Negativen genau das Gegenteil und dreht es um: Statt dass sich der eintretende Umstand wie ein Hindernis aufstellt, das die Modellvorstellung außer Kontrolle geraten lässt, ist es die Entwicklung der Situation und ihre Erneuerungsdynamik (was der Terminus shi besonders stark zum Ausdruck bringt), auf die ich mich, da mein Geist von keiner Projektion eingeengt ist, unaufhörlich stütze, um dieses Situative zu meinem Gunsten zu neigen und immer mehr davon zu profitieren.
Man kann daraus ohne Schwierigkeiten Schlussfolgerungen auf operationeller Ebene und für jede Art von »Management« ziehen. Von nun an muss man sich genauso wenig über den »Zufall« oder das »Glück« den Kopf zerbrechen, sich vor Göttern und einem Schicksal fürchten oder Weissager aufsuchen, wie mit einem »Geniestreich« rechnen – das ist das andere große Loch unserer Subjekt-Rationalität: wenn man alle vorgefassten Pläne fallen lässt und unmittelbar auf die auftauchenden Umstände reagiert. Der Sieg wird immer nur das Resultat des anerkannten Situationspotenzials sein, oder wie Sunzi das ganz kurz und bündig sagt: Im Krieg »weicht es nicht ab« (bu te). Das bedeutet, dass die Schlacht gewonnen ist, noch bevor der Kampf begonnen hat, während die besiegten Truppen jene sind, »die den Sieg einzig im Augenblick des Kampfes« zu erringen suchen, in der Hoffnung, durch die Aufbietung aller Kräfte einen Erfolg zu erzielen. Daraus kann letztendlich gefolgert werden, dass der (wirklich) gute Stratege derjenige ist, dessen Strategie man erst gar nicht bemerkt und den zu »loben« einem gar nicht einfällt: ihn, der es im Vorfeld so gut verstand, die Erfolg versprechenden Faktoren ausfindig zu machen und für die kontinuierliche Entwicklung des Situationspotenzials zu seinen Gunsten zu sorgen, sodass alle meinen, wenn er schließlich den Sieg davongetragen hat, sein Erfolg wäre »leicht« zu erringen und ohne Verdienst gewesen, so sehr scheint er von der Situation herbeigeführt worden und von vornherein eine ausgemachte Sache gewesen zu sein. Dieses »ohne Verdienst« ist die große Leistung und das, was das dem Ruhm hörige Subjekt verdrießen kann. Man versteht, weshalb China kein Epos verfasst hat.
Es klärt sich nun schon einigermaßen, was es mit einer Situation auf sich hat, wenn man sie von ihrem Status des ebenso Zufälligen wie Umstandsbezogenen löst. Oder, um es zunächst negativ zu formulieren: Ich befinde mich nicht »in« einer Situation wie an einem Ort – in einer »Lage«, nicht einmal wie ein Kapitän auf seinem Schiff, um den berühmten Vergleich einmal anders zu verwenden; die Situation ist auch nicht so etwas wie ein »Akzidenz« im Hinblick auf die Essenz oder die Substanz eines Ich-Subjekts. Es ist übrigens auch die Grammatik unserer Sprachen in Europa, also deren zwingendes System der Rektion und der Präpositionen sowie insbesondere die Morphologie mit ihren Fällen, die die Umstandsmodi als Letzte unter den Ergänzungen einreiht. Nun befinde ich mich aber durch das Situative, das dem Faktum meiner Existenz inhärent ist, stets in einem Spannungsfeld verschiedener Faktoren und Vektoren, das sich durch deren Korrelation notwendigerweise verwandelt, zu dem ich daher selbst in ständiger Interaktion stehe und das als solches »mich« im Gegenzug konstituiert. Die Autonomie oder Unabhängigkeit ist nicht mehr ein absolutes Prädikat, sondern gilt nur als Handlungsspielraum, dem entsprechend man sein Verhalten steuert, ohne dass sich davon radikal eine »reine« »Absicht« abheben könnte, ein »guter« oder »schlechter« Wille, der alles Vorgegebene abrupt transzendiert.
Man wird nun auch besser verstehen, weshalb das chinesische Denken – das in Termini wie Aktualisierung und Konfigurierung (im Begriff von xing), wie Neigung und Situationspotenzial (im Begriff von shi) und in den hinter diesen Begriffen stehenden Termini von Fließen und Energie denkt und nicht in solchen von Sein oder Handeln, die beide zusammengehören –, das Einzige ist, das sehr früh eine Konzeption des Strategischen ausgearbeitet hat. Clausewitz konnte zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur das Scheitern des (europäischen) Denkens beim Versuch, den Krieg denkend zu erfassen, feststellen, da Letzterer ein Phänomen ist, das »lebt und reagiert«, wie er eingesteht; das nicht nur von Seiten eines inselartigen Subjekts gemacht werden kann, sondern von Beginn an einen Gegner impliziert. Eben weil es in Termini der Polarität denkt, fällt es China dagegen leicht, ihn zu denken. Zugleich versteht man, warum das grundlegende Buch der chinesischen Kultur das Buch der Wandlungen ist, ein »Buch« ohne logos oder mythos, ohne argumentierende Rede und ohne Erzählung oder Botschaft; ein Buch, das zunächst einmal nur aus zwei Arten von Linien, durchgehenden und unterbrochenen, harten und weichen, yang oder yin besteht, die, zu Figuren aufeinandergeschichtet, darstellen, welche Polarität gerade am Werk ist. Diese Figuren, die sich von der einen in die andere verwandeln, symbolisieren ebenso viele Situationen, die sich, Linie für Linie, wie von selbst in ihrer Evolution lesen lassen. Mit diesen Figuren versucht man – eine alte Frucht der Mantik –, herauszufinden, wie jede Situation von selbst dazu führt, einzig durch das Spiel der Faktoren (einzig durch die interne Beziehung dieser Striche), sich »günstig« oder »ungünstig« zu kippen. Es braucht allerdings, um sich auf das Spiel dieser Energien einzulassen und mit diesen Figuren in gleiche Schwingung zu treten, etwas, das ich – eine Bresche in unser Vokabular schlagend – nicht anders denn als »Disponibilität« (im Sinne einer »Aufnahmebereitschaft« oder auch »Verfügbarkeit«) zu nennen vermag. Die Initiative und der Wille werden also suspendiert. Denn es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als in Korrelation zur Ontologie des Seins – die der Erkenntnis als Grundlage dient – zu versuchen, die Ontologie des Subjekts – die der Freiheit als Sockel dient – auseinanderzunehmen.
III
Dispositionalität (vs. Freiheit)
– 1 –
Disponibilität ist ein Begriff, der im europäischen Denken unterentwickelt geblieben ist. Er betrifft in erster Linie Güter, Vermögen oder zur Verfügung stehende Leistungen. Dagegen hat er im Hinblick auf das Ich-Subjekt kaum Konsistenz gewonnen. Allenfalls bei Gide findet man die Aufforderung, jede Neuerung solle uns stets voll und ganz disponibel finden. Der Begriff Disponibilität kann weder dem Bereich der Moral noch jenem der Psychologie zugeordnet werden, er ist weder präskriptiv – und wenn schon, so wüsste man nicht, was er vorschriebe –, noch deskriptiv (erklärend), kann also weder als eine Tugend noch als eine Fähigkeit gedacht werden – und das sind doch tatsächlich die zwei großen Pfeiler oder wichtigen Bezugspunkte, auf denen in Europa unsere Auffassung des Subjekts beruht. Demnach sieht sich dieser Begriff auf der Stufe einer vagen Anweisung belassen, oder er gleitet in Subjektivität und deren leichte Erregbarkeit ab, genau das, wovon Gides Ausspruch handelt. Er ist, kurz gesagt, nicht in eine effektive Konstruktion unserer Innerlichkeit miteinbezogen. Man kann wohl in der Umgangssprache auf ihn Bezug nehmen, ihn einfließen lassen in die Banalität unserer Sätze als einen Appell an den gesunden Menschenverstand, hastig, zwischen zwei Türen, aparté – und vielleicht kann man ohne ihn gar nicht auskommen. Tatsache ist, dass man kaum darüber hinausgeht. Die Möglichkeit, dass man, diesem Faden folgend, daraus eine eigenständige, sowohl ethische als auch kognitive Kategorie ausarbeitet, wurde nicht entwickelt.
Weshalb diese Unterentwicklung? Wäre es nicht gerade deshalb, weil wir, um der Disponibilität als einer ethischen und kognitiven Kategorie Geltung zu verschaffen, zunächst unsere Auffassung von ethos grundlegend ändern müssten, indem wir von dem Tandem, bestehend aus Moral und Psychologie, aus Tugend und Fähigkeiten, absteigen? Heimlich, ohne viel Aufhebens, ganz beiläufig zwischen unsere Sätze eingeflossen, hat dieser Begriff eine lautlose Revolution losgetreten. Er unterminiert das Gerüst, mit dessen Hilfe wir uns eine Vorstellung von uns machen: Das Subjekt begreift sich mit ihm nicht in erhabener, sondern in hohler Form. Auf diese Weise ruft er zu einem tieferen, ursprünglicheren Umsturz auf als alle bisher angekündigten Wertumkehrungen. Es geht für das Subjekt hier tatsächlich um nichts weniger als darum, auf seine Initiative als »Subjekt« zu verzichten – jenes Subjekt, das zunächst und zuallermeist vorwegnimmt und plant, auswählt, entscheidet, sich Ziele setzt und sich mit Mitteln versieht, diese zu erreichen. Wenn es nun für einen Moment auf seine Kontrollgewalt verzichtet, wozu die Disponibilität einlädt, so deshalb, weil es befürchtet, dass diese Initiative, auf die es pocht, ein Hindernis und unangebracht sein könnte; dass sie es »Gelegenheiten« verpassen lässt, es auf ein fruchtloses Gespräch mit sich selbst festnagelt und nicht weiter gelangen lässt. Wohin aber gelangen? Eben, es weiß gar nicht »wohin«. Das Subjekt kann aber auf seine Mitgift verzichten, dem ihm Eigenen und »Vertrauten« misstrauen, wenn es ahnt, dass die sich selbst verliehenen Vorrechte, angenietet an ihm selbst, es durch Grenzen, die es nicht einmal ahnungsweise wahrnimmt, festsetzen.
So versteht man bereits, dass es sich hier nicht um eine Kategorie des Aufgebens, um irgendeine Einladung zu passiver Haltung handelt, sondern vielmehr um das Gegenteil des Solipsismus und des mit ihm verbundenen Aktivismus. Es geht auch nicht darum, sich einer anderen Macht (einem anderen Subjekt) auszuliefern oder, noch anders, die Herrschaft Gott zu übertragen, wie das die Quietisten so gut zu tun verstehen. Stattdessen ist dieses Loslassen der Disponibilität ein Erfassen, und zwar ein viel geschickteres, nicht eingezwängtes, sondern unablässig fließendes: Der Begriff ist zugleich ethisch und strategisch. Ein umso effizienteres »Erfassen«, da es sich nicht mehr lokalisieren, nicht mehr spezifizieren lässt, sich nicht mehr aufdrängt. Es wird umso kontinuierlicher angepasst, als es auf nichts mehr abzielt, weshalb es niemals enttäuschen kann oder hilflos wird; es ist weder verwirrt noch zersplittert. Es ist ein umso umfangreicheres »Erfassen« – oder kennt, genauer gesagt, keine Grenzen oder Endpunkte mehr – aus dem einfachen Grund, weil es sich keine zu verfolgende Bahn, kein zu erreichendes Ziel, keinen zu erfüllenden Ertrag, keinen in den Griff zu bekommenden Gegenstand vorschreibt. Dieses Erfassen durch Loslassen ist nicht mehr orientiert, das Subjekt projiziert nicht mehr. Es trägt keinen Schatten mit sich, wird nicht mehr von einer Absicht geleitet, hat also zu allem einen gleichen Abstand. Sein Erfassungsvermögen ist weit offen, weil es nichts zu erfassen erwartet.
Man muss diesen Terminus entsprechend der Ressource verstehen, die sich in seiner Zusammensetzung erkennen lässt. In dem Dis- der Disponibilität steckt nicht nur die Auslöschung jeglicher Opposition, sondern mehr noch die völlige Brechung jeglicher Position und in der Folge sogar ihrer Selbstauflösung. Ebenso wie sprichwörtlich jede Bestimmung auch Verneinung ist, ist jede Position zugleich der Verlust aller möglichen anderen. Jede Position ist eine im-position. Wenn nun Disponieren besagt, dass eine gewisse Ordnung und Verfahrensweise angenommen werden soll, so nimmt die Disponibilität jegliche starre und fokussierende Modalität davon zurück, indem sie diese durch die von ihr eröffnete Kompossibilität elastisch macht. Die Offenständigkeit ist nicht mehr ein frommer Wunsch, irgendein Surrogat des von Befreiung durch Entschleierung träumenden Metaphysischen und Religiösen (ein heute sehr häufiges Thema); sie konkretisiert sich vielmehr effektiv in Einstellung und Verhaltensweise oder, noch genauer, als Strategie. So gesehen können Tugenden und Fähigkeiten in der Folge tatsächlich nur als Aufsplitterung und Verlust erscheinen. Indem sie sich nur im Verhältnis zueinander spezifizieren, behaupten sie sich jeweils auf Kosten von anderen; die Selbstbehauptung wiederum, die sich von vornherein eine Autonomie anmaßt, gelingt nur unter zwingendem Druck. Nun vermischt, man könnte auch sagen: versteht die Disponibilität diese Pluralität von Verschiedenheiten als ein und dieselbe gleichwertige Potenzialität; zugleich bleibt sie diesseits jeglicher Angestrengtheit und Konfrontation, da sie weder etwas fixiert noch in Gegensatz zu anderem bringt.
Da der Erkenntnisvorgang nicht mehr zielorientiert ist, wird er in der Disponibilität zu einer besonderen Wachsamkeit, die sich durch nichts, was sie in Beschlag nehmen könnte, ablenken lässt, oder zu einer Fähigkeit, die sich nicht mehr kodifizieren und auch nicht als Aufgabe zuweisen lässt, sich jedoch völlig anzupassen und ohne Verluste zu entdecken vermag, da sie nichts ausschließt und sich auf nichts versteift. Man versteht, dass sich das abendländische Denken einer solchen Fähigkeit zur »Öffnung« widersetzte, bevorzugte es doch die Figur eines autonomen Subjekts, dessen innere Strukturierung als auf Begabungen – als dessen Eigenschaften – beruhend gedacht wurde, d. h. fernab vom Lauf der Welt, es sei denn, man behandelte sie im Gegenzug und zum Ausgleich auf einer mystischen Ebene. Gleichzeitig versteht man, dass es besser wäre, eine derartige Disponibilität als eine Vorgehensweise zu begreifen, ohne in einen Quietismus zu verfallen, in ihr das Ethische (oder Theoretische) und das Strategische oder, wie das insgesamt für das chinesische Denken der Fall ist, die Weisheit von der Effizienz nicht mehr voneinander zu trennen. Während die Disponibilität im europäischen Denken ein noch stammelnder Begriff ist, der nur am Rande seiner Theoriebildungen auftaucht, erweist sie sich in China als der Grundstock [fond] des Denkens selbst.
– 2 –
Kaum betritt man den Boden chinesischen Denkens, muss es einen frappieren, dass das, was ich hier unter Disponibilität verstehe, dort nicht den Gegensatz zu den auf unseren Fähigkeiten beruhenden kognitiven Verfahrensweisen bildet, sondern ihre eigentliche Grundlage bildet; oder dass die Disponibilität – weit davon entfernt, ein im embryonalen Stadium steckengebliebener Begriff zu sein, der bestenfalls als umgangssprachlich formulierte Ermahnung durchgeht, als ein Sicherheitsventil für unsere strengen Vorschriften, wie eine notwendige Nachlässigkeit und privatim zugeflüstert –, das eigentliche Grundprinzip des Verhaltens eines Weisen ist, aus dem sich alle Tugenden herleiten. Allerdings ist sie ein prinzipienloses »Prinzip«, denn die Disponibilität als ein Prinzip aufzustellen, hieße, ihr zu widersprechen. Die Disponibilität ist eine Disposition ohne bestimmte Disponiertheit. Darüber sind sich alle chinesischen Denkschulen einig, gleich, von welcher Seite her sie die Dinge angehen, und das seit dem Altertum (was ich als einen Grundstock einvernehmlichen Denkens bezeichne). Ich würde sogar allzu gerne die Lehre des chinesischen Denkens wie folgt resümieren: Weise ist, wer zur Disponibilität gelangt – das ist genug. Deshalb erstaunt uns das chinesische Denken mit seinem Antidogmatismus (wobei man nicht vergessen darf, dass dieser sozial durch eine Ritualisierung kompensiert wird).
So heißt es in diesem Spruch aus den Gesprächen (Lun Yu) des Konfuzius, mit dem ich einen früheren Essay begann: »Von vier Dingen war der Meister völlig frei: Er war ohne (bevorzugte) Idee, ohne (vorherbestimmte) Notwendigkeit, ohne (starre) Position, ohne (partikuläres) Ich.«13 Das chinesische Offensichtliche, also das, was nicht infrage gestellt wird, ist dies: Eine Idee zu haben, oder besser gesagt: eine Idee vorzubringen, bedeutet bereits, andere im Schatten zu belassen, d. h. einen Aspekt auf Kosten anderer zu bevorzugen und damit zugleich in Parteilichkeit abzugleiten. Jede vorgebrachte Idee ist zugleich eine Einseitigkeit, die verhindert, die Dinge in ihrer Gesamtheit auf derselben Ebene und in gleicher Weise zu betrachten. Wir betreten damit das Feld der Bevorzugung und Voreingenommenheit. Man muss den Spruch des Konfuzius zusammenhängend lesen: Wenn man eine »Idee« vorbringt, drängt sich uns eine »Notwendigkeit« auf (ein auf das Verhalten projiziertes »Es muss«); infolge dieses »Es muss«, an dem man hängt, gelangt man zu einer festen Position, in der der Geist stecken bleibt und aufhört, sich weiterzuentwickeln; schließlich ergibt sich aus dieser Positioniertheit so etwas wie ein »Ich«: ein in eingefahrenen Spuren verlaufendes Ich, das Charakter zeigt. Dieses »Ich«, festgefahren in seiner »Position«, hat seine Disponibilität verloren. Dabei schließt sich auch dieser Kreis der Formulierung: Das Verhalten erstarrt zu einem Ich, dieses Ich schlägt eine bestimmte Idee vor, diese drängt sich als »Notwendigkeit« auf usw.
In den Gesprächen des Konfuzius wimmelt es nur so von Sprüchen dieser Art: Der edle Mensch ist »vollständig«14, d. h. er verliert das Globale nicht aus den Augen, lässt nicht zu, dass das Feld alles Möglichen einseitig schrumpft. Er ist »nicht unbedingt dafür oder dagegen«, sondern »neigt dem zu, was die Situation erfordert«.15 Oder wie Konfuzius von sich selbst sagt: »Nichts ist für mich möglich oder unmöglich«.16 Mit anderen Worten: Der Weise hält sich alle Möglichkeiten offen, schließt keine a priori aus und verbleibt im Kompossiblen. Daher ist er ohne Charakter und man kann ihm keine Eigenschaften zuschreiben. Seine Schüler wissen nicht, was sie über den Weisen sagen könnten.17 Man könnte die Weisen in Kategorien unterteilen: die Kompromisslosen einerseits, die sich weigern, sich die Hände auch nur im Geringsten für das Wohl der Welt schmutzig zu machen, und andererseits jene Entgegenkommenden, die, um die Welt zu retten, zu einigen Zugeständnissen bereit sind.
Wo aber würde Konfuzius hingehören? Ist er kompromisslos? Ist er entgegenkommend? Wo kann man ihn in dieser Typologie einordnen, welche »Position« kann man ihm zuschreiben? Menzius wird lakonisch antworten: »Von der Weisheit verkörpert er den Moment.«18 Er ist so unnachgiebig wie die Unnachgiebigsten, wenn die Umstände es erfordern, so entgegenkommend wie die Entgegenkommendsten. Er ist dem einen Verhalten nicht mehr verpflichtet als dem anderen, einzig der »Moment« ist entscheidend. Seine »Weisheit« ist ohne einen Inhalt, der sie im Voraus lenkte und festlegte, oder, anders gewendet, sie hat keinen anderen Inhalt als den, sich unaufhörlich erneuernd im richtigen Moment disponibel zu erweisen.
Die »rechte Mitte«, das langweilige Thema schlechthin, könnte mit einem solchen Verständnis endlich ihrem Gebrauch als Gemeinplatz entkommen. Sie gewinnt unerwartet schärfere Konturen. Sie ist nicht mehr trivial, sondern radikal. Sie besteht nicht mehr darin, sich ängstlich und zögerlich, vor Übertreibungen zurückschreckend, auf halbem Weg zwischen Gegenteiligem aufzuhalten – »allzu viel ist ungesund«, wie ein Sprichwort sagt –, sie leitet nicht mehr nur dazu an, sich nicht auf die eine oder andere Seite zu schlagen und nachdrücklich Farbe zu bekennen. Tatsächlich ist das »Mittelmaß« nicht »golden«, wie die goldene Mitte, sondern glanzlos, »grau«. »Die Weisheit ist wie kalte, graue Asche, die die Glut bedeckt«, sagt Wittgenstein.19 Die »rechte Mitte« dagegen heißt für jemanden, der sie in aller Strenge zu denken vermag (wie Wang Fuzhi), das eine ebenso gut wie das andere machen zu können, d. h. zum einen wie zum anderen Extrem fähig zu sein. In diesem »Gleich« des gleichen Zugangs zum einen wie zum anderen liegt dieses »Mittel-Feld« [mi-lieu]. Drei Jahre der Trauer um den Vater sind, so sagt man, nicht zu viel. Aber auf einem Bankett so viele Gläser zu trinken, dass man sie nicht mehr zählen kann, ist auch nicht zu viel. Ich übertreibe in keiner Hinsicht, gehe aber bis zum Äußersten jeder Möglichkeit, erfülle jede Forderung vollständig. Die Gefahr besteht eher darin, sich festzufahren, sich anderen Möglichkeiten zu verschließen und so die Gelegenheit zu versäumen. Im Gegensatz dazu würde die Disponibilität den Fächer aller Möglichkeiten ausgefaltet belassen – weder krampfhaft noch zurückweichend –, um so jeder auftauchenden Anforderung voll entsprechen zu können, d. h. nichts auslassend, nichts vernachlässigend; denn weder ein Charakter noch eine innere Verkrustung stellen sich dieser Formbarkeit entgegen.
Das chinesische Denken hat sehr wohl den Unterschied zwischen »die Mitte halten« und »in der Mitte halten« (an ihr festhalten) gesehen. Wenn es, einer gängigen Einteilung folgend, einerseits solche gibt, die nicht ein Härchen zum Wohl der Welt opfern, und andererseits solche, die bereit sind, sich um deren Rettung willen plattwalzen zu lassen, so würde ein »dritter Mann«, der die Mitte zwischen diesen beiden entgegengesetzten Positionen hält, der Sache »etwas näher« kommen.20 Wenn er aber »an dieser Mitte festhält«, »ohne die Vielfalt der Fälle abzuwägen«, so hieße das letzten Endes, an »einer einzigen Möglichkeit festzuhalten« und damit »hundert andere zu verpassen« und »den Weg seiner Möglichkeiten zu berauben«. Sobald man aber an einer Position festhält, gerinnt ein »Ich«, ein Verhalten verfestigt sich um sich selbst rotierend, irgendein Imperativ oder »Es muss« festigt sich, und man ist nicht mehr im Gleichklang. Der Spielraum wird nicht mehr voll ausgeschöpft, und man reagiert nicht mehr auf die sich anbietende Vielfalt. Die Disponibilität als eine innere Disposition, die sich ohne Disposition dieser Vielfalt öffnet, geht Hand in Hand mit der Gelegenheit, die uns von der Welt in die Hände gelegt wird. Montaigne hat gesagt: Disponibel ist, wer es versteht, »den Umständen entsprechend zu leben«.21
In China hat dieser Gedanke von Disponibilität dazu geführt, dass die Entleerung des Geistes zur eigentlichen Bedingung der Erkenntnis wird. Das chinesische »Erkennen« ist nicht so sehr, sich eine Vorstellung von etwas zu machen, als vielmehr disponibel für etwas zu werden.22 Eine innere Entleerung erfolgt nicht durch den Zweifel, der die Vorurteile eliminiert, sondern durch einen alles erfassenden Verzicht, und zwar weniger auf Verstandes- als auf Verhaltensebene. Von daher rührt das Loslassen, das dem Zugang zu seiner ganzen Weite verhilft. Man muss sich davor hüten, dass der eigene Geist ein »angekommener« Geist (cheng xin) wird, sagt auch Zhuangzi23. Ein angekommener Geist ist steif und gefestigt. Seine Aktivitäten sind in seiner Perspektive paralysiert und eingemauert. Er ist, ohne es zu merken, zu einem Standpunkt geworden. Das erste Erfordernis ist, weder Präferenzen noch Vorbehalte zu haben und alle Dinge »in gleicher Weise« zu behandeln (entsprechend dem Schlüsselwort seines Denkens: qi im »Qi wu lun«). Der Weise, so zeigt Zhuangzi treffend, erachtet alles für gleichbedeutend und muss dazu imstande sein, bis zum undifferenzierten »daoistischen« Grundstock vorzudringen, aus dem alle Unterschiede hervorquellen. Er vermag den kleinsten Unterschied in seiner Opportunität aufzunehmen, ohne ihn zu mindern oder zu verfehlen. Da das »Ich« kein Hindernis mehr darstellt (was dort als »sein Ich verlieren«, wang wo, bezeichnet wird), kann er nun alle Stimmen der Welt in all ihrer Verschiedenheit in ihrem spontanen »Sosein« hören, nach Belieben, ihre einzigartige Entfaltung begleitend (xian qi zi qu).24
– 3 –
Während die Disponibilität also ein Grundbegriff chinesischen Denkens ist, über den sich alle chinesischen Denkschulen einig sind, ohne ihn jemals zu hinterfragen, hat das europäische Denken einige Schwierigkeiten, ihn zu erfassen: Es begegnet ihr nur auf Nebenwegen und hat Mühe, sie auf den Begriff zu bringen. Warum z. B. kommt Freud nur dadurch zu seiner Vorschrift von einer * »gleichschwebenden Aufmerksamkeit«, die für einen Psychoanalytiker im Laufe einer Kur erforderlich sei, dass er »durch eigenen Schaden von der Verfolgung anderer Wege zurückgekommen war«?25 Und ist dieser Ausdruck nicht nahezu widersprüchlich: »Aufmerksamkeit«, aber »gleichschwebend«? Der Geist ist gerichtet, aber auf nichts Bestimmtes, er konzentriert sich auf alles zugleich. Läuft das nicht auf Zerstreuung hinaus? Oder warum besteht bei Heidegger die von ihm gepriesene *»Offenständigkeit«, von der er sagt, dass sie vorprädikativ einem *»Verhalten« gleichkommt, in einem »Sein lassen«, einer *»Eingelassenheit« und einer »ex-sistierenden Ausgesetztheit«? Müsste man sie dann nicht zur Rückkehr unter das Banner der *»Freiheit« zwingen?26 Würde man die Offenständigkeit aber nicht verraten, wenn man zu ihrer Klärung auf unsere wichtigste Kategorie zurückgreift? Um einen seiner eigenen Begriffe aufzugreifen, würde ich hier eher eine »Verkapselung« sehen, der seine phänomenologische Analyse eigentlich zu entkommen suchte – und hat das nicht auch viele Kommentatoren stutzig gemacht?
Sollte man nicht besser den Abstand noch erweitern und bedenken, dass die europäische Schwierigkeit, die Disponibilität zu denken, nur im Hinblick auf die Freiheit – den mit ihr rivalisierenden Begriff, der in Europa vorherrschte und ihre Entwicklung blockierte – verständlich wird? Wenn heute viele chinesische Intellektuelle ein Denken von Freiheit (ziyou, ein aus dem Westen übersetzter Terminus) angesichts des chinesischen Denkens vor der Verwestlichung fordern (vor allem was das Zhuangzi anlangt), wobei sie das, was ich soeben »Disponibilität« nannte (zizai würde ich das ins Chinesische übersetzen), unter diesen Terminus einordnen, so handelt es sich da nicht um einen terminologischen Disput, sondern um eine Logik von Begriffen. Ich würde diesen Gegensatz sogar bis zur gegenseitigen Ausschließung vorantreiben: Europa hat die Ressourcen von Disponibilität deshalb verkannt, weil es den Gedanken von Freiheit entwickelt hat, und umgekehrt trifft das auch für China zu. Sind die beiden Begriffe nicht in Wirklichkeit antagonistisch bis hin zum Widerspruch und eben nicht synonym, wie man das gewöhnlich annimmt? Die Freiheit reklamiert für sich einen Bruch mit der Situation, in die sich das Ich verwickelt findet, und es ist erst diese Emanzipation, die das Ich auch zu einem »Subjekt« erhebt, das sich eine Initiative anmaßt. Die Freiheit fordert das Subjekt dazu auf, sich von den ihm auferlegten Bedingungen durch die Macht der Negation wegzureißen (die Stärke des Negativen, auf das sich das Subjekt beruft). Sie propagiert dieses Ideal, anders gesagt, durch eine Trennung von der Ordnung der Welt, nicht durch eine Öffnung zu ihr hin.
Vielleicht muss man weiter unterscheiden, was die Griechen »Freiheit« nannten. Einerseits ist sie die Möglichkeit, zu machen, was mir nach Belieben und ohne Behinderung gefällt (exousiaἐξουσία). In diesem Sinne ist Freiheit ganz selbstverständlich in verschiedensten Kulturen, einschließlich der chinesischen, zu finden. Man könnte sogar sagen, dass das chinesische Denken diese Bedeutung ganz besonders entfaltet und angereichert hat (xiao yao you, das erste Wort des Zhuangzi