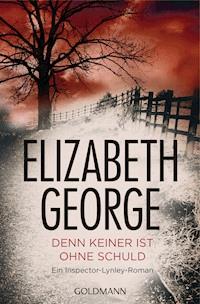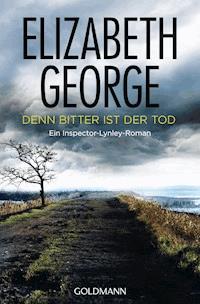
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
"Elizabeth George ist die Meisterin des englischen Spannungsromans." New York Times
An einem trüben Novembermorgen wird eine Studentin der Universität Cambridge tot aufgefunden. Der Mord an der jungen Frau erschüttert die ehrbare Akademikerwelt. Und nur einer wie Inspector Lynley, der dieses Umfeld bestens kennt, kann die gefährlichen unterschwelligen Strömungen hinter den dunklen Collegemauern erahnen. Mit seiner Assistentin Barbara Havers dringt er immer tiefer in die elitäre Welt ein, in ein tödliches Gespinst aus bedingungsloser Liebe, falschem Stolz, uneingestandenen Schuldgefühlen – und dem Bedürfnis nach Rache.
Der fünfte Fall für Inspector Lynley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Als Elena Weaver, Studentin am ehrwürdigen St. Stephen’s College in Cambridge, in den frühen Morgenstunden eines Novembertages wie gewohnt zum Joggen aufbricht, ahnt sie nicht, dass sie in wenigen Minuten sterben wird. Der Mord an der jungen Frau erschüttert die ruhige Universitätsstadt. Da die örtliche Polizei mit der Untersuchung des Todesfalls überfordert ist, schickt man aus London Inspector Thomas Lynley. Als Oxford-Absolvent ist er bestens mit den komplexen Abläufen an einer Elite-Universität vertraut, und zusammen mit seiner Assistentin Barbara Havers nimmt er umgehend die Ermittlungen auf. Das Opfer Elena Weaver war eine attraktive Erscheinung, die es verstand, mit den Waffen einer Frau umzugehen. Elena hatte nur eine Besonderheit: Sie war gehörlos. Eine Tatsache, mit der ihre Eltern sich nicht abfinden konnten. Elenas Mutter zog sich verbittert zurück, während ihr Vater, eine Koryphäe unter Cambridges Historikern, eine Musterschülerin aus seiner Tochter machen wollte. Doch Elena wollte ihr eigenes Leben führen, ein zügelloses Leben, das sie in die Arme verschiedener Männer führte – und schließlich in den Tod. Vor Lynley und Havers tut sich ein Labyrinth aus blinden Fährten und Sackgassen auf, aus verletzten Gefühlen, falschem Stolz und blindem Rachebedürfnis.
Elizabeth George
Denn bitter ist der Tod
Ein Inspector-Lynley-Roman
Deutsch von Mechthild Sandberg-Ciletti
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »For the Sake of Elena« bei Bantam Books, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.
Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Copyright © der Originalausgabe 1992 by Susan Elizabeth George
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1993 by Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Christine Amat / Trevillion Images
NG · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-12031-3V005
www.goldmann-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Für meine Elternin Dankbarkeit für ihre unermüdlicheund verständnisvolle Unterstützung
Dawn snuffs out star’s spent wick,Even as love’s dear fools cry evergreen,And a languor of wax congeals the veinNo matter how fiercely lit.
Neuer Morgen löscht den Docht des Sterns – verbraucht, Genau wenn Liebesnarren treu ›auf immer‹ schrei’n, Und die Ader erstarrt in trägem Wachs, Egal wie grell zuvor der Schein.
SYLVIA PLATH
1
Elena Weaver erwachte, als das zweite Licht im Zimmer anging. Das erste, dreieinhalb Meter entfernt, auf ihrem Schreibtisch, hatte nur bescheidenen Erfolg gehabt. Das zweite Licht jedoch, das ihr aus einer Schwenkarmlampe auf dem Nachttisch direkt ins Gesicht schien, war so wirkungsvoll wie ein Fanfarenstoß oder Weckerrasseln. Als es in ihren Traum einbrach – höchst unwillkommen in Anbetracht des Themas, mit dem ihr Unbewußtes gerade beschäftigt war –, fuhr sie mit einem Ruck aus dem Schlaf.
Sie hatte die ersten Stunden der vergangenen Nacht nicht in diesem Bett, nicht in diesem Zimmer zugebracht und war darum im ersten Moment verwirrt, verstand nicht, wieso die einfachen roten Vorhänge gegen diese häßlichen Dinger mit dem gelb-grünen Blumenmuster ausgewechselt worden waren. Das Fenster war auch am falschen Platz. Genau wie der Schreibtisch. Es hätte überhaupt kein Schreibtisch hier sein dürfen. So wenig wie der Kram, der auf ihm herumlag, lose Blätter, Hefte, aufgeschlagene Bücher.
Erst als ihr Blick auf den PC und das Telefon fiel, die ebenfalls auf dem Schreibtisch standen, erkannte sie, daß sie in ihrem eigenen Zimmer war. Allein. Sie war kurz vor zwei nach Hause gekommen, hatte sich sofort ausgezogen und erschöpft ins Bett fallen lassen. Sie hatte also ungefähr vier Stunden geschlafen. Vier Stunden ... Elena stöhnte. Kein Wunder, daß sie nicht gleich gewußt hatte, wo sie war.
Sie wälzte sich aus dem Bett, schob ihre Füße in weiche Pantoffeln und schlüpfte fröstelnd in den grünwollenen Morgenmantel, der achtlos hingeworfen neben ihrer Jeans auf dem Boden lag. Der Stoff war alt und abgenützt, angenehm weich vom vielen Getragenwerden. Ihr Vater hatte ihr vor einem Jahr zu ihrer Immatrikulation in Cambridge einen eleganten Seidenmorgenmantel geschenkt – eine ganz neue Garderobe hatte er ihr geschenkt, die sie jedoch größtenteils ausrangiert hatte –, aber sie hatte ihn nach einem ihrer häufigen Wochenendbesuche bei ihm zurückgelassen. Um ihm einen Gefallen zu tun, trug sie ihn, wenn sie in seinem Haus war, aber sonst nie. Es wäre ihr nicht eingefallen, ihn zu Hause in London bei ihrer Mutter anzuziehen und ebensowenig im College. Der alte grüne war ihr lieber. Er war weich wie Samt auf ihrer Haut.
Sie ging durch das Zimmer zu ihrem Schreibtisch und zog die Vorhänge auf. Draußen war es noch dunkel. Der Nebel, der seit fünf Tagen schwer und bedrückend über der Stadt lag, schien an diesem Morgen noch dichter zu sein. Er überzog die Fensterscheiben mit perlender Feuchtigkeit. Auf dem breiten Fensterbrett stand ein Käfig mit Futternapf und Trinkflasche, mit einem Laufrad in der Mitte und in einer Ecke einem alten Socken, der zum Nest umfunktioniert war. In dem Socken zusammengerollt, lag ein kleines sherryfarbenes Pelzbündel.
Elena klopfte mit den Fingern leicht an die kühlen Stäbe des Käfigs. Sie schob ihr Gesicht so nahe, daß sie die Gerüche von zerrissener Zeitung, Sägespänen und Mäusekot wahrnehmen konnte und blies sachte in Richtung Nest.
»Ma-us«, sagte sie. Wieder klopfte sie an die Gitterstangen. »Maa-us!«
Das Mäuschen hob den Kopf und öffnete ein blitzendes dunkles Auge. Witternd hob es den Kopf.
»Tibbit!« Elena lachte das kleine Tier mit den aufgeregt zuckenden Schnurrhaaren an. »Gut’n Morg’n, Ma-us.«
Die Maus kroch aus ihrem Nest und flitzte ans Gitter, um, in offenkundiger Erwartung eines Morgenimbisses, Elenas Finger zu beschnuppern. Elena öffnete die Käfigtür und hielt das kleine Bündel ungeduldiger Neugier einen Moment auf ihrer flachen Hand, ehe sie es auf ihre Schulter setzte. Die Maus knabberte versuchsweise an dem langen, glatten Haar, das die gleiche helle Farbe hatte wie ihr Fell, dann kroch sie weiter und machte es sich unter dem Kragen des Morgenrocks an Elenas Hals bequem. Dort begann sie sich zu putzen.
Elena hatte den gleichen Gedanken. Sie zog den Schrank auf, in dem das Waschbecken untergebracht war, und knipste das Licht über dem Becken an. Nach gründlicher Morgentoilette band sie sich das Haar mit einem Gummiband zurück und holte aus dem Kleiderschrank ihren Jogginganzug und eine dicke Jacke. Sie schlüpfte in die Hose und ging nebenan in die Küche.
Sie schaltete das Licht ein und inspizierte das Bord über der Spüle. Coco-Pops, Weetabix, Cornflakes. Ihr Magen wollte davon nichts wissen. Sie holte sich eine Packung Orangensaft aus dem Kühlschrank und trank direkt aus der Tüte. Die Maus, die ihre Morgenwäsche beendet hatte, huschte erwartungsvoll wieder auf Elenas Schulter hinaus. Elena rieb ihr den Kopf mit dem Zeigefinger, während sie trank, und die Maus begann mit spitzen kleinen Zähnen an ihrem Fingernagel zu knabbern. Genug geschmust. Ich bin hungrig.
»Na gut«, sagte Elena und kramte, etwas angeekelt von dem Geruch der sauer gewordenen Milch, im Kühlschrank, bis sie das Glas mit dem Erdnußmus fand. Die Maus bekam wie täglich eine Fingerspitze voll als besonderes Bonbon. Während sie noch damit beschäftigt war, sich die letzten klebrigen Reste aus dem Fell zu lecken, ging Elena in ihr Zimmer zurück und setzte sie auf dem Schreibtisch ab. Sie zog den Morgenrock aus, schlüpfte in ein Sweat-Shirt und begann mit ihren Gymnastikübungen.
Sie wußte, wie wichtig es war, sich vor dem täglichen Lauftraining aufzuwärmen. Ihr Vater hatte es ihr mit nervtötender Monotonie eingebleut, seit sie in ihrem ersten Semester dem Hare and Hounds Club der Universität beigetreten war. Das änderte jedoch nichts daran, daß sie die Übungen unglaublich langweilig fand und sie nur schaffte, wenn sie sich dabei ablenkte – indem sie Fantasien spann, den Frühstückstoast röstete, zum Fenster hinaussah oder ein Stück Fachliteratur las, das sie zu lange liegengelassen hatte. An diesem Morgen steckte sie das Brot in den Toaster, ehe sie mit ihren Übungen anfing, und während es langsam dunkel wurde, lockerte sie vorschriftsmäßig Waden- und Schenkelmuskeln und sah dabei zum Fenster hinaus in den Nebel, der wie graue Watte um die Laterne in der Mitte des North Court hing.
Aus dem Augenwinkel sah sie die Maus auf dem Schreibtisch umherflitzen. Ab und zu erhob sie sich auf die Hinterbeine und streckte schnuppernd die kleine Schnauze in die Luft. Sie war nicht dumm. Ihre fein entwickelten Geruchsnerven sagten ihr, daß der leiblichen Genüsse noch mehr warteten, und sie wollte ihren Anteil daran haben.
Als der Toast fertig war, brach Elena ein Stück für die Maus ab und warf es in ihren Käfig. Die Maus startete sofort.
»Hey!« Sie hielt das kleine Tier fest, ehe es den Käfig erreichte. »Sag mir erst Wied’rseh’n, Tibbit.« Liebevoll rieb sie ihre Wange am Fell der Maus, ehe sie das Tier in den Käfig setzte. Die Maus hatte Mühe mit dem Toastbrocken, der beinahe so groß war wie sie selbst, aber sie schaffte es, den Koloß in ihr Nest zu schleppen. Lächelnd schnippte Elena noch einmal mit den Fingern an den Käfig, dann nahm sie den Rest des Toasts und eilte aus dem Zimmer.
Während die Glastür im Korridor hinter ihr zufiel, schlüpfte sie in die Jacke ihres Jogging-Anzugs und stülpte die Kapuze über den Kopf. Sie lief die erste Treppe in Aufgang L hinunter und schlug den Bogen zur nächsten Treppe, indem sie sich, auf das schmiedeeiserne Geländer gestützt, um die Kurve schwang. Federnd kam sie in halber Hocke auf und fing den Druck ihres Gewichts vor allem mit den Fußgelenken, weniger mit den Knien, ab. Die zweite Treppe rannte sie schneller hinunter, ließ sich vom Schwung über den Eingang tragen und riß die Tür auf. Die kalte Luft schlug ihr wie ein Wasserschwall ins Gesicht. Ihre Muskeln verkrampften sich sofort. Um sie wieder zu lockern, lief sie einen Moment an Ort und Stelle und schüttelte dabei ihre Arme aus. Sie atmete tief ein. Die Luft, vom Nebel beherrscht, der aus Fluß und Mooren emporstieg, schmeckte nach Humus und Holzrauch und legte sich feucht auf ihre Haut.
Sie lief zum Südende des New Court hinüber und sprintete durch die beiden Durchgänge zum Principal Court. Nirgends eine Menschenseele. Nirgends ein Licht. Herrlich! Sie fühlte sich frei wie ein Vogel.
Und sie hatte keine fünfzehn Minuten mehr zu leben.
Der Nebel, dessen Feuchtigkeit seit fünf Tagen von Häusern und Bäumen tropfte, setzte sich triefend auf den Fensterscheiben ab und bildete Pfützen auf Bürgersteigen und Straßen. Draußen, vor dem St. Stephen’s College, blinkten die Warnlichter eines Lastwagens, kleine orangefarbene Leuchtfeuer, funkelnd wie Katzenaugen. In der Senate House Passage streckten viktorianische Laternen lange gelbe Lichtfinger durch den Nebel, doch die gotischen Türmchen des King’s College, eben noch sichtbar, wurden schnell von der finstergrauen Düsternis verschluckt. Der Himmel dahinter war noch fahl wie jede Novembernacht. Der Morgen war eine volle Stunde entfernt.
Elena lief von der Senate House Passage in die King’s Parade. Der Aufprall ihrer Füße auf dem Pflaster setzte sich in vibrierenden Schwingungen durch Muskeln und Knochen bis in ihren Magen fort. Sie drückte die Handflächen auf ihre Hüften, genau an die Stelle, an der in der Nacht sein Kopf geruht hatte. Aber anders als in der vergangenen Nacht ging ihr Atem jetzt ruhig und regelmäßig, nicht hastig und hechelnd vom rasenden Lauf zur Ekstase. Dennoch konnte sie beinahe seinen zurückgeworfenen Kopf sehen, den Ausdruck angespannter Konzentration auf seinem Gesicht. Und sie konnte beinahe sehen, wie seine Lippen ihren Namen formten, während er ihr entgegendrängte und sie immer heftiger an sich zog. Sie fühlte den fiebernden Schlag seines Herzens und hörte seinen Atem, keuchend wie der eines Sprinters.
Sie genoß es, daran zu denken. Sie hatte sogar davon geträumt, als am Morgen das Licht sie geweckt hatte.
Kraftvoll lief sie von Lichtpfütze zu Lichtpfütze die King’s Parade hinunter in Richtung Trumpington. Irgendwo in der Nähe machte jemand Frühstück; ein schwacher Geruch nach Kaffee und Schinken hing in der Luft. Ihre Kehle zog sich abwehrend zusammen, und sie legte Tempo zu, um dem Geruch zu entkommen.
An der Mill Lane bog sie zum Fluß ab. Das Blut pochte jetzt in ihren Schläfen, und sie hatte trotz der Kälte zu schwitzen begonnen. Schweiß rann von ihren Brüsten zur Taille hinab.
Wenn du schwitzt, ist das ein Zeichen, daß dein Körper funktioniert, hatte ihr Vater ihr immer wieder gesagt.
Die Luft erschien ihr frischer, als sie sich dem Fluß näherte. Sie wich zwei Fahrzeugen der städtischen Straßenreinigung aus. Der Arbeiter im hellgrünen Anorak war das erste lebende Wesen, das sie an diesem Morgen sah. Er hievte einen Müllsack auf einen der Wagen und hob, als sie vorüberkam, eine Thermosflasche, als wollte er ihr zuprosten.
Am Ende der schmalen Straße schoß sie auf die Fußgängerbrücke über den Cam hinaus. Die Backsteine unter ihren Füßen waren glitschig. Sie trabte einen Moment auf der Stelle, um den Ärmel ihrer Jacke zurückzuschieben und auf die Uhr zu sehen. Aber sie hatte die Uhr in ihrem Zimmer liegengelassen. Leise vor sich hinschimpfend, lief sie weiter über die Brücke, um einen raschen Blick in die Laundress Lane zu werfen.
Herrgott noch mal, wo bleibt sie denn wieder? Elena spähte mit zusammengekniffenen Augen durch den Nebel und seufzte gereizt. Es war nicht das erstemal, daß sie warten mußte, aber ihr Vater hatte so entschieden.
»Ich erlaube nicht, daß du allein läufst, Elena. So früh am Morgen. Und dann noch am Fluß entlang. Keine Widerrede. Wenn du wenigstens eine andere Route nehmen könntest...«
Aber sie wußte, daß das nichts ändern würde. Eine andere Route, und ihm würden andere Einwände einfallen. Sie hätte ihm überhaupt nichts davon sagen sollen, daß sie regelmäßig lief. Aber sie hatte sich nichts dabei gedacht, als sie es ihm erzählt hatte. Ich bin Hare and Hounds beigetreten, Daddy. Und er hatte die Gelegenheit sofort genutzt, um ihr wieder seine liebevolle Fürsorge zu demonstrieren. Genau wie er sich ihre Arbeiten vornahm, ehe sie sie abgab. Er pflegte sie mit gerunzelter Stirn äußerst aufmerksam zu lesen, und dabei sagten Haltung und Gesichtsausdruck deutlich: Sieh, wie ich mich kümmere, sieh, wie sehr ich dich liebe, sieh, wie sehr ich es zu schätzen weiß, daß du in mein Leben zurückgekehrt bist. Nie wieder werde ich dich im Stich lassen, mein Herzenskind. Und dann erörterte er die Arbeit mit ihr, brachte seine kritischen Überlegungen an, ließ sich über Einleitung und Schluß und eventuelle Unklarheiten aus, zitierte auch noch ihre Stiefmutter zur Beratung herbei und lehnte sich am Ende mit seligem Blick in seinem Ledersessel zurück. Seht doch, was für eine glückliche Familie wir sind! Einfach widerlich!
Ihr Atem stieg dampfend in die Luft. Sie hatte länger als eine Minute gewartet. Aber niemand tauchte aus den Nebelschwaden in der Laundress Lane auf.
Soll sie doch der Teufel holen, dachte sie und lief zur Brücke zurück. Auf dem Mill Pond hoben sich schemenhaft Schwäne und Enten aus dem Dunst, und am Südwestufer des Teichs ließ eine Trauerweide ihre Zweige ins Wasser hängen. Elena warf einen letzten Blick über ihre Schulter zurück, aber es folgte ihr niemand. Sie lief allein weiter.
Beim Lauf zum Wehr hinunter, schätzte sie den Winkel des Hangs falsch ein und vertrat sich den Fuß. Mit einem Aufschrei zuckte sie zusammen, lief aber gleich weiter. Ihre Zeit war beim Teufel – nicht daß sie überhaupt eine Ahnung hatte, wie schnell sie bis jetzt gewesen war –, aber vielleicht konnte sie oben auf dem Damm ein paar Sekunden aufholen. Sie lief schneller.
Die Straße verengte sich zu einem Asphaltstreifen, der links vom Fluß und rechts von der großen, nebelverhüllten Fläche des Sheep’s Green begrenzt wurde. Die wuchtigen Silhouetten alter Bäume hoben sich hier aus dem Nebel, und da und dort blitzten im Schein der Lichter, die von jenseits des Flusses herüberleuchteten, die eisernen Geländer von Brücken und Stegen auf. Enten ließen sich beinahe lautlos ins Wasser fallen, als Elena sich näherte, und sie griff in ihre Tasche, holte den letzten Happen Toast heraus, zerkrümelte ihn und warf den Tieren die Bröckchen zu.
Ihre Zehenspitzen stießen in stetigem Rhythmus gegen die Kappen ihrer Joggingschuhe. Ihre Ohren begannen in der Kälte zu schmerzen. Sie zog die Schnur der Kapuze fester zu und schlüpfte in die Handschuhe, die sie mitgenommen hatte. Vor ihr teilte sich der Fluß in zwei Arme, die Robinson Crusoe’s Island umfingen, eine kleine Insel, am Südende von Bäumen und Büschen überwuchert, am Nordende von Bootsschuppen besetzt, in denen die Ruderboote, Kanus und Skulls der Colleges repariert wurden. Vor kurzem hatte hier jemand Feuer gemacht; Elena konnte den Rauch noch riechen. Wahrscheinlich hatte in der Nacht jemand auf dem Nordteil der Insel kampiert und einen Haufen verkohlten Holzes hinterlassen, das in aller Eile mit Wasser gelöscht worden war. Der Geruch war ein anderer als der eines natürlich erloschenen Feuers.
Im Laufen spähte sie neugierig zwischen den Bäumen hindurch. Kanus und Kähne warteten ordentlich übereinander gestapelt. Ihr Holz glänzte von der Feuchtigkeit des Nebels. Kein Mensch weit und breit.
Der Weg stieg zum Fen Causeway an, Ende der ersten Etappe ihrer morgendlichen Runde. Wie immer nahm sie die leichte Steigung mit einem neuen Energieschub in Angriff. Sie atmete tief und regelmäßig, aber sie spürte, wie sich der Druck in ihrer Brust staute. Sie hatte sich gerade an das neue Tempo gewöhnt, als sie sie sah.
Zwei Gestalten tauchten vor ihr aus dem Nebel auf, die eine zusammengekauert, die andere quer über dem Weg liegend. Schemenhaft und verschwommen vibrierten sie wie ungewisse Holographien im trüben Lichtschein des Causeway, der sich etwa zwanzig Meter hinter ihnen befand. Die geduckte Gestalt, die vielleicht Elenas Schritte hörte, drehte den Kopf und hob eine Hand. Die andere Gestalt rührte sich nicht.
Elena blinzelte durch den Nebel. Ihr Blick flog von einer Gestalt zur anderen. Sie schätzte die Größe ab.
Townee! dachte sie und stürzte vorwärts.
Die geduckte Gestalt richtete sich auf, wich zurück, als Elena näherkam und schien im dichten Nebel bei der Brücke zu verschwinden, die den Fußweg mit der Insel verband. Elena blieb keuchend stehen und fiel auf die Knie. Sie streckte den Arm aus, berührte die Gestalt auf dem Boden, um sie voller Angst zu untersuchen, und es war nichts weiter als ein alter, mit Lumpen ausgestopfter Mantel.
Verwirrt drehte sie sich um, eine Hand auf den Boden gestützt, um sich in die Höhe zu stemmen, und holte Luft, um zu sprechen.
Im selben Moment zerriß die graue Düsternis vor ihr. Etwas blitzte links von ihr auf. Der erste Schlag fiel.
Er traf sie genau zwischen die Augen. Ihr Körper wurde nach rückwärts geschleudert.
Der zweite Schlag traf Nase und Wange, durchschnitt Haut und Fleisch und zertrümmerte das Jochbein wie Glas.
Falls ein dritter Schlag sie traf, so fühlte sie es nicht mehr.
Es war kurz nach sieben, als Sarah Gordon ihren Escort auf den gepflasterten Platz direkt neben der technischen Hochschule steuerte. Trotz des Nebels und des morgendlichen Berufsverkehrs hatte sie die Fahrt von zu Hause in weniger als fünf Minuten geschafft. Sie war über den Fen Causeway gefegt, als säßen ihr die Furien im Nacken. Sie zog die Handbremse an, stieg aus und schlug die Tür zu.
Denk ans Malen, sagte sie sich. An nichts als ans Malen.
Sie ging nach hinten zum Kofferraum und nahm ihre Sachen heraus: einen Klappstuhl, einen Skizzenblock, einen Holzkasten, eine Staffelei, zwei Leinwände. Als das alles zu ihren Füßen auf dem Boden lag, warf sie einen forschenden Blick in den Kofferraum und überlegte, ob sie etwas vergessen hatte. Sie konzentrierte sich auf Details – Kohle, Temperafarben und Bleistifte im Kasten – und versuchte krampfhaft, die aufsteigende Übelkeit und das heftige Zittern ihrer Beine zu ignorieren.
Einen Moment lehnte sie den Kopf an den schmutzigen Kofferraumdeckel und ermahnte sich noch einmal, allein ans Malen zu denken. Das Sujet, der Ort, die Beleuchtung, die Komposition, die Wahl der Mittel verlangten ihre volle Konzentration. Sie versuchte, sie zu geben. Der heutige Morgen bedeutete eine Wiedergeburt.
Vor sieben Wochen hatte sie diesen Tag in ihrem Kalender angemerkt, den 13. November. Tu’s doch, hatte sie quer über das kleine weiße Quadrat der Hoffnung geschrieben, und jetzt war sie hier, um acht Monaten lähmender Untätigkeit ein Ende zu bereiten, indem sie sich des einzigen Mittels bediente, das sie wußte, um den Weg zu der Leidenschaft zu finden, mit der sie einst ihrer Arbeit begegnet war. Wenn sie nur den Mut aufbringen könnte, einen kleinen Rückschlag zu überwinden...
Sie schlug den Kofferraumdeckel zu und sammelte ihre Sachen auf. Jeder Gegenstand fand wie von selbst den gewohnten Platz in ihren Händen und unter ihren Armen. Es gab keinen Anflug von Erschrecken, so daß sie sich fragte, wie sie es früher geschafft hatte, das alles zu tragen. Und allein die Tatsache, daß manche Handgriffe automatisch zu sein schienen, zweite Natur wie das Fahrradfahren, beflügelte sie einen Moment lang. Sie ging über den Fen Causeway zurück und stieg den Hang hinunter zu Robinson Crusoe’s Island. Die Vergangenheit ist tot, sagte sie sich. Sie war hierher gekommen, um sie zu begraben.
Allzu lange hatte sie starr vor der Staffelei gestanden, unfähig, sich der heilenden Kräfte zu erinnern, die der Kreativität innewohnten. Nichts hatte sie in all diesen Monaten geschaffen außer diverse Möglichkeiten der Selbstzerstörung: Sie hatte ein halbes Dutzend Rezepte für Tabletten gesammelt, ihre alte Flinte gereinigt und geölt, sich vergewissert, daß ihr Gasherd funktionierte, aus ihren Schals einen Strick geknüpft und war die ganze Zeit überzeugt gewesen, alle künstlerische Kraft in ihr sei tot. Aber damit war es jetzt vorbei. Die sieben Wochen täglich wachsender Angst vor dem näherrückenden 13. November waren vorüber.
Auf der kleinen Brücke, die zu Robinson Crusoe’s Island hinüberführte, blieb sie stehen. Obwohl es inzwischen hell geworden war, versperrte ihr der Nebel wie eine Wolkenbank die Sicht. Aus einem der Bäume über sich hörte sie den schmetternden Gesang eines Zaunkönigs, und vom Causeway klang das gedämpfte Rauschen des Verkehrs herüber. Irgendwo auf dem Fluß quakte eine Ente. Auf der anderen Seite von Sheep’s Green bimmelte eine Fahrradglocke.
Die Bootsschuppen zu ihrer Linken waren noch geschlossen. Zehn eiserne Stufen führten zur Crusoe’s Bridge hinauf und hinunter zum Moor, dem Coe Fen, am Ostufer des Flusses. Sie sah, daß die Brücke frisch gestrichen war; es war ihr vorher gar nicht aufgefallen. Früher grün und orangefarben, von Rostflecken durchsetzt, war sie jetzt braun und cremeweiß, ein helles Netz von Geländerstangen, die licht durch den Nebel schimmerten. Die Brücke selbst schien über dem Nichts zu hängen. Und alles um sie herum war durch den Nebel verändert und unsichtbar.
Trotz ihrer Entschlossenheit seufzte sie. Es war unmöglich. Kein Licht, keine Hoffnung, keine Inspiration an diesem trostlosen Ort. Zum Teufel mit Whistlers Nachtstudien der Themse. Zum Teufel mit Turner und dem, was er aus diesem Nebelmorgen gemacht hätte. Kein Mensch würde ihr glauben, daß sie hergekommen war, um dies zu malen.
Doch es war der Tag, den sie gewählt hatte. Die Ereignisse hatten ihr bestimmt, zum Malen auf diese Insel zu kommen. Und malen würde sie! Sie eilte weiter, über die Brücke hinweg, und stieß das quietschende schmiedeeiserne Tor auf, entschlossen, nicht auf die Kälte zu achten, die sich kriechend in ihrem ganzen Körper auszubreiten schien. Sie biß die Zähne zusammen.
Hinter der Pforte spürte sie unter ihren Füßen den Schlamm, der schmatzend an den Sohlen ihrer Turnschuhe sog, und schauderte. Es war kalt. Aber es war nur die Kälte. Sie suchte sich ihren Weg in das Wäldchen aus Erlen, Weiden und Buchen.
Die Bäume trieften vor Nässe. Wassertropfen fielen klatschend auf die rostfarbene Laubdecke. Ein dicker, abgebrochener Ast lag ihr im Weg, und gleich dahinter bot eine kleine Lichtung unter einer Pappel Ausblick. Dorthin ging Sarah. Sie lehnte Staffelei und Leinwände an den Baum, stellte ihren Klappstuhl auf und legte ihren Holzkasten daneben. Den Skizzenblock hielt sie an die Brust gedrückt.
Malen, zeichnen, malen, skizzieren. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Ihre Finger erschienen ihr steif. Sie taten ihr weh bis in die Nägel. Sie verachtete sich für ihre Schwäche.
Sie zwang sich, sich auf dem Klappstuhl niederzusetzen und über den Fluß zur Brücke zu blicken. Sie achtete auf die Details und bemühte sich, Linien und Winkel zu erfassen, Teil einer simplen Kompositionsaufgabe, die gelöst werden mußte. Reflexhaft begann ihr Verstand auszuwerten, was ihr Auge aufnahm. Drei Erlenzweige, auf deren feuchten späten Herbstblättern das bißchen Licht glänzte, das vorhanden war, wirkten wie ein Rahmen für die Brücke. Sie bildeten Diagonalen, die zunächst über dem Bauwerk schwebten und sich dann schnurgerade zur Treppe hinuntersenkten, die zum Coe Fen führte, wo im Nebel die fernen Lichter von Peterhouse zu erahnen waren. Eine Ente und zwei Schwäne trieben geisterhaft auf dem Fluß, der so grau war, so grau wie die Luft, daß die Vögel im Raum zu schweben schienen.
Schnelle Striche, dachte sie, großzügig und kühn, Kohle, um mehr Tiefe zu erzielen. Sie setzte ihren ersten Strich, dann einen zweiten und einen dritten, ehe ihre Finger erschlafften und die Kohle losließen, so daß sie über das Papier in ihren Schoß rollte.
Sie starrte auf den mißlungenen Ansatz einer Zeichnung. Dann riß sie das Blatt aus dem Block und begann von neuem.
Sie merkte, wie ihr Magen rumorte und Übelkeit ihr in die Kehle stieg. Verzweifelt sah sie sich um. Sie wußte, daß die Zeit nicht reichte, um nach Hause zu fahren, wußte auch, daß sie sich keinesfalls hier und jetzt übergeben konnte. Sie blickte auf ihre Skizze, erblickte die unvollkommenen, spannungslosen Linien und knüllte das Blatt zusammen. Sie fing eine dritte Skizze an und konzentrierte sich einzig darauf, ihre rechte Hand ruhig und sicher zu führen. Gegen die Panik kämpfend, versuchte sie, die Neigung der Erlenzweige nachzuempfinden; das gesprenkelte Muster der Blätter anzudeuten. Die Kohle zerbrach ihr in der Hand.
Sie stand auf. So war das nichts. Die schöpferische Kraft mußte sie führen. Zeit und Ort mußten versinken. Die Leidenschaft mußte zurückkehren. Aber das war nicht geschehen. Sie war fort.
Du kannst, dachte sie mit wütender Entschlossenheit. Du kannst und du willst. Nichts kann dich hindern. Niemand steht dir im Weg.
Sie klemmte den Skizzenblock unter den Arm, packte ihren Klappstuhl und ging in südlicher Richtung über die Insel, bis sie zu einer kleinen Landzunge kam. Sie war von Nesseln überwuchert, aber sie bot einen anderen Blick auf die Brücke. Das war die Stelle.
Der Boden unter der dichten Laubdecke war lehmig. Bäume und Büsche bildeten ein Netzwerk aus fast kahlen Ästen und Zweigen, hinter dem sich in der Ferne die Steinbrücke des Fen Causeway erhob. Hier stellte Sarah ihren Klappstuhl auf. Sie trat einen Schritt zurück und stolperte – über einen Ast, wie es schien, der unter einem Blätterhaufen halb verborgen war. Sie schreckte auf.
»Verdammt«, entfuhr es ihr, und sie trat das Ding mit dem Fuß weg. Die Blätter fielen zur Seite. Sarah drehte sich der Magen um. Es war kein Ast, es war ein menschlicher Arm.
2
Zum Glück war der Arm mit einem Körper verbunden. In seiner neunundzwanzigjährigen Dienstzeit bei der Polizei von Cambridge hatte Superintendent Daniel Sheehan nie mit einem Fall von Zerstückelung zu tun gehabt, und er war auch jetzt nicht scharf auf dieses zweifelhafte Vergnügen.
Nach dem Anruf von der Dienststelle um zwanzig nach acht war er mit blinkenden Lichtern und heulender Sirene von Arbury losgebraust, froh, dem Frühstück entrinnen zu können, das seit nunmehr zehn Tagen in Folge aus Grapefruit ohne Zucker, einem gekochten Ei und einem Scheibchen Toast ohne Butter bestand. In seiner Frustration neigte er dazu, Sohn und Tochter wegen ihrer Kleidung und ihrer Haare anzuschnauzen, als trügen sie nicht adrette Schuluniformen, als wäre ihr Haar nicht frisch gewaschen und ordentlich gekämmt. Die beiden pflegten nur ihre Mutter anzusehen, ehe sie sich alle drei schweigend ihrem eigenen Frühstück zuwandten, Märtyrer, die allzu lange schon unter den unberechenbaren Launen des chronischen Hungerkünstlers litten.
Am Kreisverkehr Newnham Road stand der Verkehr, Sheehan erreichte die Brücke am Fen Causeway nur deshalb lange vor allen anderen, weil er halb auf dem Bürgersteig vorfuhr. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie es jetzt auf den Einfallstraßen im Süden der Stadt zuging. Sobald er seinen Wagen hinter dem Fahrzeug der Spurensicherung abgestellt hatte und ausgestiegen war, befahl er deshalb dem Constable, der auf der Brücke Wache stand, bei der Zentrale zusätzliche Leute zur Verkehrsregelung anzufordern. Nichts haßte er so sehr wie Gaffer und Sensationsjäger.
Er stopfte seinen marineblauen Schal fest in seinen Mantel, dann tauchte er unter der gelben Polizeiabsperrung durch. Auf der Brücke standen mehrere Studenten weit über das Geländer gebeugt, um zu sehen, was unten vorging. Sheehan winkte den Constable herbei und befahl ihm, die jungen Leute weiterzuschicken. Wenn das Opfer zu einem der Colleges gehörte, so würde er darüber nicht früher etwas verlauten lassen als unbedingt nötig. Seit einer höchst unglücklich verlaufenen Untersuchung am Emmanuel College im vergangenen Herbst bestand zwischen der örtlichen Polizei und der Universität ein sehr empfindlicher Friede. Den wollte Sheehan keinesfalls gefährden.
Er überquerte die kleine Brücke zur Insel, wo sich eine Beamtin um eine Frau bemühte, die bleich und in sich zusammengefallen auf einer der unteren Stufen der Eisentreppe saß. Sie hatte einen alten blauen Mantel an, der vorn mit braunen und gelben Flecken übersät war. Offensichtlich hatte sie sich übergeben.
»Sie hat die Leiche gefunden?« fragte Sheehan die Beamtin, die wortlos nickte. »Wer ist mittlerweile hier?«
»Alle außer Pleasance. Drake wollte ihn nicht aus dem Labor weglassen.«
Sheehan brummte gereizt. Schon wieder eine kleine Differenz bei den Herren Gerichtsmedizinern. Mit einer ruckartigen Kopfbewegung wies er auf die Frau auf der Treppe. »Besorgen Sie ihr eine Decke. Wir brauchen sie hier vorläufig noch.« Er kehrte zur Pforte zurück und betrat den Südteil der Insel.
Je nach Standpunkt war dies der ideale Tatort beziehungsweise der Alptraum jedes Ermittlungsbeamten. Spuren – ob nun von Belang oder nicht – gab es da in Hülle und Fülle, von verrottenden Zeitungen bis zu weggeworfenen Plastikbeuteln, die ganz oder teilweise mit Abfällen aller Art gefüllt waren. Das Ganze sah aus wie eine einzige Müllhalde und bot dazu mindestens ein Dutzend deutlicher und unverkennbar nicht zusammengehöriger Fußabdrücke in der feuchten Erde.
»O Mist!« knurrte Sheehan.
Die Leute von der Spurensicherung hatten Holzbretter ausgelegt. Sie begannen an der Pforte und setzten sich nach Süden fort, bis sie sich im Nebel verloren. Er ging mit dröhnenden Schritten über sie hinweg und versuchte dabei, dem von den Bäumen tropfenden Wasser auszuweichen, so gut es ging. Vor einer Lichtung, auf der zwei Leinwände und eine Staffelei an einer Pappel lehnten, blieb er stehen. Auf dem Boden lag ein offener Holzkasten mit einer wohlgeordneten Reihe Pastellkreiden und acht handbeschrifteten Farbtuben, auf denen sich bereits ein dünner Feuchtigkeitsfilm gesammelt hatte. Stirnrunzelnd blickte er vom Fluß zur Brücke und weiter zu den weißen Nebelschwaden, die aus dem Moor aufstiegen, und fühlte sich angesichts der Malutensilien an die französischen Bilder erinnert, die er vor Jahren im Courtauld Institute gesehen hatte: lauter Tupfer und Kringel und Strichelchen, die erst dann eine halbwegs erkennbare Komposition ergaben, wenn man zehn Meter zurücktrat und ordentlich die Augen zusammenkniff und sich vorstellte, wie die Welt aussehen würde, wenn man einmal eine Brille brauchte.
Ein Stück weiter schwenkten die Planken nach links, und er stieß auf den Polizeifotografen und die Gerichtsbiologin. Beide waren dick eingepackt gegen die Kälte und hatten ihre Wollmützen tief in die Gesichter gezogen. Wie tolpatschige Tänzer hüpften sie von einem Fuß auf den anderen, um sich warmzuhalten. Der Fotograf sah so käsig aus wie immer, wenn er eine Leiche fotografieren mußte. Die Biologin sah mürrisch und gereizt aus. Die Arme fest auf der Brust gekreuzt, als glaubte sie, daß der Mörder sich noch dort drüben im Nebel aufhalte, und sie nur hoffen konnte, ihn zu schnappen, wenn sie augenblicklich losrannten.
Als Sheehan die beiden erreichte und die übliche Frage stellte – »Was haben wir denn diesmal?« –, sah er den Grund für die Gereiztheit der Biologin. Aus dem Dunst unter den Weiden tauchte ein hochgewachsener Mann auf, der, den Blick unverwandt zu Boden gerichtet, langsam näherkam. Trotz der Kälte hatte er seinen Kaschmirmantel nur lässig über die Schultern geworfen, und er trug keinen Schal, der vom eleganten Schnitt seines italienischen Anzugs abgelenkt hätte: Drake, Leiter der gerichtsmedizinischen Abteilung, einer der beiden sich ewig in den Haaren liegenden Wissenschaftler, die Sheehan in den vergangenen fünf Monaten das Leben schwer gemacht hatten. Frönt wie immer seiner Lust am großen Auftritt, dachte Sheehan.
»Was gefunden?« fragte er.
Drake blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Er drückte die Flamme des Streichholzes zwischen den Fingern aus und ließ das Hölzchen in eine kleine Dose fallen, die er aus der Manteltasche zog. Sheehan verkniff sich einen Kommentar. Der Bursche war doch wirklich für jede Eventualität gewappnet.
»Uns fehlt eine Waffe«, sagte er. »Ich fürchte, wir werden im Fluß danach suchen müssen.«
Na prächtig, dachte Sheehan und berechnete im Kopf, wieviel Zeit und Personal die Durchführung einer solchen Operation kosten würde. Er trat zu der Leiche, um sie sich näher anzusehen.
»Weiblich«, bemerkte die Biologin. »Ein ganz junges Ding.«
Während Sheehan schweigend zu dem jungen Mädchen hinunterblickte, fiel ihm auf, wie unglaublich laut es rundherum war. Von der Ruhe des Todes war hier nichts zu spüren. Hupen dröhnten vom Causeway herüber, Motoren ratterten, Bremsen quietschten, Menschenstimmen mischten sich mit dem allgemeinen Getöse. In den Bäumen krakeelten die Vögel, und irgendwo kläffte ein Hund. Das Leben ging weiter.
Das Mädchen war durch Gewalteinwirkung umgekommen, daran gab es keinen Zweifel. Man hatte sie mit Laub zugedeckt, doch nicht so gründlich, daß Sheehan nicht das Schlimmste gesehen hätte. Der Mörder hatte ihr Gesicht zertrümmert. Die Schnur der Kapuze ihrer Joggingjacke war fest um ihren Hals gezogen. Ob sie an den Kopfverletzungen gestorben war oder durch Erdrosseln, würde der Pathologe feststellen müssen, eines jedoch war klar: Niemand würde ihr Gesicht identifizieren können. Es war bis zur Unkenntlichkeit zerstört.
Sheehan ging in die Knie, um die Tote genauer zu mustern. Sie lag auf der rechten Seite, das Gesicht zur Erde gewandt, ihr langes Haar war nach vorn gefallen und ruhte in losen Locken auf dem Boden. Die Arme befanden sich vor dem Körper, die Handgelenke dicht beieinander, aber nicht gebunden. Ihre Knie waren angewinkelt.
Nachdenklich kaute er auf der Unterlippe, sah zum Fluß, der vielleicht anderthalb Meter entfernt war, dann wieder zu der Toten. Sie hatte einen fleckigen braunen Jogginganzug an und weiße Joggingschuhe mit schmutzigen Bändern. Sie war schlank. Sie wirkte sportlich und durchtrainiert. Sie schien genau das Politikum zu sein, auf das er mit Freuden verzichtet hätte. Er hob ihren Arm, um zu sehen, ob ihre Jacke ein Emblem trug, und seufzte resigniert, als er auf der linken Brustseite der Jacke ein aufgenähtes Wappen vom St. Stephen’s College entdeckte.
»Verdammt!« brummte er. Er ließ den Arm wieder herabsinken und nickte dem Fotografen zu. »Machen Sie zu«, sagte er und entfernte sich.
Er sah zum Coe Fen hinüber. Der Nebel schien sich zu lichten, aber vielleicht sah das im zunehmenden Tageslicht nur so aus, war flüchtige Illusion, Wunschdenken. Es spielte im Grunde sowieso keine Rolle, ob der Nebel da war oder nicht, Sheehan war in Cambridge geboren und aufgewachsen, er wußte, was jenseits der undurchdringlichen Feuchtigkeit lag. Peterhouse. Gegenüber, Pembroke. Links von Pembroke Corpus Christi. Von dort aus reihte sich in nördlicher, westlicher und östlicher Richtung ein College an das andere. Und rund um sie herum, der Universität, der sie ihre Existenz zu verdanken hatte, unterstellt, breitete sich die Stadt aus. In dem Nebeneinander von Colleges, Fakultäten, Bibliotheken, Geschäfts- und Privathäusern, Studenten, Dozenten und Bürgern von Cambridge spiegelten sich sechshundert Jahre widerwilliger Symbiose.
Er drehte sich um, als er Bewegung hinter sich spürte, und sah direkt in die scharfen grauen Augen Drakes. Der Wissenschaftler hatte offenbar gewußt, was zu erwarten war. Lange schon hatte er auf eine Gelegenheit gehofft, seinem Mitarbeiter im Labor die Daumenschrauben anzulegen.
»Ich denke, in diesem Fall wird wohl keiner behaupten, daß es sich um Selbstmord handelt«, sagte er.
Superintendent Malcolm Webberly von New Scotland Yard drückte seine dritte Zigarette innerhalb ebenso vieler Stunden aus und sah nachdenklich in die Runde. Wieviel Erbarmen würden seine divisional inspectors walten lassen, wenn er sich jetzt gleich fürchterlich zum Narren machte? In Anbetracht von Länge und Lautstärke seiner vor zwei Wochen vorgetragenen Schimpfkanonade mußte er wahrscheinlich mit dem Schlimmsten rechnen. Er verdiente es nicht anders. Mindestens eine halbe Stunde lang hatte er vor seinem Team über die, wie er sie bissig nannte, »fahrenden Ritter« gewettert, und jetzt mußte er von einem seiner eigenen Leute verlangen, sich unter sie einzureihen.
Er blickte sie der Reihe nach an. Sie saßen um den runden Tisch in seinem Büro. Hale, nervös wie immer, spielte mit einem Häufchen Büroklammern, die er zu einer Art Kettenhemd zusammensetzte, vielleicht in Erwartung eines Kampfes gegen einen mit Zahnstochern bewaffneten Feind. Stewart – der Zwanghafte des Haufens – nutzte die Gesprächspause, um an einem Bericht weiterzuarbeiten. Man munkelte, er schaffe es problemlos, beim Beischlaf mit seiner Frau gleichzeitig Polizeiberichte auszufüllen, und lege bei beidem etwa das gleiche Maß an Enthusiasmus an den Tag. MacPherson, der mit Duldermiene neben ihm saß, reinigte sich die Fingernägel mit einem Taschenmesser, dessen Spitze abgebrochen war, und Lynley, links von ihm, polierte die Gläser seiner Lesebrille mit einem blütenweißen Taschentuch, dessen eine Ecke ein feingesticktes schnörkeliges A zierte.
Webberly mußte lächeln über die Ironie der Situation. Vor vierzehn Tagen erst hatte er sich über die neue Vorliebe des Landes für eine Art Wanderpolizei aufgeregt. Anlaß dazu war ein Artikel in der Times gewesen, in dem die Summen öffentlicher Gelder aufgeschlüsselt wurden, die in diese blödsinnigen Aktivitäten der Justiz flossen.
»Schauen Sie sich das an«, hatte er getobt und die Zeitung so zusammengeknüllt, daß es unmöglich war, sich »das« anzuschauen. »Die Polizei von Manchester ermittelt gegen die Kollegen in Sheffield wegen Bestechungsverdachts. Yorkshire nimmt die Kriminalpolizei in Birmingham unter die Lupe; und Cambridgeshire kraucht in Nordirland herum und sucht nach Leichen in den Schränken der dortigen Polizei. Keiner kehrt mehr vor der eigenen Tür. Es ist Zeit, daß das wieder anders wird.«
Seine Männer hatten zustimmend genickt. Webberly fragte sich allerdings, ob sie wirklich zugehört hatten. Sie waren alle überlastet, dem Politgeschwafel ihres Superintendent dreißig Minuten ihrer kostbaren Zeit zu schenken, war ein zusätzliches Eingeständnis an ihr Tagessoll. Aber dieser Gedanke kam ihm erst später. Fürs erste galoppierte er munter weiter voran auf seinem Streitroß.
»Was ist eigentlich los mit uns? Beim kleinsten Anzeichen eines möglichen Ärgers mit der Presse kneifen die obersten Dienstherren der Polizeibehörden die Schwänze ein wie geprügelte Hunde. Sie laden jeden ein, ihren Leuten auf den Zahn zu fühlen, anstatt ihren Laden selbst in Ordnung zu halten, ihre eigenen Untersuchungen durchzuführen und die Medien weiterzuschicken. Was sind denn das für Versager, die nicht einmal fähig sind, ihre eigene schmutzige Wäsche zu waschen?«
Sie wußten alle, daß die Frage rhetorisch gemeint war und warteten geduldig darauf, daß er sie beantworten würde. Und das tat er auch, auf seine Art.
»Die sollen mir mal mit so was kommen. Denen werd ich sagen, wo’s lang geht.«
Und jetzt waren sie ihm »mit so was gekommen«, mit einem Sondergesuch von zwei verschiedenen Seiten und entsprechender Anweisung von seinem eigenen Vorgesetzten, und das alles, ohne ihm Zeit oder Gelegenheit zu lassen, ihnen zu sagen »wo’s lang geht«.
Webberly stand auf und ging schwerfällig zu seinem Schreibtisch, um über die Sprechanlage seine Sekretärin zu rufen. Auf seinen Knopfdruck bekam er Knistern, Knacken und angeregte Unterhaltung zu hören. Beides war er gewöhnt. Der Apparat funktionierte schon seit dem schweren Sturm von 1987 nicht mehr richtig. Und Dorothea Harrimans endlose Ergüsse über das Objekt ihrer heißen Bewunderung waren ihm leider auch nur allzu vertraut.
»Sie sind eindeutig gefärbt, glaub mir. Auf diese Weise braucht sie nie Angst zu haben, daß sie auf Fotos oder so Tuschflecken unter den Augen...« Lautes Knacken unterbrach den Monolog. »... kein Vergleich mit Fergie... es ist mir gleich...«
»Harriman!« unterbrach Webberly.
»Weiße Strumpfhosen sähen am besten aus... Ein Glück, daß sie...«
»Harriman!«
Als die Perle noch immer nicht reagierte, stürmte Webberly zur Tür, riß sie auf und rief Dorothea Harriman laut und ärgerlich beim Namen.
Dorothea Harriman machte ihren Auftritt, als er schon auf dem Rückweg zum runden Tisch war. Sie hatte sich kürzlich die Haare schneiden lassen, hinten und an den Seiten ziemlich kurz, vorn eine lange blonde Schmachtlocke, die ihr mit eingefärbten goldenen Glanzlichtern tief in die Stirn fiel. Sie trug ein rotes Wollkleid und passende Pumps und dazu weiße Strümpfe. Unglücklicherweise schmeichelte ihr Rot so wenig wie der Prinzessin. Aber wie die Prinzessin hatte sie bemerkenswerte Fesseln.
»Superintendent Webberly?« fragte sie und nickte den Beamten am Tisch so kühl und sachlich zu, als habe sie nichts als ihre Arbeit im Kopf.
»Wenn Sie sich einen Moment vom Gespräch über die Prinzessin losreißen könnten...« sagte Webberly.
Dorothea Harriman sah ihn mit großen Kinderaugen an. Welche Prinzessin? fragte ihre Unschuldsmiene.
»Wir erwarten ein Fax aus Cambridge«, fuhr er fort. »Kümmern Sie sich darum. Jetzt gleich bitte. Sollten inzwischen Anrufe aus dem Kensington Palace für Sie kommen, werde ich die Herrschaften bitten zu warten.«
Harriman preßte die Lippen aufeinander, konnte aber ein spitzbübisches Lächeln nicht ganz unterdrücken. »Fax«, wiederholte sie knapp. »Cambridge. Sofort, Superintendent.« Und ehe sie zur Tür hinausging, sagte sie noch: »Charles hat dort studiert, wie Sie vielleicht wissen.«
John Stewart blickte auf und klopfte sich mit seinem Füller nachdenklich an die Zähne. »Charles?« fragte er leicht verwirrt.
»Wales«, sagte Webberly.
»Wales?« rief Stewart. »Ich denke, es war Cambridge.«
»Prinz von Wales!« rief Hale ungeduldig.
»Der Prinz von Wales ist in Cambridge?« fragte Stewart. »Aber das ist doch Sache des Special Branch. Uns geht das nichts an.«
»Lieber Himmel!« Webberly zog Stewart den Bericht weg, an dem er gearbeitet hatte und rollte ihn zu Stewarts Entsetzen zu einer Röhre zusammen. »Nichts Prinz«, sagte er, die Röhre schwenkend. »Nur Cambridge. Klar?«
»Sir.«
»Danke.« Webberly bemerkte mit Erleichterung, daß MacPherson endlich sein Taschenmesser weggelegt hatte und Lynley ihn mit seinen unergründlichen dunklen Augen, die in so starkem Gegensatz zu seinem blonden Haar standen, aufmerksam ansah.
»Es geht um einen Mord, der gestern nacht in Cambridge verübt worden ist. Man hat uns ersucht, die Ermittlungen zu übernehmen«, sagte Webberly und schnitt mit einer kurzen abgehackten Handbewegung alle Kommentare und Einwände ab. »Ich weiß. Sie brauchen mich nicht daran zu erinnern. Vor zwei Wochen habe ich noch große Töne gespuckt, und jetzt habe ich den Salat. Schmeckt mir gar nicht, das können Sie mir glauben.«
»Hillier?« fragte Hale scharfsinnig.
Chief Superintendent Sir David Hillier war Webberlys Vorgesetzter. Wenn das Gesuch von ihm gekommen war, dann war es kein Gesuch, dann war es Gesetz.
»Nicht direkt. Hillier ist einverstanden. Er kennt den Fall. Aber das Gesuch war an mich direkt gerichtet.«
Drei der Männer tauschten neugierige Blicke; der vierte, Lynley, sah Webberly unverwandt an.
»Ich muß improvisieren«, fuhr Webberly fort. »Ich weiß, daß Sie alle im Augenblick bis zum Hals in Arbeit stecken. Ich kann jemanden aus einer der anderen Abteilungen bitten, aber ich würde es lieber nicht tun.« Er reichte Stewart seinen Bericht zurück und wartete schweigend, während er mit peinlicher Gewissenhaftigkeit die Papiere wieder glättete. Dann sprach er weiter. »Es handelt sich um den Mord an einer Studentin. Sie war im zweiten Jahr am St. Stephen’s College.«
Darauf reagierten alle vier. Eine abrupte Bewegung, ein fragender Ausruf, ein scharfer Blick in Webberlys Gesicht. Sie wußten alle, daß Webberlys Tochter am St. Stephen’s College studierte. Webberly sah die Besorgnis auf ihren Gesichtern.
»Es hat nichts mit Miranda zu tun«, beruhigte er seine Mitarbeiter. »Aber sie hat das Mädchen gekannt. Das ist einer der Gründe, weshalb man sich an mich gewandt hat.«
»Aber nicht der einzige«, warf Stewart ein.
»Richtig. Mich haben der Rektor des St. Stephen’s College und der Vizekanzler der Universität angerufen. Für die örtliche Polizei ist die Sache nicht ganz einfach. Sie ist einerseits berechtigt, nach eigenem Ermessen zu handeln, da der Mord nicht auf dem Collegegelände verübt wurde. Andererseits ist sie, da das Opfer an einem College eingeschrieben war, bei ihren Ermittlungen auf die Kooperation der Universität angewiesen.«
»Und ist die Uni etwa nicht bereit zu kooperieren?« fragte MacPherson ungläubig.
»Sie zieht eine außenstehende Behörde vor. Es hat offenbar wegen der Art und Weise, wie die Polizei im letzten Frühjahr einen Selbstmord behandelte, Unstimmigkeiten gegeben. Grobe Fahrlässigkeit, behauptete der Vizekanzler; außerdem seien vertrauliche Informationen an die Presse weitergegeben worden. Da das Mädchen die Tochter eines der Professoren ist, möchte man nun, daß alles mit größtem Takt und Feingefühl behandelt wird.«
»Gefragt ist Inspector Herzlieb«, bemerkte Hale mit sarkastisch herabgezogenen Mundwinkeln. Sie wußten alle, daß es ein ziemlich plumper Versuch von ihm war, sich als voreingenommen hinzustellen. Hales Eheprobleme waren allgemein bekannt. Das letzte, was er jetzt brauchte, war ein sich ewig hinziehender Fall irgendwo in der Provinz.
Webberly ignorierte ihn. »Die Kollegen in Cambridge sind natürlich nicht glücklich über die Situation. Es ist ihr Revier. Sie sind der Auffassung, daß sie die Ermittlungen leiten sollten. Wir können also nicht erwarten, daß sie sich vor Hilfsbereitschaft überschlagen werden, wenn wir kommen. Aber ich habe kurz mit dem zuständigen Superintendent gesprochen – einem gewissen Sheehan... Er scheint in Ordnung zu sein, und sie werden sich auf jeden Fall nicht querstellen. Er ärgert sich, daß man nicht bereit ist, ihm und seinen Leuten freie Hand zu lassen, aber er weiß natürlich auch, daß er überhaupt nichts erreichen wird, wenn die Universität ihre Kooperation verweigert.«
Ehe er fortfahren konnte, kam Dorothea Harriman ins Zimmer und legte ihm mehrere Blätter Papier mit dem Briefkopf der Polizei Cambridge auf den Tisch. Naserümpfend sammelte sie Plastikbecher und überquellende Aschenbecher ein, die zwischen Heftern und Berichten herumstanden, warf die Becher in den Papierkorb und trug die Aschenbecher mit ausgestrecktem Arm hinaus.
Noch beim Lesen des Berichts gab Webberly die enthaltenen Informationen an seine Mitarbeiter weiter.
»Viel ist das bis jetzt nicht«, sagte er. »Zwanzig Jahre alt. Elena Weaver.« Er gab dem Vornamen des Mädchens eine italienische Betonung.
»Ausländerin?« fragte Stewart.
»Das glaube ich nicht. Der Rektor des College sagte jedenfalls nichts davon. Die Mutter lebt in London, und der Vater ist, wie ich schon sagte, Professor an der Universität. Er ist einer der aussichtsreichsten Anwärter auf den Penford-Lehrstuhl für Geschichte, was auch immer das ist. Jedenfalls scheint er auf seinem Gebiet eine Kapazität zu sein.«
»Daher die Extrawurst«, bemerkte Hale bissig.
»Sie haben noch keine Autopsie vorgenommen«, fuhr Webberly fort, »aber grob geschätzt dürfte der Tod vergangene Nacht zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens eingetreten sein. Das Gesicht wurde mit einem schweren stumpfen Gegenstand zertrümmert, und dann wurde sie, den ersten Untersuchungen zufolge, erdrosselt.«
»Vergewaltigung?« fragte Stewart.
»Bisher kein Hinweis darauf.«
»Zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens?« fragte Hale. »Aber Sie sagten doch, sie sei nicht auf dem Collegegelände gefunden worden.«
Webberly nickte. »Richtig. Sie ist am Fluß gefunden worden.« Stirnrunzelnd las er die restlichen Informationen, die man ihm aus Cambridge gefaxt hatte. »Sie hatte einen Jogginganzug und Joggingschuhe an. Man vermutet deshalb, daß sie zum Lauftraining unterwegs war, als sie überfallen wurde. Die Leiche war mit Blättern zugedeckt. Irgendeine Malerin ist gegen Viertel nach sieben heute morgen über sie gestolpert. Und hat sich, wie Sheehan mir sagte, gleich an Ort und Stelle übergeben.«
»Doch hoffentlich nicht über die Leiche«, sagte MacPherson.
»Das wäre schlimm für die Freunde von der Spurensicherung«, meinte Hale.
Die anderen lachten gedämpft. Webberly störte sich nicht daran. Im jahrelangen Umgang mit Mord entwickelte auch der Sensibelste ein dickes Fell.
»Die werden voraussichtlich auch so mehr als genug zu tun haben«, gab er zurück.
»Wieso?« fragte Stewart.
»Das Mädchen wurde auf einer Insel gefunden, die anscheinend ein beliebter Treffpunkt für Liebespärchen und andere Leute ist. Sie haben ungefähr ein halbes Dutzend Säcke voll Müll eingesammelt, der analysiert werden muß.« Er warf den Bericht auf den Tisch. »Das ist im Moment alles, was wir wissen. Keine Autopsie. Keine Vernehmungsprotokolle. Wer den Fall übernimmt, muß also ganz von vorn anfangen.«
Lynley griff nach dem Bericht, setzte seine Brille auf und las schweigend. Als er fertig war, sagte er: »Ich mach das.«
»Ich dachte, Sie arbeiten noch an dem Kavaliersmord in Maida Vale«, sagte Webberly erstaunt.
»Den haben wir gestern nacht geklärt. Genauer gesagt, heute morgen. Wir haben den Täter um halb drei verhaftet.«
»Du meine Güte, dann machen Sie doch mal ne Pause, Jungchen«, sagte MacPherson.
Lynley lächelte nur und stand auf. »Hat einer von Ihnen zufällig Havers gesehen?«
Sergeant Barbara Havers saß im Informationszentrum im Erdgeschoß von New Scotland Yard vor einem der grünen Computerbildschirme. Eigentlich sollte sie Angaben über Vermißte heraussuchen – solche, die seit mindestens fünf Jahren verschwunden waren, meinte der Gerichtsanthropologe –, weil man versuchen wollte, dem menschlichen Gerippe, das unter dem Kellerboden eines Abbruchhauses auf der Isle of Dogs gefunden worden war, einen Namen zu geben. Sie hatte sich aus reiner Gefälligkeit bereit erklärt, den Job für einen Kollegen von der Dienststelle Manchester Road zu übernehmen, aber sie war nicht in der geistigen Verfassung, die auf dem Bildschirm erscheinenden Fakten aufzunehmen, geschweige denn sie mit einer Liste genauer Maße von Ellen und Speichen, Oberschenkelknochen, Schienbeinen und Wadenbeinen zu vergleichen. Gereizt rieb sie sich die Augen und sah zum Telefon, das auf dem Nachbarschreibtisch stand.
Sie sollte zu Hause anrufen; versuchen mit ihrer Mutter zu sprechen, oder wenigstens mit Mrs. Gustafson, um sich zu vergewissern, daß alles in Ordnung war. Aber sie schaffte es nicht. Es war ja im Grunde auch sinnlos. Mrs. Gustafson war fast taub, und ihre Mutter lebte in ihrem eigenen Wolkenkuckucksheim fortschreitender geistiger Verwirrung. Die Chance, daß Mrs. Gustafson das Läuten des Telefons hörte, war so gering wie die Wahrscheinlichkeit, daß ihre Mutter begreifen würde, was das schrille Läuten des schwarzen Apparats in der Küche zu bedeuten hatte. Wenn sie es hörte, könnte es ebensogut passieren, daß sie, statt ans Telefon zu gehen, das Backrohr öffnete oder an die Haustür ging. Und selbst wenn sie es schaffte, den Hörer abzuheben, war zweifelhaft, ob sie Barbaras Stimme erkennen oder sich überhaupt erinnern würde, wer Barbara war.
Ihre Mutter war dreiundsechzig Jahre alt. Sie war bei ausgezeichneter körperlicher Gesundheit. Nur ihr Geist war verwirrt.
Derzeit kümmerte sich Mrs. Gustafson tagsüber um Doris Havers, aber Barbara war sich völlig im klaren darüber, daß das nur eine Notlösung sein konnte. Mrs. Gustafson, die selbst schon zweiundsiebzig war, besaß weder die Kraft noch das Verständnis, sich einer Frau anzunehmen, die den ganzen Tag so sorgfältig beaufsichtigt werden mußte wie ein Kleinkind. Dreimal war Barbara bereits mit den Grenzen dieses Arrangements konfrontiert worden. Zweimal hatte sie, später als sonst vom Dienst zurück, Mrs. Gustafson selig schnarchend im Wohnzimmer vor dem dröhnenden Fernsehgerät vorgefunden, während ihre Mutter sich auf Wanderschaft begeben hatte, zum Glück nur in den Garten hinaus.
Der dritte Zwischenfall vor erst zwei Tagen hatte sie jedoch zu Tode erschreckt. Sie hatte dienstlich in der Nähe ihres eigenen Wohnviertels zu tun gehabt und war auf einen Sprung nach Hause gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Das Haus war leer. Zunächst dachte sie sich nichts dabei; sie glaubte, Mrs. Gustafson habe ihre Mutter zu einem Spaziergang mitgenommen, und war der alten Frau dankbar, daß sie sich diese Mühe machte.
Aber alle Dankbarkeit verflog, als keine fünf Minuten später Mrs. Gustafson im Haus erschien. Sie sei nur schnell nach Hause gelaufen, um ihre Fische zu füttern, erklärte sie und fügte hinzu: »Es ist doch nichts mit Ihrer Mutter, oder?«
Im ersten Moment konnte Barbara nicht glauben, was Mrs. Gustafsons Frage besagte. »Ist sie denn nicht bei Ihnen?« fragte sie.
Mrs. Gustafson hob die von Altersflecken übersäte Hand zum Hals, und ein Zittern setzte die grauen Locken ihrer Perücke in heftige Bewegung. » Ich war nur schnell drüben, um die Fische zu füttern«, sagte sie. »Höchstens ein, zwei Minuten, Barbie.«
Barbaras Blick flog zur Uhr. Panik überfiel sie, Schreckensbilder stiegen vor ihr auf: Ihre Mutter tot, überfahren in der Uxbridge Road; niedergedrängt von den Menschenmassen in der Untergrundbahn; auf verzweifelter Suche nach dem Friedhof in South Ealing, auf dem ihr Sohn und ihr Mann beerdigt waren; überfallen oder gar niedergeschlagen.
Sie stürzte aus dem Haus, während Mrs. Gustafson händeringend zurückblieb und klagend rief: » Ich war doch nur bei den Fischen«, als sei das eine Entschuldigung für ihre Fahrlässigkeit. Sie sprang in ihren Mini und raste zur Uxbridge Road. Sie brauste durch Seitenstraßen und Hintergassen. Sie hielt Leute an, um zu fragen. Sie rannte in Läden und Geschäfte. Und sie fand ihre Mutter schließlich im Hof der Grundschule, die einst Barbara und ihr lang verstorbener kleiner Bruder besucht hatten.
Der Rektor hatte schon die Polizei alarmiert. Zwei Beamte – ein Mann und eine Frau – sprachen auf Doris Havers ein, als Barbara kam. An den Fenstern der Schule drückten sich neugierige Kinder die Nasen platt. Kein Wunder, dachte sie, bei dem Anblick, den ihre Mutter bot. Sie hatte nichts weiter an als eine sommerliche Kittelschürze und Hausschuhe. Die Brille hatte sie aus irgendeinem Grund auf den Kopf geschoben. Ihr Haar war ungekämmt, ihr Körper roch ungewaschen. Sie babbelte und zappelte wie eine Verrückte. Als die Beamtin sie beim Arm nehmen wollte, wich sie geschickt aus und rannte laut nach ihren Kindern rufend auf das Schulhaus zu.
Das war vor gerade zwei Tagen gewesen, ein deutliches Zeichen, daß Mrs. Gustafson mit ihrer Aufgabe überfordert war.
In den acht Monaten seit dem Tod ihres Vaters hatte Barbara alles mögliche versucht, um das Problem der Versorgung ihrer Mutter zu lösen. Zuerst hatte sie sie in ein Seniorenzentrum gebracht. Aber dort konnte man die »Klienten« höchstens bis neunzehn Uhr behalten, Barbaras Arbeitszeiten bei der Polizei jedoch waren unregelmäßig. Hätte Lynley, Barbaras Vorgesetzter, gewußt, daß sie spätestens um sieben ihre Mutter abholen mußte, so hätte er darauf bestanden, daß sie sich die Zeit dazu nahm. Aber für ihn wäre das eine zusätzliche Arbeitsbelastung gewesen, und Barbara bedeuteten ihre Arbeit und die Partnerschaft mit Thomas Lynley zuviel; niemals hätte sie sie wegen persönlicher Probleme aufs Spiel gesetzt.
Danach hatte sie es mit diversen Tageshilfen und Gesellschafterinnen versucht, vier hintereinander, die insgesamt ganze zwölf Wochen blieben. Sie hatte beim Sozialamt eine Haushaltshilfe beantragt. Und am Ende hatte sie auf ihre Nachbarin, Mrs. Gustafson, zurückgegriffen. Trotz der Warnungen ihrer eigenen Tochter war Mrs. Gustafson als Retterin in der Not eingesprungen. Aber eine Dauerlösung war das nicht. Barbara wußte, daß nur noch ein Heim in Frage kam. Aber die Vorstellung, ihre Mutter in ein städtisches Heim zu stecken, in dem so ziemlich alles im argen lag, war ihr unerträglich. Ein privates Heim andererseits konnte sie nicht bezahlen.
Sie kramte die Karte aus ihrer Jackentasche, die sie am Morgen eingesteckt hatte. Hawthorn Lodge, stand darauf. Uneeda Drive, Greenford. Ein kurzer Anruf bei Florence Magentry, und alle ihre Probleme wären gelöst.
»Mrs. Flo«, hatte Mrs. Magentry gesagt, als sie am Morgen um halb zehn auf Barbaras Klopfen geöffnet hatte. »So nennen mich meine Damen. Mrs. Flo.«
Sie wohnte in einem einstöckigen Reihenhaus aus der ersten Bauphase nach 1945, das sie romantisch »Hawthorne Lodge« getauft hatte. Backsteinfassade, rostrot gestrichene Tür und Fensterrahmen, ein Erkerfenster mit Blick in einen Vorgarten voller Gartenzwerge. Durch die Haustür gelangte man in einen kleinen Flur mit Treppe nach oben. Rechts befand sich ein Wohnzimmer, in das Mrs. Flo Barbara führte, während sie ohne Punkt und Komma von den »Annehmlichkeiten« erzählte, die das Haus den Damen bot, die hier zu Besuch weilten.
»Ich sage immer Besuch«, erklärte Mrs. Flo und tätschelte Barbaras Arm mit weicher, weißer und überraschend warmer Hand. »Das klingt nicht so endgültig, nicht wahr? Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles.«
Barbara wußte genau, daß sie das Positive zu sehen suchte. Im Geist ging sie die einzelnen Punkte durch. Bequeme Möbel im Wohnzimmer – abgenützt, aber solide –, dazu ein Fernsehgerät, eine Stereoanlage, zwei Borde mit Büchern und eine große Sammlung Zeitschriften; frischer Anstrich und neue Tapeten, freundliche Bilder an den Wänden; eine saubere Küche mit einer Eßnische, deren Fenster nach hinten zum Garten hinausgingen; oben vier Zimmer, eines für Mrs. Flo, die anderen drei für die » Damen«. Zwei Toiletten, eine oben, eine unten, beide blitzsauber. Und Mrs. Flo selbst mit ihrem modernen Kurzhaarschnitt und dem adretten Hemdblusenkleid mit Blumenbrosche am Kragen. Sie sah aus wie eine elegante ältere Dame, und sie roch nach Zitrone.
»Sie haben genau im richtigen Moment angerufen«, hatte sie gesagt. »Wir haben letzte Woche unsere liebe Mrs. Tilbird verloren. Dreiundneunzig war sie. Aber hellwach, sage ich Ihnen. Sie ist einfach eingeschlafen, wirklich ein Segen. So friedlich. Im nächsten Monat wäre sie zehn Jahre bei mir gewesen.« Mrs. Flos Augen wurden feucht. »Nun ja, niemand lebt ewig, nicht wahr? Möchten Sie die Damen kennenlernen?«
Die Bewohnerinnen von Hawthorne Lodge saßen warm eingepackt im Garten in der Morgensonne. Sie waren nur zu zweit, die eine eine vierundachtzigjährige Blinde, die Barbaras Begrüßung lächelnd erwiderte und dann augenblicklich einnickte, und die andere eine verängstigt wirkende Frau Mitte Fünfzig, die wie ein Kind Mrs. Flos Hand umklammerte und sich auf ihrem Stuhl ganz klein machte. Barbara kannte die Symptome.
»Können Sie denn mit zweien fertigwerden?« fragte sie unumwunden.
Mrs. Flo strich der Frau, die immer noch ihre Hand umklammert hielt, über das Haar. »Ich habe keine Schwierigkeiten mit ihnen. Gott lädt jedem eine Last auf, ist es nicht so? Aber keinem teilt er eine Last zu, die schwerer ist, als er tragen kann.«
An diese Worte dachte Barbara jetzt. War es vielleicht so, daß sie versuchte, eine Last abzuwälzen, die sie selbst aus Faulheit oder Egoismus nicht tragen wollte?
Sie wich der Frage aus, indem sie sich alles vor Augen hielt, was für einen Umzug ihrer Mutter nach Hawthorne Lodge sprach: die Nähe zum Bahnhof Greenford und die Tatsache, daß sie nur einmal würde umsteigen müssen – in der Tottenham Court Road –, wenn sie ihre Mutter bei Mrs. Flo unterbrachte und selbst das kleine Häuschen nahm, das sie mit viel Glück in Chalk Farm aufgetrieben hatte; der Obst- und Gemüsestand direkt am Bahnhof, an dem sie ihrer Mutter vor einem Besuch frisches Obst besorgen konnte; der kleine Park nur eine Straße weiter mit einer Weißdornallee, die zu einem Spielplatz mit Schaukeln, Wippe, Karussell und Bänken führte, wo sie sich niedersetzen und den Kindern zusehen konnten; die Geschäfte in unmittelbarer Nähe – eine Reinigung, ein Supermarkt, ein Spirituosenladen, eine Bäckerei und sogar ein chinesisches Restaurant, das über die Straße verkaufte.
Aber noch während sie sich all diese Punkte aufzählte, die für einen Anruf bei Mrs. Flo sprachen, war Barbara sich auch der wenigen Negativpunkte bewußt, die ihr in dem Haus in Greenford aufgefallen waren. Gegen den Verkehrslärm der A 40, sagte sie sich, könnte man eben nichts machen, und es sei nun mal nicht zu ändern, daß die kleine Gemeinde Greenford genau zwischen Eisenbahn und Autoschnellstraße eingekeilt war. Ihr fielen die zwei zerbrochenen Gartenzwerge im Vorgarten ein, dem einen hatte die Nase gefehlt, dem anderen der Arm. Absurd, sich damit zu befassen, aber die beschädigten Figuren hatten irgendwie so erbärmlich gewirkt. Und die glänzenden Stellen an der Sofalehne, wo fettige alte Köpfe zu lange in die Polster gedrückt gewesen waren, hatten etwas Schauriges gehabt. Und die Krümel am Mundwinkel der Blinden...
Kleinigkeiten, wies sie sich selbst zurecht, kleine Widerhaken, die sich in ihr Schuldgefühl einhängten. Man konnte nicht überall Perfektion erwarten. Außerdem waren alle diese nicht ganz so erfreulichen Dinge harmlos im Vergleich zu ihren Lebensverhältnissen in Acton und dem Zustand des Hauses, in dem sie jetzt lebten.
Aber in Wirklichkeit ging es eben um mehr als eine Entscheidung zwischen Acton und Greenford, um mehr als die Frage, ob sie ihre Mutter zu Hause behalten oder in einem Heim unterbringen sollte. Es ging um Barbaras eigene Wünsche: ein Leben fern von Acton, fern von ihrer Mutter und den Lasten, die zu tragen sie sich im Gegensatz zu Mrs. Flo nicht gerüstet fühlte.
Der Erlös aus dem Verkauf des Hauses in Acton würde reichen, den Aufenthalt ihrer Mutter bei Mrs. Flo zu bezahlen. Und sie könnte das Häuschen in Chalk Farm nehmen. Es machte nichts, daß es gerade einmal dreißig Quadratmeter groß war, nicht viel mehr als ein umfunktionierter Schuppen mit einem Backsteinkamin und einem Dach, dem zahlreiche Schindeln fehlten. Es hatte Möglichkeiten. Und mehr verlangte Barbara längst nicht mehr vom Leben, nur die Verheißung, den Hauch einer Möglichkeit.