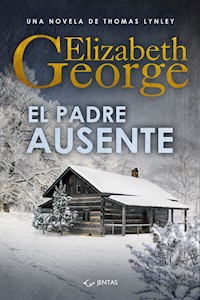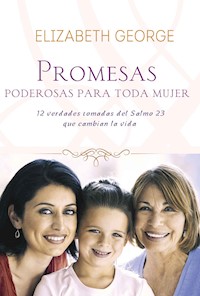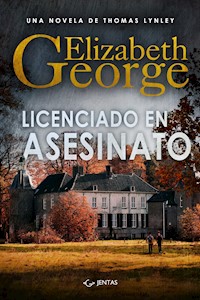9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
Bernard Fairclough ist das Oberhaupt einer wohlhabenden und einflussreichen Familie, die ihren Sitz im Lake District hat. Nichts ist ihm wichtiger, als jeden Makel, der die schöne Fassade beschädigen könnte, zu vermeiden. Als sein Neffe eines Tages tot im See aufgefunden wird, erklärt die örtliche Polizei schnell, dass es sich um einen Unfall handelt. Fairclough, der dennoch jeden Verdacht ausräumen will, engagiert Inspector Thomas Lynley von New Scotland Yard. Und wie dieser schon bald entdeckt, gibt es einige Familienmitglieder, die einen Grund gehabt hätten, Ian Cresswell Böses zu wollen. Zusammen mit seiner Kollegin Barbara Havers in London kommt er den Geheimnissen der Faircloughs Schritt für Schritt näher – und entdeckt dabei hinter der Fassade das Trümmerfeld ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1026
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Elizabeth George
Glaube der Lüge
Ein Inspector-Lynley-Roman
Ins Deutsche übertragenvon Charlotte Breuer undNorbert Möllemann
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel»Believing the Lie« bei Dutton,a member of Penguin Group (USA) Inc., New York.
1. Auflage
Copyright © 2012 by Susan Elizabeth George
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Gettyimages, Bertrand Demee und trevillion,Andy & Michelle Kerry
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-08041-9
www.goldmann-verlag.de
In Gedenken an Anthony MottBrillanter ErzählerVerehrter FreundAntonio für mich
This life’s five windows of the soulDistort the heavens from pole to pole,And lead you to believe a lie,When you see with not through the eye.Der Seele ird’sche Fenster zeigenDas Himmlische verzerrt, zerstückt;Du wirst den Trug zu glauben neigen,Wenn’s Aug’ nur sieht – und nicht erblickt.
William Blake(Übersetzt von Sebastian Wohlfeil)
10. Oktober
FLEET STREET – LONDON
Zed Benjamin war noch nie ins Zimmer des Chefredakteurs gerufen worden, und er fand die Erfahrung zugleich beunruhigend und aufregend. Weil ihm nicht wohl bei der ganzen Sache war, schwitzte er unter den Achseln. Und vor lauter Aufregung hatte er solch ein Herzklopfen, dass er es bis in die Daumenspitzen spüren konnte. Aber da er mit der Einstellung angetreten war, Rodney Aronson als ganz normalen Kollegen bei der Source zu betrachten, führte er das Schwitzen und die pulsierenden Daumen darauf zurück, dass er seinen einzigen Sommeranzug zu früh gegen seinen einzigen Winteranzug ausgetauscht hatte. Er nahm sich vor, am nächsten Morgen wieder den Sommeranzug anzuziehen – falls seine Mutter ihn nicht schon in die Reinigung gebracht hatte, was er nicht hoffte. Obwohl es zu ihr passen würde, dachte Zed. Seine Mutter war hilfsbereit und zuverlässig. Und zwar beides eine Spur zu sehr.
Er suchte nach einer Ablenkung, die in Rodney Aronsons Zimmer leicht zu finden war. Während der Chefredakteur Zeds Story las, überflog Zed die Schlagzeilen der alten Ausgaben der Boulevardzeitung, die gerahmt an den Wänden hingen. Er fand sie geschmacklos und idiotisch, die Storys appellierten an die niedersten menschlichen Instinkte. CALLBOY BRICHT SCHWEIGEN zum Beispiel handelte vom Stelldichein eines Parlamentsabgeordneten mit einem Sechzehnjährigen in einem Auto in der Nähe der King’s Cross Station, das durch das Eintreffen von zwei Polizisten vom Sittendezernat jäh unterbrochen worden war. Der Artikel daneben war betitelt mit PARLAMENTSABGEORDNETER: FLOTTER DREIER MIT TEENAGER, und der nächste trug die Überschrift EHEFRAU DES ABGEORDNETEN VERÜBT SELBSTMORD. Für die Source waren diese Storys ein voller Erfolg gewesen, ihre Reporter waren als Erste vor Ort gewesen, sie hatten die Nachricht als Erste gebracht, und sie hatten als Erste Informanten für schlüpfrige Einzelheiten bezahlt, um einen Vorfall aufzupeppen, den jede seriöse Zeitung entweder diskret behandelt oder versteckt auf der letzten Seite gebracht hätte – oder beides. Das galt vor allem für solche heißen Themen wie: PRINZ RANDALIERT IM SCHLAFZIMMER, STALLMEISTER PLAUDERT – PALAST SCHOCKIERT und SCHON WIEDER EINE KÖNIGLICHE SCHEIDUNG? Sensationsgeschichten, so viel hatte Zed in Gesprächen in der Kantine mitbekommen, hatten dem Blatt eine Mehrauflage von über hunderttausend beschert. Dafür war die Zeitung bekannt. Und jedem in der Redaktion war klar: Wer sich nicht die Hände schmutzig machen und in der schmutzigen Wäsche anderer Leute wühlen wollte, der sollte besser nicht als Journalist bei der Source anfangen.
Aber genau das war Zedekiah Benjamins Problem: Es widerstrebte ihm zutiefst, als Enthüllungsjournalist bei der Source zu arbeiten. In seinen Augen war er eher der Typ, der zur Financial Times passte, mit ausreichend Status und Renommee, womit er seine wahre Leidenschaft hätte finanzieren können, nämlich Gedichte zu schreiben. Aber Stellen für Kolumnisten bei seriösen Blättern waren so selten wie die Blaue Mauritius, und mit irgendetwas musste man schließlich seine Brötchen verdienen, wenn das mit Poesie nicht machbar war. Zed wusste also, dass es sich für ihn geziemte, sich so zu verhalten, als sähe er seine berufliche Erfüllung als Journalist darin, die Fehltritte von Berühmtheiten und die kleinen Sünden der Royals zu enthüllen. Dennoch war er der Meinung, dass selbst ein Blatt wie die Source davon profitieren konnte, hin und wieder ein klein wenig aus dem Sumpf der Menschenverachtung emporgehoben zu werden.
Der Artikel, den Rodney Aronson gerade las, war ein gutes Beispiel dafür. In Zeds Augen musste eine Story in einer Boulevardzeitung nicht notwendigerweise vor schlüpfrigen Details strotzen. Okay, sie käme vielleicht nicht auf die Titelseite, sondern war eher etwas für die Sonntagsbeilage, wobei ein doppelseitiger Mittelteil in der täglichen Ausgabe auch nicht übel wäre, Hauptsache, es gab Fotos und einen Verweis auf die Fortsetzung auf der nächsten Seite. Zed hatte ewig an dieser Story gearbeitet, und sie enthielt alles, was Source-Lesern gefiel, allerdings mit mehr Stil: Die Sünden der Väter und ihrer Söhne wurden ausgebreitet, zerrüttete Beziehungen wurden erforscht, Drogen- und Alkoholmissbrauch sorgten für Würze, und schließlich gab es sogar ein Happy End. Es war die Geschichte eines Prassers, dem es in – mehr oder weniger – allerletzter Minute gelang, sich von einer tödlichen Methamphetaminsucht zu befreien und sich ganz neu zu erfinden, indem er sein Leben den Ärmsten der Armen widmete. Es war eine Geschichte von Schurken und Helden, von würdigen Gegnern und immerwährender Liebe. Es war eine Geschichte über exotische Schauplätze, Familienwerte und Elternliebe. Und vor allem …
»Da schlafen einem ja die Füße ein.« Rodney Aronson warf Zeds Story auf den Schreibtisch und befingerte seinen Bart. Fand einen Krümel Schokolade darin und steckte ihn sich in den Mund. Er hatte beim Lesen eine Tafel Schokolade gegessen, und seine rastlosen Augen wanderten jetzt über seinen Schreibtisch auf der Suche nach Nachschub, den er in Anbetracht des von der übergroßen Safari-Jacke, seiner bevorzugten Arbeitskleidung, schlecht verhüllten Leibesumfangs weiß Gott nicht brauchte.
»Wie bitte?« Zed meinte, sich verhört zu haben, und überlegte krampfhaft, was sich auf Füße ein reimen könnte, um sich zu vergewissern, dass sein Chefredakteur seine Story nicht soeben auf die unterste Ecke von Seite zwanzig verbannt hatte oder Schlimmeres.
»Mir schlafen die Füße ein!«, sagte Rodney. »Sie haben mir eine gepfefferte Enthüllungsstory versprochen, wenn ich Sie da raufschicke. Sie haben mir, wenn ich mich recht erinnere, sogar eine Enthüllungsstory garantiert, wenn ich Ihnen ein Hotelzimmer bezahle für Gott weiß wie viele Tage …«
»Fünf«, sagte Zed. »Es gestaltete sich nämlich etwas komplizierter. Ich musste diverse Leute interviewen, um die Objektivität zu wahren …«
»Also gut, fünf. Über die Wahl Ihres Hotels werden wir uns übrigens auch noch unterhalten, denn ich habe die Rechnung gesehen und mich gefragt, ob im Zimmerpreis Bauchtänzerinnen enthalten waren. Wenn einer auf Kosten der Zeitung für fünf Tage nach Cumbria geschickt wird, weil er uns eine hammermäßige Geschichte in Aussicht stellt …« Rodney nahm die Seiten vom Schreibtisch und wedelte damit in der Luft. »Was zum Teufel haben Sie hier recherchiert? Und was hat in Gottes Namen der Titel zu bedeuten? ›Das neunte Leben‹. Was ist das hier? Ein Machwerk aus einem von Ihren hochintellektuellen Literaturseminaren? Oder aus einem Kurs für kreatives Schreiben? Halten Sie sich etwa für einen Schriftsteller?«
Zed wusste, dass der Chefredakteur kein Universitätsstudium absolviert hatte. Das erzählte man sich ebenfalls in der Kantine. Kurz nachdem Zed bei der Source angefangen hatte, hatte ihm jemand sotto voce zugeraunt: Wenn dir dein Leben lieb ist, Kumpel, komm Rod nur ja nicht mit irgendwas, das ihn daran erinnert, dass du irgendeinen Abschluss hast, der auch nur entfernt was mit höherer Bildung zu tun hat. Das hat nur zur Folge, dass er sich verarscht fühlt. Also halt am besten einfach die Klappe, wenn was Derartiges zur Sprache kommt.
Und so antwortete Zed äußerst vorsichtig auf Rodneys Frage nach dem Titel seiner Story. »Das ist eine Anspielung auf Katzen.«
»Auf Katzen.«
»Äh … die sollen doch neun Leben haben.«
»Okay, gebongt. Aber wir schreiben nicht über Katzen, oder?«
»Nein. Natürlich nicht …« Zed wusste nicht so recht, worauf der Chefredakteur hinauswollte, und fuhr einfach fort mit seiner Erklärung. »Es geht darum, dass der Typ achtmal einen Entzug gemacht hat, verstehen Sie, und zwar in drei Ländern, und nichts hat ihm geholfen, wirklich gar nichts. Okay, er war vielleicht sechs, acht Monate clean, einmal sogar ein ganzes Jahr, aber er ist immer wieder rückfällig geworden. Dann fährt er nach Utah, wo er eine ganz außergewöhnliche Frau kennenlernt, und auf einmal ist er ein neuer Mensch.«
»Simsalabim, die wunderbare Wandlung, und das war’s? Gerettet durch die Liebe?« Die Frage klang freundlich, und Zed schöpfte Mut.
»Ganz genau. Das ist einfach unglaublich. Er ist völlig geheilt. Okay, bei seiner Heimkehr wird kein gemästetes Kalb geschlachtet …«
»Kalb geschlachtet?«
Zed ruderte hastig zurück. Eine Anspielung auf die Bibel, ganz schlechte Taktik. »Dumme Bemerkung, sorry. Er kommt also zurück und gründet ein Projekt, um denen zu helfen, denen nicht mehr zu helfen ist.« War das zu dick aufgetragen? »Und nicht etwa für Jugendliche, die ihr Leben noch vor sich haben. Nein, für Asoziale. Seine Schützlinge sind alte Penner, gesellschaftlicher Abfall …«
Rodney sah ihn an.
»Ausgestoßene, die ihre verfaulten Zähne ausspucken, während sie ihr Essen aus Mülltonnen klauben. Er findet, dass sie es verdient haben, gerettet zu werden. Und das funktioniert tatsächlich. Die werden geheilt. Ein Leben lang ein Herumtreiber, ein Leben im Suff und im Drogenrausch, und auf einmal sind die clean. Zusammen bauen sie diese alten Wehrtürme wieder auf.« Zed holte tief Luft. Wartete auf Rodneys Reaktion.
Sie kam ruhig, aber mit einem Unterton, der auf mangelnde Begeisterung schließen ließ. »Keiner von diesen Typen ist clean, Zed. Wenn der Turm fertig ist, sind die schneller wieder auf der Straße, als wir kucken können.«
»Das glaube ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil es sich um einen Wehrturm handelt. Und das ist der Hammer an der Geschichte. Es ist eine Metapher für alles andere.« Zed wusste, dass ihn allein dieser Begriff auf gefährliches Terrain brachte, also redete er atemlos weiter. »Überlegen Sie doch mal, wozu diese Türme früher gedient haben, dann verstehen Sie, was ich meine. Sie wurden zum Schutz gegen marodierende Banden errichtet – gegen diese Räuberbanden, die aus Schottland über die Grenze kamen –, und in unserem Fall stehen die Marodeure für Drogen, okay? Meth, Koks, Hasch, Heroin, was auch immer. Der Wehrturm steht für Rettung und Heilung, und wenn man sich dann überlegt, welche Bedeutung das hat oder haben könnte für einen, der seit zehn, fünfzehn Jahren ein Herumtreiber ist, dann …«
Rodney legte den Kopf auf seinen Schreibtisch. Er wedelte mit der Hand.
Zed wusste nicht, wie er reagieren sollte. Es sah aus, als wäre er entlassen, doch er würde nicht einfach so den Schwanz einziehen … Gott, schon wieder eine Metapher, dachte er. »Genau das«, fuhr er eindringlich fort, »gibt der Story den Pfiff. Genau deswegen ist es die perfekte Story für die Sonntagsbeilage. Ich sehe es schon vor mir: Vier komplette Seiten mit Fotos: der Turm, die Typen, die ihn wiederaufbauen, das Vorher und Nachher und so weiter.«
»Mir schlafen die Füße ein«, sagte Rodney noch einmal. »Was übrigens auch eine Metapher ist. Sexy ist diese Story jedenfalls ganz und gar nicht.«
»Sexy«, wiederholte Zed. »Na ja, die Ehefrau ist tatsächlich eine schillernde Figur, aber sie wollte nicht, dass es um sie geht oder um die Beziehung. Sie sagt, er ist schließlich derjenige …«
Rodney hob eine Hand. »Ich rede nicht von sexy wie bei Sex, Sie Idiot. Ich rede von sexy wie spannend.« Er schnippte mit den Fingern. »Das Prickeln, die Ungeduld, das, was den Leser neugierig macht, die Vorfreude, die Erregung, das, was den Leser geil macht, ohne dass er weiß, wieso. Hab ich mich klar genug ausgedrückt? Ihre Geschichte hat nichts davon.«
»Aber darum geht es doch auch gar nicht. Sie soll erbaulich sein, den Lesern Hoffnung geben.«
»Wir verkaufen keine Erbauung, und wir verkaufen erst recht keine Hoffnung. Wir verkaufen Zeitungen. Und glauben Sie mir, mit diesem Geschwafel werden wir unsere Verkaufszahlen nicht steigern. Unser Markenzeichen ist eine ganz bestimmte Art des investigativen Journalismus. In Ihrem Vorstellungsgespräch haben Sie behauptet, das sei Ihnen bekannt. Und deswegen sind Sie doch nach Cumbria gefahren, oder? Tun Sie gefälligst Ihren Job, verdammt noch mal!«
»Das habe ich getan!«
»Blödsinn. Das ist ein rührseliger Scheißdreck! Irgendjemand da oben hat Sie total eingewickelt …«
»Ganz und gar nicht!«
»… und Sie haben prompt einen Rückzieher gemacht.«
»Nein.«
»Das hier …« Wieder wedelte er mit den Seiten. »… soll also der große Wurf sein? So wollen Sie eine Story aufreißen?«
»Äh, na ja … nicht direkt. Aber, ich meine, als ich den Typen kennengelernt habe, da …«
»… haben Sie die Flatter gekriegt, und schon war’s vorbei mit dem Recherchieren.«
Diese Schlussfolgerung fand Zed ziemlich unfair. »Wollen Sie damit sagen, dass eine Geschichte von einem versauten Leben, von gequälten Eltern, die alles versucht haben, um ihren drogenabhängigen Sohn zu retten, der sich am Ende selbst aus dem Schlamassel zieht … Eine Geschichte über einen Typen, der beinahe an seinem goldenen Löffel erstickt wäre … Wollen Sie behaupten, dass das kein investigativer Journalismus ist? Dass das nicht sexy ist? Nicht so sexy, wie Sie es gerne hätten?«
»Der Sohn von irgendeinem adligen Affen ist also drogensüchtig.« Er gähnte theatralisch. »Wahnsinn. Wenn Sie wollen, nenne ich Ihnen aus dem Stand die Namen von zehn weiteren Blindgängern, für die dasselbe gilt.«
Zed spürte, wie ihn der Kampfgeist verließ. All die vertane Zeit, all die vergeudete Energie, all die Interviews, die er geführt hatte – alles umsonst. Das war nicht recht. Zed überlegte, welche Möglichkeiten ihm blieben. Schließlich sagte er: »Okay, akzeptiert. Aber ich könnte es ja noch mal versuchen. Noch mal da rauffahren und ein bisschen tiefer graben.«
»Und wonach, verdammt noch mal?«
Das genau war die Frage. Zed dachte an all die Leute, mit denen er geredet hatte: den Exjunkie, seine Frau, seine Mutter, seine Schwestern, seinen Vater, an die armen Schlucker, die er retten wollte. Gab es irgendwo irgendjemanden, der etwas Verbotenes tat; etwas, was er, Zed, übersehen hatte? Den gab es garantiert, und zwar aus dem simplen Grund, dass es immer so jemanden gab. »Ich weiß nicht«, sagte Zed. »Aber wenn ich ein bisschen rumschnüffle … Jeder hat irgendein Geheimnis. Jeder sagt über irgendwas die Unwahrheit. Und nach allem, was wir bereits in die Geschichte investiert haben, kann es nicht schaden, wenn ich’s noch mal versuche.«
Rodney schob sich mit seinem Stuhl vom Schreibtisch zurück und schien sich Zeds Angebot durch den Kopf gehen zu lassen. Er wählte eine Nummer auf seinem Telefon, blaffte seine Sekretärin an: »Wallace? Sind Sie da?«, und als sie antwortete: »Bringen Sie mir noch eine Tafel Schokolade. Diesmal mit Haselnüssen.« Dann sagte er zu Zed: »Also gut, aber Sie machen das auf eigene Rechnung. Wenn nicht, vergessen Sie’s.«
Zed blinzelte. Das war natürlich etwas ganz anderes. Er stand bei der Source auf der untersten Stufe der Leiter, und entsprechend sah sein Gehalt aus. Er überschlug die Kosten für ein Zugticket, einen Mietwagen, ein Hotelzimmer – vielleicht konnte er in einem heruntergekommenen Bed & Breakfast absteigen oder in einer Pension in einer Seitenstraße in … ja, wo? Jedenfalls in keinem Ort an einem der Seen. Das wäre zu teuer, selbst jetzt, außerhalb der Saison. Also müsste er … Und würde überhaupt seine Arbeitszeit bezahlt werden, solange er sich in Cumbria aufhielt? Wahrscheinlich nicht. »Kann ich mir das noch mal überlegen?«, fragte er. »Sie werden die Story doch nicht gleich in die Tonne treten, oder? Ich muss erst mal Kassensturz machen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Lassen Sie sich Zeit.« Rodney lächelte, ein seltsames und unnatürliches Dehnen der Lippen, das verriet, wie ungewohnt ihm diese Übung war. »Wie gesagt, Sie machen das auf eigene Rechnung.«
»Danke, Rodney.« Zed war sich nicht ganz sicher, für was er sich eigentlich bei dem Mann bedankte. Er nickte, stand auf und ging zur Tür. Als er gerade die Klinke drücken wollte, sagte Rodney freundlich: »Falls Sie sich dafür entscheiden sollten, rate ich Ihnen, auf Ihre Mütze zu verzichten.«
Bevor Zed darauf etwas antworten konnte, fuhr Rodney fort: »Das hat nichts mit Ihrer Religion zu tun, Kumpel. Es interessiert mich nicht die Bohne, was für eine Religion Sie ausüben. Das ist ein guter Rat von einem, der schon in diesem Geschäft war, als Sie noch in die Windeln gemacht haben. Tun Sie, was Sie für richtig halten, aber Sie sollten die Leute nach Möglichkeit mit nichts von der Vorstellung ablenken, dass Sie ihr Beichtvater sind, ihr bester Freund, ihr Psycho-Onkel, was weiß ich. Wenn Sie also irgendwas anhaben, das die Aufmerksamkeit der Leute von dem ablenkt, was sie Ihnen erzählen wollen – oder noch besser, von dem, was sie nicht erzählen wollen –, dann haben Sie ein Problem. Und damit meine ich jede Art von Accessoire: Turbane, Rosenkränze, Beanies, hennarote Bärte, Dolche im Gürtel. Können Sie mir folgen? Was ich sagen will, ist, dass ein investigativer Journalist sich optisch einfügt – und mit so einer Mütze auf dem Kopf … An Ihrer Größe können Sie nichts ändern oder an Ihrem Haar – es sei denn, Sie färben es, und das verlange ich nicht von Ihnen –, aber die Mütze ist zu viel des Guten.«
Reflexhaft berührte Zed seine Kippa. »Ich trage sie, weil …«
»Es interessiert mich nicht, warum Sie sie tragen. Es interessiert mich nicht mal, ob Sie sie tragen. Es ist nur ein guter Rat von einem alten Hasen, mehr nicht.«
Zed wusste, dass der Chefredakteur den Nachsatz hinzugefügt hatte, um eine Anzeige zu vermeiden. Alles, was Rodney zu Zeds Kippa gesagt hatte, hatte er aus demselben Grund so und nicht anders formuliert. Die Source war nicht gerade eine Bastion der politischen Korrektheit, aber darum ging es auch gar nicht. Rodney Aronson wusste, welche Fehler er in seinem Gewerbe besser vermied.
»Beherzigen Sie meinen Rat«, sagte Rodney, als die Tür sich öffnete und seine Sekretärin mit einer Familienpackung Schokolade hereinkam.
»Mach ich«, sagte Zed. »Mach ich auf jeden Fall.«
ST. JOHN’S WOOD – LONDON
Es kam auf jede Minute an, und er machte sich sofort auf den Weg. Er würde die U-Bahn nehmen und in der Baker Street in den Bus steigen. Ein Taxi bis nach St. John’s Wood wäre besser gewesen – nicht zuletzt wegen der größeren Beinfreiheit –, aber das konnte er sich nicht leisten. Er hastete zum U-Bahnhof Blackfriars, wo er endlos auf die Circle Line wartete, die so überfüllt war, dass er sich gerade noch hineinquetschen konnte und mit eingezogenen Schultern, das Kinn auf die Brust gedrückt wie ein Büßer, direkt an der Tür stehen bleiben musste.
Mit steifem Nacken stieg er an der Baker Street aus und ging zur Bank, um seinen Kontostand zu überprüfen in der vergeblichen Hoffnung, dass er sich beim Überschlagen seiner Einnahmen und Ausgaben irgendwie verrechnet hatte. Ein Blick auf den Kontostand machte ihn mutlos. Eine Fahrt nach Cumbria würde seine gesamten Ersparnisse verschlingen, und er musste sich überlegen, ob ihm das die Sache wert war. Letztlich ging es nur um eine Story. Wenn er sie sausen ließ, würde man ihn eben auf eine andere ansetzen. Aber es gab Storys und Storys, und diese … Er wusste einfach, dass diese etwas ganz Besonderes war.
Immer noch unentschlossen traf er anderthalb Stunden früher als gewöhnlich zu Hause ein, und deswegen klingelte er an der Haustür, damit seine Mutter keinen Schreck bekam, wenn sie zu einer so ungewohnten Tageszeit den Schlüssel im Schloss hörte. Er rief »Ich bin’s Mum!«, und sie antwortete »Zedekiah! Ach, wie schön!«, was ihn verblüffte, bis er die Wohnung betrat und sah, weswegen seine Mutter so aus dem Häuschen war.
Susanna Benjamin war gerade dabei, ihren Nachmittagstee zu beenden, aber sie war nicht allein. Eine junge Frau saß im bequemsten Sessel des Wohnzimmers – in dem Sessel, den Zeds Mutter immer für Gäste reservierte. Sie errötete anmutig und senkte kurz den Kopf, als Zeds Mutter die beiden einander vorstellte. Sie hieß Yaffa Shaw und gehörte demselben Lesezirkel an wie Susanna Benjamin, die diese Tatsache aus irgendeinem Grund als großartigen Zufall bezeichnete. Zed brauchte nicht lange auf eine nähere Erläuterung zu warten. »Ich habe Yaffa gerade erzählt, dass mein Zedekiah ein absoluter Bücherwurm ist, der nicht nur eins, sondern gleich vier, fünf Bücher auf einmal liest. Erzähl Yaffa, was du gerade liest, Zed. Yaffa hat sich gerade den neuen Graham Swift vorgenommen. Also, das heißt, wir alle haben mit dem neuen Graham Swift angefangen. Im Lesezirkel, Zed. Setz dich doch, mein Lieber. Möchtest du ein Tässchen Tee? Ach du je, der ist ja kalt! Soll ich dir frischen machen?«
Ehe Zed darauf antworten konnte, war seine Mutter bereits verschwunden. Er hörte sie in der Küche herumklappern. Für alle Fälle schaltete sie auch noch das Radio ein. Er wusste, dass sie mindestens eine Viertelstunde brauchen würde, um frischen Tee aufzuschütten, denn er kannte das schon. Das letzte Mal war es die junge Frau gewesen, die bei Tesco an der Kasse arbeitete. Das vorletzte Mal war es eine vielversprechendere Kandidatin gewesen, nämlich die älteste Nichte ihres Rabbi, die sich in London aufhielt, um an einem Sommerkurs einer amerikanischen Universität teilzunehmen, an deren Namen Zed sich nicht erinnern konnte. Nach Yaffa, die ihn verstohlen beobachtete, zweifellos in der Hoffnung auf ein Gespräch, würde wieder eine kommen. Und so würde es weitergehen, bis er eine von ihnen heiratete und anfing, Enkelkinder in die Welt zu setzen. Nicht zum ersten Mal verfluchte Zed seine ältere Schwester, ihren Beruf und ihre Entscheidung, nicht nur keine Kinder zu bekommen, sondern nicht einmal zu heiraten. Sie war Wissenschaftlerin geworden, ein Beruf, der eigentlich für ihn vorgesehen gewesen war. Nicht dass er gern Wissenschaftler geworden wäre, aber wenn seine Schwester mitgespielt hätte und ihrer Mutter einen Schwiegersohn und ein paar Enkelkinder beschert hätte, dann würde er nicht immer und immer wieder vor einer neuen Kandidatin sitzen, die seine Mutter unter weiß der Teufel welchem Vorwand ins Haus gelockt hatte.
»Sie und Mum«, sagte er, »gehören also demselben Lesezirkel an?«
Sie errötete noch tiefer. »Eigentlich nicht«, sagte sie. »Ich arbeite in dem Buchladen. Ich gebe den Mitgliedern des Lesezirkels Empfehlungen. Ihre Mutter und ich … wir haben uns unterhalten … na ja, wie das halt so geht in einem Buchladen, wissen Sie.«
Er wusste nur zu gut. Und vor allem wusste er, wie Susanna Benjamin vorging. Er konnte sich das Gespräch genau vorstellen: die raffinierten Fragen und die arglosen Antworten. Er fragte sich, wie alt die junge Frau sein mochte, und ob seine Mutter es geschafft hatte, das Gespräch aufs Kinderkriegen zu lenken.
Er sagte: »Wahrscheinlich haben Sie gar nicht damit gerechnet, dass sie einen Sohn hat.«
»Sie hat es jedenfalls nicht erwähnt. Aber im Moment ist alles ein bisschen kompliziert, weil …«
»Zed, Liebling«, flötete seine Mutter aus der Küche. »Ist Darjeeling recht? Und ein Stück Kuchen? Oder möchtest du lieber einen Scone? Yaffa, Sie trinken doch noch ein Tässchen, nicht wahr? Ihr jungen Leute wollt bestimmt noch ein Weilchen plaudern.«
Genau das wollte Zed auf keinen Fall. Er wollte seine Ruhe, denn er musste das Für und Wider einer Reise nach Cumbria abwägen, ob es sinnvoll war, sich zu verschulden, nur um seine Story sexy zu machen. Und wenn er erst einmal in Cumbria war, falls er sich dafür entschied hinzufahren, würde er sich überlegen müssen, was genau die Story sexy machen würde. Was würde ihr das Prickeln geben, den Biss oder was auch immer nötig war, um die Neugier der Source-Leser zu wecken, die, so vermutete er, den IQ von Grabsteinen hatten. Womit konnte man einen Grabstein fesseln? Oder eine Leiche? Zed musste innerlich kichern über den Vergleich. Zum Glück hatte er ihn nicht im Gespräch mit Rodney Aronson gemacht.
»So, da wären wir!« Susanna Benjamin brachte ein Tablett mit frischem Tee, Scones, Butter und Marmelade. »Mein Zedekiah ist ziemlich groß, nicht wahr, Yaffa? Ich weiß gar nicht, von wem er die Größe geerbt hat. Wie groß bist du noch?«, fragte sie Zed. Er war eins fünfundneunzig, und seine Mutter wusste genau, von wem er die Größe geerbt hatte, nämlich von seinem Großvater väterlicherseits, der auch fast eins neunzig gewesen war. Als er nicht antwortete, fuhr sie unbekümmert fort: »Und erst mal seine Füße. Sehen Sie sich diese Füße an, Yaffa. Und Hände wie Gartenschaufeln. Sie wissen ja, wie es heißt …« Sie zwinkerte der jungen Frau zu. »Milch und Zucker, Zedekiah? Beides, nicht wahr?« Und zu Yaffa: »Mein Sohn war zwei Jahre im Kibbuz. Und dann zwei Jahre bei der Armee.«
»Mum«, sagte Zed.
»Nun sei doch nicht so verschämt.« Sie füllte Yaffas Tasse. »Und zwar bei der israelischen Armee. Was sagen Sie dazu? Er stellt sein Licht immer unter den Scheffel. So ein bescheidener Junge. So ist er schon immer gewesen. Und Yaffa ist genauso, Zedekiah. Der Kleinen muss man jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Geboren in Tel Aviv, der Vater Chirurg, zwei Brüder, die in der Krebsforschung arbeiten, die Mutter Modedesignerin, mein Junge. Modedesignerin! Ist das nicht großartig? Ich könnte mir natürlich kein einziges von ihren Kleidern leisten, denn die werden in … Wo werden die noch verkauft, Yaffa?«
»In Boutiquen«, sagte Yaffa, die so puterrot angelaufen war, dass Zed schon fürchtete, sie würde gleich einem Schlaganfall zum Opfer fallen.
»In Knightsbridge, Zed«, fuhr seine Mutter fort. »Stell dir das mal vor. Sie entwirft die Sachen in Israel, und sie werden hier verkauft.«
Um den Redefluss seiner Mutter zu unterbrechen, fragte Zed: »Was hat Sie denn nach London verschlagen, Yaffa?«
»Das Studium!«, rief Susanna Benjamin. »Sie geht hier auf die Universität, Zedekiah. Sie studiert Biologie.«
»Chemie«, korrigierte Yaffa.
»Chemie, Biologie, Geologie … was macht das für einen Unterschied? Wer hätte gedacht, dass so viel Grips in diesem hübschen Köpfchen steckt! Hast du jemals ein hübscheres Ding gesehen als unsere kleine Yaffa?«
»In letzter Zeit nicht«, sagte Zed und warf seiner Mutter einen bedeutungsvollen Blick zu. »Es ist mindestens sechs Wochen her«, fügte er hinzu in der Hoffnung, sie durch die Bloßstellung ihrer Absichten so in Verlegenheit zu bringen, dass sie endlich Ruhe gab.
Aber Susanna ließ sich nicht beirren. »Er macht sich gern über seine Mutter lustig, Yaffa. Er ist ein kleiner Scherzbold, mein Zedekiah. Sie werden sich schon daran gewöhnen.«
Daran gewöhnen? Zed schaute Yaffa an, die peinlich berührt auf ihrem Sessel herumrutschte. Daraus schloss er, dass noch mehr auf ihn zukam, und seine Mutter spannte ihn nicht länger auf die Folter.
»Yaffa zieht in das Zimmer deiner Schwester«, verkündete Susanna ihrem Sohn. »Sie ist gekommen, um es sich anzusehen, und sie sagt, es ist genau das, was sie braucht, jetzt, wo sie aus ihrem anderen Zimmer rausmuss. Wie schön, wieder ein junges weibliches Gesicht im Haus zu haben, nicht wahr? Sie wird morgen hier einziehen. Sie müssen mir noch sagen, was Sie gern frühstücken, Yaffa. Als junger Mensch muss man den Tag mit einer ordentlichen Mahlzeit beginnen. Das fördert die Konzentration, nicht wahr, Zed? Er hat sein Literaturstudium mit Auszeichnung abgeschlossen. Hab ich Ihnen schon erzählt, dass er Gedichte schreibt, Yaffa? Irgendetwas sagt mir, dass er demnächst eins über Sie schreiben wird.«
Zed stand abrupt auf. Dabei schwappte sein Tee über, denn er hatte die Tasse in seiner Hand ganz vergessen. Zum Glück landete das meiste davon auf seinen Schuhen und nicht auf dem guten Teppich seiner Mutter. Aber am liebsten hätte er ihr den Rest über den sorgfältig frisierten Kopf gekippt.
Er traf seine Entscheidung spontan, und sie war nötig. »Ich fahre nach Cumbria, Mum.«
Sie blinzelte. »Nach Cumbria? Warst du denn nicht gerade erst …«
»An der Story ist noch mehr dran, und das muss ich ausgraben. Das duldet keinen Aufschub.«
»Wann fährst du denn?«
»Sobald ich gepackt habe.«
Wofür er höchstens fünf Minuten brauchen würde, dachte er.
UNTERWEGS NACH CUMBRIA
Die Tatsache, dass er sich so schnell wie möglich aus dem Staub machen wollte, ehe seine Mutter mitten im Wohnzimmer die Chuppa aufbauen konnte, zwang ihn dazu, einen Zug zu nehmen, der auf Umwegen nach Cumbria fuhr. Daran ließ sich leider nichts ändern. Nachdem er seine Reisetasche gepackt und seinen Laptop verstaut hatte, war er weg. Die Flucht war ihm sauber gelungen. Bus, U-Bahn, Euston Station, wo er bis zur Abfahrt des Zugs noch etwas Zeit hatte, um sich seine Fahrkarte, außerdem vier Sandwiches, den Economist, die Times und den Guardian zu kaufen. Während er auf dem Bahnsteig auf den Zug wartete, fragte er sich, wie lange er wohl brauchen würde, um etwas zu finden, das seine Geschichte sexy machte, und wie lange er noch brauchen würde, um seiner Mutter abzugewöhnen, ihm Frauen zuzuführen wie eine Kupplerin … Als er endlich im Abteil saß und der Zug anfuhr, war er froh, sich mit Arbeit ablenken zu können. Er klappte seinen Laptop auf und begann, seine Aufzeichnungen durchzugehen, die er abends nach jedem Gespräch säuberlich abgetippt hatte. Außerdem hatte er noch einen Block mit handschriftlichen Notizen dabei, die er auch noch durchforsten würde, denn es musste irgendetwas geben, und er würde es finden.
Als Erstes befasste er sich mit der Hauptfigur seiner Geschichte: Nicholas Fairclough, zweiunddreißig Jahre alt, der ehemals lasterhafte Sohn von Bernard Fairclough, Baron von Ireleth im County Cumbria. In eine wohlhabende, privilegierte Familie hineingeboren – der goldene Löffel –, hatte Nicholas bereits in seiner Jugend das Vermögen verprasst, das ihm das Schicksal in die Wiege gelegt hatte. Er war ein Mann mit dem Gesicht eines Engels, aber mit Tendenzen, die Lots Nachbarn alle Ehre gemacht hätten. Seit dem vierzehnten Lebensjahr hatte er äußerst widerstrebend verschiedene Entzugsprogramme durchlaufen. Die Liste der Kliniken las sich wie ein Reisebericht, da die Eltern immer exotischere – und abgelegenere – Orte ausgewählt hatten in der Hoffnung, Nicholas zu einem gesünderen Lebenswandel verhelfen zu können. Wenn er nicht gerade irgendwo auf Entzug war, unternahm er vom Geld seines Vaters nach dem Motto »Was kostet die Welt?« Luxusreisen, die ihn auf direktem Weg zurück in die Sucht führten. Schließlich warfen alle Beteiligten das Handtuch, an dem sie sich vorher die in Unschuld gewaschenen Hände abgewischt hatten. Vater, Mutter, Schwestern, sogar ein Vetter hatte …
Moment, darüber hatte er ja noch gar nicht nachgedacht, wurde Zed plötzlich bewusst. Diese Sache mit dem Vetter. Es war ihm vorgekommen wie ein unwichtiges Detail, das hatte Nicholas während der Interviews selbst betont, aber womöglich war Zed da etwas entgangen, das er jetzt gebrauchen konnte … Er blätterte in seinem Notizbuch und fand den Namen: Ian Cresswell, bei der Firma Fairclough Industries in irgendeiner verantwortungsvollen Position beschäftigt, Vetter von Nicholas, acht Jahre älter als dieser, geboren in Kenia, aber als Junge nach England übergesiedelt, wo er fortan bei den Faircloughs wohnte … Na, das war doch etwas, oder? Etwas, das sich vielleicht irgendwie ausschlachten ließ.
Zed hob nachdenklich den Kopf. Er schaute aus dem Fenster. Es war stockdunkel draußen, er sah also nichts als sein eigenes Spiegelbild: ein rothaariger Hüne, auf dessen Stirn sich Sorgenfalten bildeten, weil seine Mutter versuchte, ihn mit der erstbesten willigen Frau zu verkuppeln, die sie auftreiben konnte, und weil sein Chef seine geschliffene Prosa in den Papierkorb werfen wollte und weil er selbst etwas schreiben wollte, was wenigstens ein bisschen Niveau hatte. Also gut, was stand in seinen Aufzeichnungen? Was? Was?
Zed packte eins seiner vier Sandwiches aus und verschlang es, während er seine handschriftlichen Notizen durchging. Er suchte nach einem Anhaltspunkt, an dem er seine Story festmachen konnte, oder wenigstens nach einem Hinweis, dass es sich lohnte, in die eine oder andere Richtung tiefer zu graben, um das Prickeln zu produzieren, das Rodney Aronson verlangte. Diese Sache mit den Vettern, die wie Brüder aufgewachsen waren, war eine Möglichkeit. Unweigerlich musste er an das Alte Testament denken und an Kain und Abel, an die Frage »Bin ich der Hüter meines Bruders?«, an Altäre, auf denen die Früchte der Arbeit geopfert wurden, an das Bestreben, demjenigen zu gefallen, der in der Geschichte die Rolle Gottes einnahm, wahrscheinlich Bernard Fairclough, Baron von Ireleth. Und wenn man die Geschichte wirklich mit der Bibel vergleichen wollte, dann könnte der Baron Isaak sein, im Konflikt mit Esau und Jakob und deren Streit um das Recht des Erstgeborenen – obwohl Zed nie geglaubt hatte, dass irgendjemand das Fell eines toten Lamms für einen behaarten Männerarm halten konnte. Jedenfalls sollte er seine Aufzeichnungen noch einmal durchforsten, um zu sehen, ob er irgendwelche Informationen darüber besaß, wer was erben würde, falls Lord Fairclough etwas Unvorhergesehenes zustieß, oder wer die Leitung von Fairclough Industries übernehmen würde, falls den guten Lord ein vorzeitiger Tod ereilte.
Das wäre tatsächlich eine Story. Bernard Fairclough auf geheimnisvolle Weise … was? Verstorben oder verschwunden zum Beispiel. Er stürzt eine Treppe hinunter, ist querschnittsgelähmt, erleidet einen Schlaganfall, wie auch immer. Nachforschungen ergeben, dass er sich wenige Tage vor seinem frühzeitigen Tod mit seinem Anwalt getroffen hat und … ja, was? Er hat ein neues Testament aufgesetzt, seine Absichten in Bezug auf das Familienunternehmen klargestellt, er hat eine Lebensversicherung abgeschlossen, alle seine Papiere in Ordnung gebracht in Bezug auf – ja, auf was? Darauf, dass jemand etwas erbte, darauf, dass jemand enterbt würde, auf eine Enthüllung … Der Sohn ist in Wirklichkeit nicht sein Sohn. Der Neffe ist nicht sein Neffe. Es gibt eine zweite Familie auf den Hebriden. Irgendwo versteckt, im Keller, auf dem Söller, im Bootshaus, gibt es einen wahnsinnigen, missgestalteten älteren Bruder. Das wäre Zündstoff. Das wäre der Knaller. Das wäre sexy.
Das Problem war, wenn Zed ganz ehrlich war, dass das Einzige, was man an seiner Geschichte von Nicholas Faircloughs neuntem Leben wirklich als sexy bezeichnen konnte, dessen Frau war, und die war nicht nur sexy, die war affenscharf. In seinem Gespräch mit Rodney Aronson hatte er das nicht besonders herausgestrichen, weil Rodneys Reaktion darauf absehbar gewesen war, nämlich eine Aufforderung, ihm Bilder von ihren Titten zu verschaffen. Zed hatte sich bisher in Bezug auf das Thema sehr zurückgehalten, weil die Ehefrau wünschte, im Hintergrund zu bleiben, aber jetzt fragte er sich, ob er die Dame vielleicht doch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen sollte. Er öffnete den Ordner mit seinen Aufzeichnungen. Wenn Eva auch nur entfernt wie Alatea Fairclough ausgesehen hatte, dann, so hatte Zedekiah nach dem einzigen Interview mit ihr gedacht, war es kein Wunder, dass Adam den Apfel gepflückt hatte. Die einzige Frage war, warum er nicht sämtliche verdammten Äpfel samt Baum gegessen hatte. Also … War die Frau die Story? Machte sie die Story sexy? Prickelnd? Sie war weiß Gott umwerfend. Man brauchte nur ein Foto von ihr zu bringen, und jeder gesunde Mann würde wissen, warum Nicholas Fairclough geheilt worden war. Sonst hatte sie leider nichts weiter zu der ganzen Sache zu sagen als: »Was Nick getan hat, hat er selbst getan. Ich bin seine Frau, aber in seiner wirklichen Geschichte spiele ich keine Rolle.«
War das eine Anspielung gewesen, fragte sich Zed. Welche wirkliche Geschichte? Gab es noch mehr aufzudecken? Vielleicht musste er diesen Faden weiterverfolgen: wahre Liebe. Hatte Nicholas Fairclough sie tatsächlich gefunden? Und wenn ja, gab es jemanden, der ihn darum beneidete? Eine seiner Schwestern vielleicht? Denn eine war unverheiratet, und die andere war geschieden. Und wie fühlten die beiden sich überhaupt, jetzt, wo der verlorene Sohn heimgekehrt war?
Er ging weiter seine Notizen durch. Las, bis ihm die Augen brannten. Aß noch ein Sandwich. Er machte sich auf die Suche nach einem Speisewagen – ziemlich absurd in Anbetracht seiner mageren Einkünfte –, weil er dringend einen Kaffee brauchte. Anschließend saß er wieder auf seinem Platz, völlig erschöpft, fast bereit aufzugeben. Dann plötzlich war er wieder hellwach: Was wenn etwas mit dem Haus der Familie nicht stimmte? Wenn es darin spukte, und wenn das zu der Drogensucht geführt hatte? … Dann kam er wieder auf die verdammte Ehefrau zurück, die südamerikanische Sirene, und allmählich sagte er sich, er täte besser daran, nach Hause zu fahren und die ganze vermaledeite Story zu vergessen, nur dass daheim seine Mutter auf ihn wartete und Yaffa Shaw und eine nie endende Prozession von Frauen, die er heiraten und schwängern sollte.
Nein. Irgendwo war eine Geschichte, eine Geschichte, wie sein Chefredakteur sie haben wollte. Wenn er noch tiefer graben musste, um etwas Pikantes zu finden, dann würde er eben die Schaufel schwingen und graben, bis er in China ankam. Alles andere war inakzeptabel. Aufgeben kam nicht in Frage.
18. Oktober
BRYANBARROW – CUMBRIA
Ian Cresswell war gerade dabei, den Tisch für zwei zu decken, als sein Lebensgefährte nach Hause kam. Er selbst hatte früh Feierabend gemacht, einen romantischen Abend im Sinn. Er hatte Lammbraten gekauft, der gerade unter einer duftenden Kräuterkruste im Ofen schmorte, und er hatte frisches Gemüse und Salat zubereitet. Im Kaminzimmer hatte er eine Weinflasche entkorkt, Gläser poliert und zwei Sessel und den Spieltisch aus Eichenholz aus der Zimmerecke vor den offenen Kamin geschoben. Obwohl es in dem uralten Herrenhaus eigentlich immer ein bisschen kühl war, war es noch nicht kalt genug für ein Kohlefeuer, und so hatte er eine Reihe Kerzen auf dem schmiedeeisernen Feuerrost befestigt und zwei weitere auf den Tisch gestellt. Als er gerade dabei war, die Kerzen anzuzünden, hörte er, wie die Küchentür geöffnet wurde, dann das Geräusch von Kavs Schlüsselbund, der in dem angeschlagenen Kammertopf auf der Fensterbank landete. Einen Augenblick später das Geräusch von Kavs Schritten auf den Küchenfliesen, und als die Tür des alten Backofens quietschte, lächelte Ian vor sich hin: Heute Abend war Kav mit Kochen an der Reihe, nicht er, und Kav hatte soeben die erste Überraschung entdeckt.
»Ian?« Schritte in der Küche, dann auf den Steinfliesen in der Eingangshalle. Ian hatte die Tür zum Kaminzimmer angelehnt gelassen. »Hier!«, rief er und wartete.
Kav erschien in der Tür. Sein Blick wanderte von Ian zum Tisch mit den Kerzen, zu den Kerzen im Kamin und wieder zu Ian zurück. Dann wanderte sein Blick über Ians Körper und verweilte genau da, wo Ian es wünschte. Aber nach einem Moment der Spannung, der früher einmal dazu geführt hätte, dass sie gleich darauf im Schlafzimmer gelandet wären, sagte Kav: »Ich musste heute mit anpacken, wir hatten zu wenig Leute. Ich bin verschwitzt. Ich geh mich kurz duschen und umziehen«, und verschwand ohne ein weiteres Wort. Das reichte, um Ian zu sagen, dass sein Lover genau wusste, was die Szene, die er vor sich gesehen hatte, bedeutete. Und es reichte, um Ian zu sagen, welche Richtung ihr Gespräch an dem Abend wie üblich nehmen würde. Eine solche unausgesprochene Botschaft von Kaveh hätte ihm früher den Wind aus den Segeln genommen, aber diesmal nicht. Nachdem sie drei Jahre heimlich und ein Jahr offen zusammengelebt hatten, wusste er, was ihm das für ihn bestimmte Leben wert war.
Es dauerte eine halbe Stunde, bis Kaveh endlich fertig war, aber obwohl der Braten schon seit zehn Minuten auf dem Tisch stand und das Gemüse langsam unansehnlich wurde, hatte Ian nicht vor, sich davon kränken zu lassen, dass Kav sich so viel Zeit genommen hatte. Ian schenkte ihnen Wein ein – vierzig Pfund hatte die Flasche gekostet, was der Anlass jedoch rechtfertigte – und hob sein Glas. »Das ist ein guter Bordeaux«, sagte er und wartete darauf, dass Kav mit ihm anstieß, denn es war schließlich nicht zu übersehen, dass er das wünschte, so wie er mit dem Glas in der Hand dastand und ihn erwartungsvoll anlächelte.
Zum zweiten Mal betrachtete Kav den Tisch. »Zwei Gedecke?«, sagte er. »Hat sie angerufen oder was?«
»Ich habe sie angerufen.« Ian ließ die Hand mit dem Glas sinken.
»Und?«
»Ich habe sie gebeten, die beiden erst morgen zurückzubringen.«
»Und darauf hat sie sich eingelassen?«
»Ausnahmsweise. Willst du nicht von dem Wein trinken, Kav? Ich hab ihn in Windermere gekauft. In dem Weinladen, wo wir letzten …«
»Ich hatte heute eine Auseinandersetzung mit dem alten George.« Kav machte eine Kopfbewegung in Richtung Straße. »Er hat mich abgefangen, als ich hier ankam. Beschwert sich mal wieder über die Kälte. Er meint, ihm würde eine Zentralheizung zustehen. Zustehen, hat er tatsächlich gesagt.«
»Er hat doch jede Menge Kohle. Warum verheizt er die nicht, wenn’s ihm im Haus zu kalt ist?«
»Er sagt, er will nicht mit Kohle heizen. Er will eine Zentralheizung. Er sagt, wenn er keine kriegt, sieht er sich nach was anderem um.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!