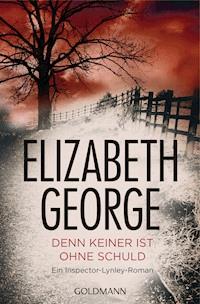9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
In einem idyllischen Cottage in Kent findet der Milchmann eines Morgens statt der eigentlichen Mieterin eine männliche Leiche vor. Der Vorfall wird noch rätselhafter, als die Ortspolizei den Toten identifiziert: Es ist Kenneth Fleming, Englands gefeierter Cricket-Champion. Bald stellt sich heraus, dass alle Menschen in Flemings Umfeld ein Motiv gehabt hätten, aber sie alle haben auch ein Alibi. Erst als Inspector Thomas Lynley seinen Job, ja sogar sein Leben riskiert, scheint es, als hätten selbst Mörder ein Gewissen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1150
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Eigentlich hat Inspector Lynley an jenem Abend Großes vor. Gerade will er Lady Helen einen Heiratsantrag machen, als ein Anruf aus dem Yard seine Pläne scheitern läßt: Im idyllischen Celandine Cottage in Kent hat der Milchmann nämlich statt der attraktiven Mieterin Gabriella Patten die Leiche eines Mannes gefunden. Der Vorfall wird noch rätselhafter, als die örtliche Polizei den Toten identifiziert: Es ist niemand anderer als Kenneth Fleming, Englands gefeierter Cricket-Champion, der kurz vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere stand.
Bald stellt sich heraus, daß alle Menschen um Kenneth Fleming seit Jahren in einem Netz aus enttäuschten Hoffnungen und blindem Rachebedürfnis gefangen sind. Jeder und jede hat ein Motiv – und alle haben sie ein Alibi. Erst als Lynley seinen Job, ja sogar sein Leben riskiert, scheint es, als hätten selbst Mörder ein Gewissen ...
Inhaltsverzeichnis
Für Freddie Lachapelle, in Liebe
Die Erde und der Sand brennen. Lege dein Gesicht auf den brennenden Sand und auf die Erde der Straße, da all diejenigen, die von der Liebe verwundet sind, den Abdruck auf ihrem Gesicht haben müssen, und die Narbe zu sehen sein muß.
The Conference of the Birds Farīd al-Dīn ’Aṭṭār
VORBEMERKUNG
In England steht der Ausdruck »the ashes« für den Sieg im Vergleichskampf mit Australien.
Dieses Bild leitet sich aus der Cricket-Geschichte her:
Im August 1882 besiegte die australische Nationalmannschaft in einer Serie von Vergleichskämpfen die englische Nationalmannschaft. Es war das erstemal, daß England auf heimischem Boden geschlagen worden war. Nach der Niederlage brachte die Sporting Times einen Nachruf, in dem sie meldete, der englische Cricket-Sport sei »am 29. August 1882 auf dem Spielfeld verschieden«. Dem Nachruf folgte eine Notiz, die besagte, »die Leiche wird eingeäschert und die Asche nach Australien verbracht werden«.
Nach diesem Debakel brach das englische Team zu einer weiteren Serie von Spielen nach Australien auf. Es hieß, die Mannschaft unter Führung ihres Kapitäns Ivo Bligh sei ausgezogen, »die Asche zurückzuholen«. Nach der zweiten Niederlage des australischen Teams nahmen ein paar Frauen aus Melbourne einen der Barren (die Holzstäbe, die quer über drei senkrechten Pfosten liegen und so das Cricket-Tor bilden, das der Schlagmann verteidigt), verbrannten ihn und überreichten die Asche Bligh. Diese Asche befindet sich heute in Lord’s Cricket Ground in London, dem Mekka des englischen Cricket-Sports.
Am Ende einer Spielserie zwischen England und Australien wechselt kein Pokal den Besitzer; aber immer wenn sich die beiden Nationalmannschaften zu den fünf Vergleichspartien treffen, die eine Serie bilden, spielen sie um die Asche.
Olivia
Chris ist weg, um am Kanal ein Stück mit den Hunden zu laufen. Ich kann sie noch sehen, denn sie sind noch nicht bei der Brücke an der Warwick Avenue angelangt. Bean springt rechts neben ihm her und riskiert dabei ständig einen Sturz ins Wasser. Toast läuft links von ihm. Ungefähr alle zehn Schritte vergißt er, daß er nur drei Beine hat, und fällt fast auf die Schulter.
Chris hat gesagt, daß er nicht lange ausbleiben wird. Er weiß, wie mir zumute ist, während ich dies hier schreibe. Aber er liebt seine Spaziergänge, und wenn er erst einmal unterwegs ist, lassen Sonne und Wind ihn sein Versprechen vergessen. Er läuft bestimmt bis zum Zoo, und ich werde mich bemühen, nicht sauer darüber zu sein. Ich brauche Chris gerade jetzt mehr denn je, darum werde ich mich damit trösten, daß er es stets gut mit mir meint, und werde versuchen, das auch zu glauben.
Als ich im Zoo gearbeitet habe, sind die drei manchmal nachmittags gekommen und haben mich abgeholt. Dann haben wir im Imbißpavillon einen Kaffee getrunken und uns, wenn das Wetter schön war, draußen auf eine Bank gesetzt, von der aus wir die Fassade von Cumberland Terrace sehen konnten. Wir schauten uns die Statuen an, die auf dem Giebelfeld im Halbrund aufgereiht sind, und dachten uns Namen und Geschichten für sie aus. »Sir Bonzo von Bärbeiß« zum Beispiel, dem es in der Schlacht bei Waterloo den Hintern weggerissen hat. »Gräfin Tussi von Taugtnix« nannte ich eine andere, die sich wie die Einfalt vom Lande gebärdete und in Wirklichkeit ein weiblicher Pimpernell war. Oder »Markus Krankus« für einen Kerl in der Toga, der an den Iden des März seinen Mut verloren und sein Frühstück von sich gegeben hat. Und dann lachten wir uns schief über unsere Albernheit und sahen den Hunden zu, die Vögeln und Touristen auflauerten.
Ich wette, sie haben Schwierigkeiten, sich das vorzustellen – mich, Unsinn schwatzend neben Chris Faraday auf der Bank, das Kinn auf die hochgezogenen Knie gestützt, in der Hand einen Becher Kaffee. Und ich war nicht in Schwarz, wie heute, sondern ich hatte Khakihosen und ein olivgrünes Hemd an, die Uniform, die wir im Zoo immer trugen.
Damals glaubte ich zu wissen, wer ich bin. Ich war mit mir im reinen. Äußerlichkeiten zählen nicht, hatte ich etwa zehn Jahre zuvor beschlossen, und wenn die Leute sich an meinem Stoppelhaar stoßen, bei Nasenringen das kalte Grausen bekommen und mit dem Anblick von Ohrsteckern, die wie mittelalterliche Waffen am Ohrläppchen aufgereiht sind, nicht umgehen können, dann zum Teufel mit ihnen. Sie sind unfähig, hinter die Fassade zu blicken, stimmt’s? Sie wollen mich gar nicht sehen, wie ich wirklich bin.
Aber wer bin ich denn nun eigentlich? Was bin ich? Vor acht Tagen hätte ich es Ihnen noch sagen können; da habe ich’s nämlich noch gewußt. Ich hatte mir aus Chris’ Überzeugungen eine eigene Philosophie zusammengeklaut, und die vermengte ich mit dem, was ich in den zwei Jahren Studium von meinen Freunden aufgeschnappt hatte, und das alles verquirlte ich wiederum mit dem, was ich in den fünf Jahren gelernt hatte, als ich Morgen für Morgen mit einem Brummschädel und einem widerlichen Geschmack im Mund aus verschwitzten Bettlaken kroch, ohne auch nur die leiseste Erinnerung an die vergangene Nacht zu haben oder den Namen des Typen zu wissen, der neben mir schnarchte. Ich kannte die Frau, die das alles durchexerziert hatte. Sie war zornig. Sie war hart. Sie war unversöhnlich.
Das alles bin ich noch heute und mit gutem Grund. Aber ich bin noch mehr. Ich kann es nicht identifizieren, aber ich fühle es jedesmal, wenn ich zu einer Zeitung greife, die Berichte lese und weiß, daß der Prozeß wartet.
Anfangs habe ich mir eingeredet, ich hätte die Nase voll davon, mir täglich die Schlagzeilen reinzuziehen. Ich sei es leid, dauernd von dem verdammten Mord zu lesen und jedesmal, wenn ich die Daily Mail oder den Evening Standard aufschlug, die Gesichter der Hauptakteure zu sehen. Ich bildete mir ein, ich könnte dem ganzen Mist entrinnen, wenn ich nur ausschließlich die Times läse. Ich meinte, mich darauf verlassen zu können, daß die Times rein sachlich berichten und es ablehnen würde, sich im Klatsch zu suhlen. Aber sogar die Times hat jetzt die Story übernommen, und es gibt kein Entkommen mehr für mich. Mir einreden zu wollen, es sei doch scheißegal, bringt nichts. Weil es mir nun mal nicht scheißegal ist. Das weiß ich, und das weiß auch Chris, und das ist der eigentliche Grund, weshalb er mit den Hunden losgezogen ist und mir Zeit für mich gelassen hat. Er sagte: »Weißt du, ich glaube, wir bleiben heute morgen ein bißchen länger aus, Livie«, als er seinen Trainingsanzug anzog. Dann nahm er mich auf seine asexuelle Art in die Arme – so halb von der Seite, praktisch ohne jeden Körperkontakt – und marschierte los.
Ich sitze mit einem gelben, linierten Schreibblock auf den Knien und einer Packung Marlboro in der Tasche auf dem Deck des Hausboots. Zu meinen Füßen steht eine Dose mit Bleistiften, die alle scharf gespitzt sind. Das hat Chris besorgt, ehe er gegangen ist.
Ich schaue über das Wasser hinweg nach Browning’s Island, wo die Weiden ihre Zweige auf den kleinen Landesteg herabhängen lassen. Die Bäume sind endlich richtig grün, was heißt, daß es fast Sommer ist. Der Sommer war schon immer Zeit des Vergessens, da schmolzen die Probleme in der Sonne dahin. Darum sage ich mir, wenn ich nur noch ein paar Wochen durchhalte und auf den Sommer warte, wird dies alles vorübergehen. Ich werde mir nicht mehr darüber den Kopf zerbrechen müssen. Ich werde nicht handeln müssen. Ich sage mir einfach, es ist nicht mein Problem. Aber das stimmt nicht ganz, und ich weiß das.
Wenn ich es nicht länger umgehen kann, in die Zeitung zu sehen, fange ich mit den Bildern an. Am längsten sehe ich mir das von ihm an. Ich betrachte, wie er seinen Kopf hält, und ich weiß, daß er glaubt, sich an einen Ort fortgestohlen zu haben, an dem niemand ihn verletzen kann.
Ich verstehe das. Einmal glaubte ich selbst, ich sei endlich an diesem Ort angekommen. Aber die Wahrheit ist: Wenn man einmal beginnt, an einen Menschen zu glauben, wenn man sich einmal vom fundamentalen Guten in einem Menschen anrühren läßt – und das gibt es wirklich, dieses grundlegende Positive, mit dem manche Menschen gesegnet sind –, dann ist alles vorbei. Dann sind nicht nur die Mauern eingerissen, sondern der Panzer selbst ist durchlöchert. Und man blutet wie eine reife Frucht, deren Haut vom Messer durchtrennt wurde und deren Fleisch bloßliegt. Er weiß es noch nicht. Aber früher oder später wird er es erfahren.
Ich schreibe also wohl seinetwegen. Und weil ich mir mitten in diesem traurigen Trümmerfeld von Liebe und Menschenleben darüber im klaren bin, daß ich es bin, die für alles die Verantwortung trägt.
Eigentlich beginnt die Geschichte mit meinem Vater und mit der Tatsache, daß ich seinen Tod verschuldet habe. Es war dies nicht mein erstes Verbrechen, wie Sie sehen werden, aber es war das Verbrechen, das meine Mutter mir nicht verzeihen konnte. Und weil sie es mir nicht verzeihen konnte, wurde unser Leben schwierig. Und andere Menschen wurden ebenfalls verletzt.
Über Mutter zu schreiben, ist so eine Sache. Wahrscheinlich wird es aussehen, als wollte ich schmutzige Wäsche waschen und Rache nehmen. Aber ich nenne Ihnen gleich mal eine Eigenschaft meiner Mutter, von der Sie von Beginn an wissen müssen, wenn Sie das hier lesen wollen. Sie ist eine Geheimniskrämerin. Zwar würde sie, bekäme sie dazu Gelegenheit, zweifellos sehr taktvoll erklären, sie und ich hätten uns vor etwa zehn Jahren wegen meiner »unglückseligen Beziehung« zu einem nicht mehr ganz jungen Musiker namens Richie Brewster entzweit, doch würde sie niemals alles erzählen. Sie würde Ihnen nicht verraten, daß ich die Geliebte eines verheirateten Mannes war, daß er mich schwängerte und dann abhaute, daß ich ihm verzieh, als er zurückkam, und mir von ihm eine Herpesinfektion anhängen ließ, daß ich am Ende in Earl’s Court auf dem Strich landete und für fünfzehn Mäuse die Nummer im Auto schob, wenn ich gerade dringend Koks brauchte. Nein, das würde Mutter Ihnen niemals verraten. Sie würde die Fakten verschweigen und sich einreden, sie wolle mich schützen. Dabei war es in Wahrheit immer so, daß Mutter die Tatsachen unterschlug, um sich selbst zu schützen.
Wovor? fragen Sie.
Vor der Wahrheit, antworte ich. Über ihr Leben. Über ihre Unerfülltheit. Und vor allem über ihre Ehe. Und genau das – jetzt mal abgesehen von meinem höchst unerfreulichen Verhalten – setzte meiner Meinung nach bei Mutter eine Entwicklung in Gang, die sie schließlich zu der Überzeugung verführte, sie besäße eine Art göttliches Recht, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen.
Würden aber andere das Leben meiner Mutter unter die Lupe nehmen, so würden, die meisten von ihnen sie selbstverständlich nicht als eine Person sehen, die sich stets in alles einmischen mußte, sondern vielmehr als eine Frau mit vorbildlichem sozialen Gewissen. Die entsprechenden Referenzen kann sie vorweisen: ehemals Lehrerin für englische Literatur an einer stinkenden Gesamtschule auf der Isle of Dogs; vormals ehrenamtliche Wochenendvorleserin bei Blinden; an Feiertagen stellvertretende Leiterin für Sport und Spiel bei geistig Behinderten und in den Ferien Spendensammlerin erster Güte zur Bekämpfung jedweder Seuche, die gerade Medienfavorit war. Oberflächlich betrachtet, könnte man sich Mutter als eine Frau vorstellen, die mit einem Fläschchen Vitaminpillen in der Hand dabei ist, die Leiter zur Heiligsprechung zu besteigen.
»Es gibt Dinge, die über unsere eigenen Belange hinausgehen«, sagte sie immer zu mir, wenn sie nicht gerade tief bekümmert klagte: »Willst du es mir heute wieder schwermachen, Olivia? «
Aber zu Mutters Wesen gehört mehr, als daß sie dreißig Jahre lang wie ein Dr. Barnardo des zwanzigsten Jahrhunderts kreuz und quer durch London sauste. Das Wozu darf man dabei nicht vergessen. Und da wären wir schon wieder beim Selbstschutz.
Da ich mit ihr unter einem Dach lebte, hatte ich Zeit genug zu versuchen, Mutters Leidenschaft für gute Werke zu verstehen. Allmählich erkannte ich, daß sie anderen diente, um sich selbst zu dienen. Solange sie sich im elenden Leben von Londons Armen und Geschlagenen geschäftig tummelte, brauchte sie nicht über ihr eigenes Leben nachzudenken. Und insbesondere brauchte sie nicht über meinen Vater nachzudenken.
Ich weiß schon, daß es bei den jungen Leuten von heute große Mode ist, die eheliche Beziehung ihrer Eltern während ihrer eigenen Kindheit kritisch zu untersuchen. Gibt es ein besseres Mittel, die Auswüchse, Mängel und Schwächen des eigenen Charakters zu entschuldigen? Aber gedulden Sie sich und folgen Sie mir bitte auf diesen kleinen Ausflug in die Geschichte meiner Familie. Er erklärt, warum Mutter die ist, die sie ist. Und Mutter ist der Mensch, den Sie begreifen müssen.
Niemals würde sie es zugeben, aber ich glaube, meine Mutter nahm meinen Vater nicht, weil sie ihn liebte, sondern weil er geeignet war. Er hatte zwar nicht im Krieg gedient, was etwas problematisch war, soweit es den Grad seiner gesellschaftlichen Annehmbarkeit anging. Aber trotz eines Herzrasselns, einer kaputten Kniescheibe und angeborener Taubheit auf dem rechten Ohr besaß Dad wenigstens den Anstand, von schlechtem Gewissen geplagt zu werden, daß der Kelch des Militärdiensts an ihm vorübergegangen war. Er kompensierte seine Schuldgefühle, indem er 1952 einer der Vereinigungen zum Wiederaufbau Londons beitrat. Dort begegnete er meiner Mutter. Sie nahm an, seine Mitgliedschaft wäre Zeichen eines sozialen Gewissens, das dem ihren ebenbürtig war, und nicht eines dringenden Bedürfnisses zu vergessen, daß er und sein Vater in den Jahren von 1939 bis Kriegsende mit dem Druck von Propagandaschriften für die Regierung in ihrer Firma in Stepney ein Vermögen gemacht hatten.
Sie heirateten 1958. Selbst heute noch, da Dad schon so viele Jahre tot ist, denke ich manchmal darüber nach, wie wohl die ersten Ehemonate meiner Eltern sich gestalteten. Ich frage mich, wie lange Mutter brauchte, um zu erkennen, daß Dads Potential leidenschaftlichen Ausdrucks nicht viel mehr umfaßte als Schweigen und ein gelegentliches humorvolles, liebes Lächeln. Ich pflegte sie mir vorzustellen, wenn sie zusammen im Bett waren: etwa nach dem Muster Tatsch, Grapsch, Schwitz, Stoß, Stöhn, Ächz, mit einem abschließenden »Sehr angenehm, meine Liebe« – für mich die Erklärung dafür, daß ich ihr einziges Kind war. Ich kam 1962 zur Welt, ein kleines Bündel Gutwilligkeit; die Frucht, da bin ich sicher, eines zweimal monatlich stattfindenden Beischlafs in der Missionarsstellung.
Zu Mutters Ehre muß gesagt werden, daß sie drei Jahre lang getreulich die Rolle der pflichtbewußten Ehefrau spielte. Sie hatte sich einen Ehemann geangelt und somit eines der Ziele, die den Nachkriegsfrauen gesetzt waren, erreicht; und sie bemühte sich, ihm eine gute Frau zu sein. Doch je besser sie diesen Gordon Whitelaw kennenlernte, desto klarer wurde ihr, daß er sich ihr unter Vorspiegelung falscher Tatsachen verkauft hatte. Er war nicht der leidenschaftliche Mann, den sie sich als Ehemann erhofft hatte. Er war kein Rebell. Er kämpfte nicht für irgendeine Sache. Er war im Grund seines Herzens nur ein Drucker aus Stepney, ein guter Mensch, aber einer, dessen Welt bestimmt war von Papiermühlen und Auflagenzahlen, von dem ständigen Bemühen, die Maschinen instand und in Betrieb zu halten und sich nicht von den Gewerkschaften ausbluten zu lassen. Er führte seine Geschäfte, kam nach Hause, las die Zeitung, nahm sein Abendessen ein, sah fern und ging zu Bett. Interessen hatte er kaum. Zu sagen hatte er wenig. Er war solide, treu, zuverlässig und berechenbar. Kurz, er war langweilig.
Mutter sah sich also nach etwas um, das ihrem Leben Farbe verleihen würde. Sie hätte Ehebruch oder Alkohol wählen können, statt dessen entschied sie sich für gute Werke.
Niemals würde sie auch nur das geringste von alledem zugeben. Zuzugeben, daß sie mehr vom Leben wollte als das, was Dad ihr bieten konnte, käme ja dem Eingeständnis gleich, daß ihre Hoffnungen in der Ehe nicht erfüllt worden waren. Selbst wenn man sie heute in Kensington besuchte und eine entsprechende Frage stellte, würde sie ihr Leben mit Gordon Whitelaw zweifellos als reine Seligkeit von Anfang bis Ende darstellen. Da es das aber nicht war, kümmerte Mutter sich um ihre sozialen Pflichten. Gute Taten ersetzten Mutter das persönliche Glück. Edles Bemühen ersetzte ihr körperliche Leidenschaft und Liebe.
Dafür hatte Mutter immer einen Trost, wenn sie niedergeschlagen war. Sie hatte das Gefühl, etwas geleistet zu haben, etwas wert zu sein. Sie empfing die aufrichtige und von Herzen kommende Dankbarkeit jener, um deren Bedürfnisse sie sich täglich sorgte. Lobpreisungen folgten ihr von Klassenzimmer zu Konferenzzimmer zu Krankenzimmer. Man drückte ihr die Hand. Man küßte ihre Wangen. Tausend verschiedene Menschen sagten ihr: »Gott segne Sie, Mrs. Whitelaw. Vergelt’s Gott, Mrs. Whitelaw.« Sie schaffte es, sich abzulenken bis zu dem Tag, an dem Dad starb. Indem sie die Bedürfnisse der Gesellschaft allem anderen voranstellte, holte sie sich das, was sie selbst brauchte. Und am Ende, als mein Vater tot war, holte sie sich auch noch Kenneth Fleming.
Ja, ganz recht. Damals schon, vor all den Jahren. Den Kenneth Fleming.
1
Martin Snell wollte die Milch liefern, als er das Verbrechen entdeckte. In zwei der drei Dörfchen namens Springburn, nämlich Greater und Middle Springburn, hatte er seine Runde schon abgeschlossen und war nun auf dem Weg nach Lesser Springburn. In seinem blau-weißen Milchwagen tuckerte er vergnügt diese Strecke seiner täglichen Route entlang, die ihm die liebste war, nämlich die Water Street hinunter.
Die Water Street war eine schmale Landstraße, die die Dörfer Middle und Lesser Springburn von Greater Springburn, dem Marktstädtchen, trennte. Sie schlängelte sich zwischen gelbbraunen Mauern aus Kieselsandstein an Apfelgärten und Rapsfeldern vorüber. Beschattet von Eschen, Linden und Erlen, deren Laub sich endlich zu einem frühlingsgrünen Baldachin zu entfalten begann, folgte sie in gemächlichem Auf und Ab den sanften Hügeln des Landes, das sie durchschnitt.
Es war ein prachtvoller Tag: weder Regen noch Wolken. Nur ein leichtes Lüftchen aus dem Osten, ein milchigblauer Himmel und Sonnenlicht, das sich funkelnd in dem ovalen Bilderrahmen brach, der an einer silbernen Kette vom Rückspiegel des Milchautos herabhing.
»Na, ist das ein Tag, Majestät?« sagte Martin zu der Fotografie. »Ein herrlicher Morgen, finden Sie nicht? Da – haben Sie das gehört? Das war wieder der Kuckuck. Und das da – eine Lerche. Wunderschön, dieser Gesang, nicht? Das Lied des Frühlings.«
Es war seit langem Martins Gewohnheit, sich mit der Fotografie der Queen zu unterhalten. Er fand das keineswegs merkwürdig. Sie war die Monarchin des Landes, und niemand, so meinte er jedenfalls, war mehr geneigt, die Schönheit Englands zu schätzen als die Frau, die auf seinem Thron saß.
Ihre täglichen Gespräche beschränkten sich keineswegs auf Betrachtungen von Flora und Fauna. Die Queen war Martins Herzensfreundin, Vertraute seiner geheimsten Gedanken. Was ihm an ihr gefiel, war, daß sie trotz ihres königlichen Geblüts eine freundliche Frau war. Im Gegensatz zu seiner Ehefrau, die vor ungefähr fünf Jahren durch Vermittlung eines bibelwütigen Maurers in unerbittlicher Gottesfürchtigkeit wiedergeboren worden war, fiel sie nicht betend auf die Knie, wenn er gerade ungeschickt versuchte, sich mitzuteilen. Im Gegensatz zu seinem Sohn, der, gleichermaßen mit Gedanken an Beischlaf und Pickel beschäftigt, zur abweisenden Verschlossenheit Siebzehnjähriger neigte, blockte sie Martins Gesprächsangebote niemals ab. Immer blickte sie ihn, leicht vorgeneigt, mit ermutigendem Lächeln an, während sie mit erhobener Hand aus der Kalesche winkte, in der sie auf ewig zu ihrer Krönung fuhr.
Natürlich sagte Martin der Queen nicht alles. Sie wußte von Lees hingebungsvollem Glauben an die Kirche der Wiedergeborenen und Erretteten. Er hatte ihr in aller Ausführlichkeit und mehr als einmal geschildert, wie ihm nun die Religion seinen einst gemütlichen Feierabend vermasselte. Sie wußte von Dannys Job bei Tescos Supermarkt, wo der Junge dafür zu sorgen hatte, daß von den Erbsen bis zu den Linsen nichts in den Regalen fehlte, und auch von dem Mädchen aus dem Teeladen, in das der Junge sich vergafft hatte. In der letzten Woche hatte Martin, obwohl ihm dabei ganz heiß geworden war, mit der Queen sogar über seine verspäteten Bemühungen gesprochen, seinen Sohn aufzuklären. Wie hatte sie gelacht – und Martin hatte unwillkürlich mitlachen müssen –, als er ihr geschildert hatte, wie er die antiquarischen Bücher in Greater Springburn durchgesehen hatte, um irgend etwas über Fortpflanzung zu finden, und statt dessen auf eine Darstellung von Fröschen gestoßen war. Er hatte sie seinem Sohn zusammen mit einem Päckchen Kondome geschenkt, das er seit ungefähr 1972 in seiner Kommode liegen gehabt hatte. Das war zur Einleitung eines Gesprächs ganz nützlich, hatte er gedacht. Die Frage: »Wozu die Frösche, Dad?« würde unweigerlich zu einer Erörterung der, wie sein eigener Vater es genannt hatte, »ehelichen Umarmung« führen.
Nicht daß er und die Queen sich über die eheliche Umarmung als solche unterhalten hätten. Martin hatte viel zuviel Respekt vor der Queen, um je über eine Andeutung zu dem Thema hinauszugehen.
Doch seit vier Wochen versiegten ihre Gespräche stets auf dem Höhepunkt der Water Street, wo sich nach Osten die Hopfenfelder dehnten und auf der Westseite das grasbewachsene Land zu einer Quelle abfiel, an der Wasserkresse wuchs. Hier pflegte Martin nämlich seit neuestem sein Milchauto auf dem schmalen Streifen am Straßenrand anzuhalten, um ein paar Minuten in schweigender Betrachtung zu verbringen.
An diesem Morgen hielt er es nicht anders. Er schaltete den Motor nicht aus. Er blickte nur auf das Hopfenfeld hinaus.
Die Stangen standen seit mehr als einem Monat, lange Reihen schlanker Kastanienstämme, sieben bis acht Meter hoch, von denen Drähte kreuz und quer zur Erde hinunterliefen. Die Drähte bildeten ein rautenförmiges Gitterwerk, an dem die Hopfenpflanzen sich in die Höhe ranken würden. Man hatte, wie Martin jetzt beim Blick über das Feld sah, die Pflänzchen endlich angebunden. Irgendwann gestern vormittag waren die Arbeiter aufs Feld hinausgegangen und hatten die jungen Reben an den Drähten hochgewunden. Den Rest würden die Hopfenpflanzen in den kommenden Monaten selbst besorgen und, der Sonne entgegenstrebend, schon bald lange, schattig-grüne Tunnel bilden.
Martin stieß einen Seufzer tiefer Befriedigung aus. Von Tag zu Tag würde der Anblick schöner werden. Die Luft zwischen den Reihen heranwachsender Pflanzen würde kühl sein, und dort würde er Hand in Hand mit seiner Liebsten wandern. Im Frühling – gestern also – hätte er ihr gezeigt, wie man die zarten Ranken an den Drähten befestigte. Sie hätte auf der feuchten Erde gekniet, den weichen blauen Rock um sich ausgebreitet wie vergossenes Wasser, ihr festes junges Gesäß auf die nackten Fersen gebettet. Mit der Arbeit nicht vertraut und dringend darauf angewiesen, Geld zu verdienen, um ihrer Mutter, der Witwe eines Fischers aus Whitestable, die acht hungrige Mäuler stopfen mußte, unter die Arme zu greifen, würde sie sich verzweifelt mit den Ranken abmühen, nicht wagend, um Hilfe zu bitten, da sie fürchtete, damit ihre Unwissenheit zu verraten und das einzige Einkommen zu verlieren, das ihre hungernden Geschwister außer dem Geld hatten, das ihre Mutter mit Spitzenklöppeln mühsam verdiente und das ihr Vater rücksichtslos vertrank. Sie trüge eine weiße Bluse mit kurzen Puffärmeln und tiefem Halsausschnitt, und wenn er, der bärenhaft starke Vorarbeiter, sich hinunterbeugte, um ihr zu helfen, sähe er auf ihren Brüsten die winzigen Schweißtropfen, die nicht größer sind als Stecknadelköpfe, und das heftige Wogen ihres Busens, das ihm zeigt, wie sehr seine Nähe und seine Männlichkeit sie erregen. Er faßt ihre Hände und zeigt ihr, wie man die Hopfenranken um die Drähte windet, ohne die Triebe abzubrechen. Und unter seiner Berührung geht ihr Atem noch schneller, und ihr Busen wogt noch heftiger, und er spürt ihr Haar, das so weich und blond ist, an seiner Wange. Er sagt: So macht man das, Miss. Ihre Finger zittern. Sie kann ihm nicht in die Augen sehen. Noch nie hat ein Mann sie berührt. Sie möchte nicht, daß er geht. Sie möchte nicht, daß er aufhört. Von der Berührung seiner Hände wird ihr schwach und schwindlig. Und so fällt sie in Ohnmacht. Ja, sie fällt in Ohnmacht, und er trägt sie an den Rand des Feldes. Dort legt er sie zu Boden. Er hält Wasser an ihre Lippen, und ihre Lider öffnen sich flatternd. Sie sieht ihn an. Sie lächelt. Er hebt ihre Hand an seine Lippen. Er küßt –
Lautes Hupen ertönte hinter ihm. Martin wirbelte herum. Die Fahrerin eines großen roten Mercedes war offensichtlich nicht zu dem Versuch bereit, sich zwischen der Mauer auf der einen und dem Milchauto auf der anderen Seite hindurchzuzwängen und eine Schramme an ihrem Kotflügel zu riskieren. Martin winkte und legte den Gang ein. Er warf der Queen einen verschämten Blick zu, um zu sehen, ob sie von den Phantasien wußte, die er sich in seinem Tagtraum gegönnt hatte. Aber sie zeigte keinerlei Mißbilligung. Sie lächelte nur mit erhobener Hand, und ihre Tiara funkelte auf der ewigen Fahrt zur Westminsterabtei.
Er lenkte seinen Wagen bergab zum Celandine Cottage, einem Weberhaus aus dem fünfzehnten Jahrhundert, das dort, wo die Water Street nach Nordosten abschwenkte und ein Fußweg nach Lesser Springburn führte, hinter einer Natursteinmauer auf einer kleinen Anhöhe stand. Noch einmal sah er zur Queen hinauf, und obwohl ihr freundliches Gesicht ihm sagte, daß sie ihn nicht verurteilte, verspürte er das Bedürfnis, sich zu entschuldigen.
»Sie weiß nichts davon, Majestät«, sagte er zu seiner Monarchin. »Ich habe nie ein Wort gesagt. Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen ... Ich meine, das würde ich doch nie tun, oder? Das wissen Sie.«
Die Queen lächelte. Martin sah ihr an, daß sie ihm nicht ganz glaubte.
An der Einfahrt parkte er und fuhr dabei von der Straße herunter, so daß der Mercedes, der seinen Tagtraum gestört hatte, fast geräuschlos vorübergleiten konnte. Die Frau, die am Steuer saß, warf ihm einen finsteren Blick zu und machte mit zwei Fingern ein Zeichen. Londonerin, dachte er resigniert. Von dem Tag an, als sie den M 20 eröffnet hatten, damit die Londoner aufs Land ziehen und täglich bequem zur Arbeit in die Stadt fahren konnten, war es mit Kent rapide bergab gegangen.
Er hoffte nur, daß die Queen die obszöne Geste der Frau nicht gesehen hatte. Und auch die nicht, mit der er selbst geantwortet hatte, als der Mercedes um die Kurve war und in Richtung Maidstone davonbrauste.
Martin stellte den Rückspiegel so ein, daß er sich darin in Augenschein nehmen konnte. Er vergewisserte sich, daß seine Wangen nicht stoppelig waren. Er strich sich mit federleichter Hand über sein Haar. Jeden Morgen, nachdem er einen Eßlöffel »Vitalin für volles und gesundes Haar« auf seine Kopfhaut geträufelt und zehn Minuten lang einmassiert hatte, kämmte er es mit größter Sorgfalt und gab dann Spray darauf. Seit gut einem Monat bemühte er sich, mehr aus sich zu machen; seit jenem ersten Morgen nämlich, an dem Gabriella Patten zum Tor von Celandine Cottage gekommen war, um die Milch von ihm persönlich in Empfang zu nehmen.
Gabriella Platten. Allein bei dem Gedanken an sie mußte er tief seufzen. Gabriella. In einem ebenholzschwarzen Morgenmantel aus Seide, die bei jedem ihrer Schritte leise wisperte. Die Kornblumenaugen vom Schlaf umwölkt, das weizenblonde Haar, das in der Sonne glänzte, noch wirr um den Kopf.
Als der Auftrag, Celandine Cottage wieder mit Milch zu beliefern, eingegangen war, hatte Martin diese Information in jenem Teil seines Gehirns gespeichert, der ihn auf Autopilot durch seine tägliche Runde steuerte. Er hatte gar nicht darüber nachgedacht, warum die reguläre Bestellung von zwei Literflaschen auf eine reduziert worden war. Er hielt ganz einfach eines Morgens an der Einfahrt an, kramte in seinem Lieferwagen nach der kühlen Glasflasche, wischte die Kondensflüssigkeit mit dem Tuch ab, das er immer auf dem Boden des Wagens liegen hatte, und trat durch das weiße Holztor, das das Haus von der Water Street trennte.
Er hatte die Flasche gerade in den Kasten am Ende der Einfahrt im Schatten einer Silbertanne gestellt, als er auf dem Gartenweg, der sich von der Einfahrt zur Küchentür wand, Schritte hörte. Er sah hoch, bereit, »Einen recht schönen guten Morgen« zu wünschen, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken, als er Gabriella Patten erblickte – zum erstenmal.
Gähnend und ein wenig stolpernd kam sie mit offen flatterndem Morgenmantel den unebenen Backsteinweg herab. Unter dem Morgenmantel war sie nackt.
Er wußte, er hätte sich abwenden sollen, aber der Anblick von schwarzer Seide und heller Haut bannte ihn. Und was für eine Haut sie hatte, den Blütenblättern der »Granny’s Nightcap«-Rose gleich, weiß wie Entendaunen, zartrosa gesäumt. Er starrte sie an und sagte: »Jesus!« Es war so sehr Danksagung wie Ausdruck der Überraschung.
Erschrocken zog sie hastig den Morgenmantel um sich. »Du meine Güte, ich hatte keine Ahnung ...« Sie legte drei Finger an ihre Lippen und lächelte. »Es tut mir wirklich leid, aber ich habe nicht damit gerechnet, jemanden zu treffen. Und schon gar nicht Sie. Ich dachte, die Milch käme immer bei Morgengrauen.«
Er war schon im Rückzug begriffen. »Nein. Nein«, sagte er. »Immer um diese Zeit. Hier kommt sie immer so gegen zehn.« Er hob die Hand an seine Schirmmütze, um sie tiefer ins Gesicht zu ziehen, das wie Feuer brannte. Aber er hatte die Mütze an diesem Morgen gar nicht aufgesetzt. Vom ersten April an trug er nie eine Mütze, ganz gleich, wie das Wetter war. Er konnte also nur wie ein Dorftrottel dastehen und an seinem Haar zupfen.
»Mir scheint, ich habe über das Landleben noch eine ganze Menge zu lernen, nicht wahr, Mr. – ?«
»Martin«, sagte er. »Das heißt, Snell. Martin.«
»Aha. Mr. Martin Snell Martin.« Sie trat hinter dem Zaun hervor, der zwischen Einfahrt und Rasen verlief. Sie bückte sich – er senkte den Blick – und öffnete den Deckel des Milchkastens. »Oh, wunderbar. Vielen Dank.« Und als er sich ihr wieder zuwandte, hatte sie die Milchflasche herausgenommen und drückte sie im V-Ausschnitt ihres Morgenmantels zwischen die Brüste. »Kalt«, sagte sie.
»Aber es ist Sonne angesagt«, entgegnete er wacker. »Bis Mittag kommt sie sicher raus.«
Sie lächelte wieder, und ihre Augen schimmerten weich. »Ich meinte die Milch. Wie halten Sie sie so kühl?«
»Oh. Der Wagen. Ich habe ein paar Behälter, die extrastark isoliert sind.«
»Versprechen Sie mir, daß ich sie immer so bekomme?« Sie drehte die Flasche, so daß sie noch tiefer zwischen ihre Brüste glitt. »So kalt, meine ich.«
»Aber ja. Klar. Kalt«, stammelte er.
»Vielen Dank«, sagte sie. »Mr. Martin Snell Martin.«
Danach sah er sie für gewöhnlich mehrmals in der Woche, aber nie wieder bekam er sie in ihrem Morgenmantel zu Gesicht. Nicht, daß er eine Auffrischung seiner Erinnerung an diesen ersten Morgen nötig gehabt hätte.
Zufrieden mit seinem Aussehen, stellte Martin den Rückspiegel wieder richtig ein. Auch wenn sein Haar nicht voller war als vor Beginn der Behandlung, war es doch, seit er das Spray benutzte, längst nicht mehr so flusig. Er kramte hinten im Wagen nach der Flasche, die er stets am stärksten kühlte. Er wischte die Feuchtigkeit ab und polierte den Deckel aus Silberfolie an seiner Hemdbrust, bis er glänzte.
Dann trat er durch das Tor in die Einfahrt. Ihm fiel auf, daß es nicht abgeschlossen war, und er sagte dreimal leise: »Tor, Tor, Tor« vor sich hin, um sich einzuprägen, daß er sie darauf aufmerksam machen wollte. Man konnte das Tor zwar nicht abschließen, aber das war kein Grund, es Eindringlingen noch leichter zu machen, sie in ihrer Zurückgezogenheit zu stören.
Er hob den Deckel des Milchkastens hoch, um die Flasche für diesen Tag hineinzustellen, dann hielt er inne. Er runzelte die Stirn. Da stimmte etwas nicht.
Die Milch von gestern war nicht abgeholt worden. Die Flasche war warm, und die Feuchtigkeit, die sich auf dem Glas niedergeschlagen hatte und zum Boden der Flasche hinuntergeronnen war, war längst verdunstet.
Nun ja, dachte er zunächst, ein flatterhaftes Ding, unsere Miss Gabriella. Sie ist weggefahren, ohne wegen der Milch Bescheid zu geben. Er nahm die Flasche vom Vortag und klemmte sie unter den Arm. Er würde die Lieferungen einstellen, bis er wieder von ihr hörte.
Er war schon auf dem Rückweg zum Tor, da fiel es ihm wieder ein. Das Tor. Offen, dachte er und verspürte einen Anflug von Besorgnis.
Langsam ging er zum Milchkasten zurück. Vor dem Gartentörchen blieb er stehen. Ihre Zeitungen hatte sie auch nicht geholt, wie er jetzt sah. Die von gestern und die von heute – einmal die Daily Mail und einmal die Times – steckten noch in ihren Kästen. Und als er mit zusammengekniffenen Augen zur Haustür mit dem Briefkastenschlitz hinüberblickte, fiel ihm ein kleines weißes Dreieck auf, das sich vom verwitterten Eichenholz abhob, und er dachte: Die Post hat sie auch nicht geholt; sie muß weggefahren sein. Doch die Vorhänge an den Fenstern waren geöffnet, und das war nun weder vernünftig noch vorsichtig, wenn sie wirklich verreist war. Miss Gabriella schien zwar von Natur aus weder vernünftig noch vorsichtig zu sein, aber ganz sicher war sie gescheit genug, um das Haus nicht so demonstrativ leerstehen zu lassen. Oder etwa nicht?
Er war nicht sicher. Er blickte über seine Schulter zur Garage, einem Bau aus Holz und Backstein am Ende der Einfahrt. Am besten sehe ich da mal nach, sagte er sich. Er brauchte ja nicht hineinzugehen, er brauchte das Tor nicht einmal ganz aufzumachen. Er würde nur einen Blick hineinwerfen, um sich zu vergewissern, daß sie weggefahren war. Dann würde er die Milch mitnehmen, die Zeitungen in die Mülltonne werfen und sich wieder auf den Weg machen.
In der Garage war Platz für zwei Autos, und die Flügeltür war in der Mitte zu öffnen. Normalerweise war es durch ein Vorhängeschloß gesichert, aber Martin sah sofort, daß nicht abgeschlossen war. Einer der Türflügel stand gut sieben bis acht Zentimeter offen. Mit angehaltenem Atem und einem schnellen Blick zum Haus hinüber zog er den Türflügel ein Stück weiter auf und schob seinen Kopf in den Spalt.
Er sah Chrom blitzen, als das Licht auf die Stoßstange des silbernen Aston Martin fiel, in dem er sie ein dutzendmal oder öfter durch die Straßen hatte fahren sehen. Bei seinem Anblick überkam Martin ein seltsames Gefühl der Beklemmung.
Wenn der Wagen hier war und sie selbst auch, warum hatte sie dann die Milch nicht hereingeholt?
Vielleicht ist sie gestern den ganzen Tag über weggewesen, schon vom frühen Morgen an, antwortete er sich selbst. Vielleicht ist sie erst spät nach Hause gekommen und hat die Milch ganz vergessen.
Aber was war mit den Zeitungen? Im Gegensatz zur Milch waren sie in ihren Kästen nicht zu übersehen. Sie hätte auf ihrem Weg ins Haus unmittelbar an ihnen vorübergehen müssen. Weshalb sollte sie sie nicht mit hineingenommen haben?
Weil sie in London eingekauft und die Arme voller Pakete gehabt hatte. Und später, nachdem sie ihre Pakete abgelegt hatte, hatte sie die Zeitungen einfach vergessen.
Und die Post? Die mußte doch direkt an der Haustür gelegen haben. Warum hätte sie die liegen lassen sollen?
Weil es spät war, weil sie müde war und ins Bett wollte, weil sie außerdem das Haus gar nicht durch die vordere Tür betreten hatte. Sie war an der Hintertür hereingekommen, durch die Küche, und hatte die Post gar nicht gesehen. Dann war sie zu Bett gegangen.
Es kann nicht schaden, auf jeden Fall nach dem Rechten zu sehen, dachte Martin. Nein, es konnte ganz entschieden nicht schaden. Sie würde es sicher nicht übelnehmen. Das war nicht ihre Art. Sie würde gerührt sein, daß er an sie gedacht hatte, an eine Frau allein hier draußen auf dem Land, ohne einen Mann, der sich um ihr Wohl sorgte. Wahrscheinlich würde sie ihn hereinbitten.
Er straffte die Schultern, nahm die Zeitungen und stieß die Gartenpforte auf. Er ging den Weg hinauf. Die Sonne hatte diesen Teil des Gartens noch nicht erreicht. Tau glitzerte auf dem Rasen und den Backsteinen. Zu beiden Seiten der alten Haustür waren Lavendel und Mauerblümchen angepflanzt. Die Knospen des einen verströmten einen scharfen Duft, die Blüten der anderen ließen unter dem Gewicht des Morgentaus nickend die Köpfe hängen.
Martin griff zum Klingelzug und hörte das Läuten im Haus. Er wartete auf den Klang ihrer Schritte oder ihrer Stimme, auf das Knirschen des Schlüssels im Schloß. Aber nichts geschah.
Vielleicht, dachte er, nimmt sie gerade ein Bad. Vielleicht ist sie in der Küche, wo sie, wiederum vielleicht, die Klingel nicht hören kann. Auf jeden Fall konnte es nicht schaden nachzusehen.
Er lief um das Haus herum, um an die Hintertür zu klopfen, und fragte sich, wie viele Leute es geschafft hatten, das Haus durch diese Tür zu betreten, ohne sich an ihrem Sturz, der höchstens einen Meter fünfzig hoch war, den Kopf anzuschlagen. Prompt kam ihm ein Gedanke ... Konnte es sein, daß sie es eilig gehabt, sich angestoßen und das Bewußtsein verloren hatte? Hinter der weißen Tür rührte sich nichts.
Rechts von der Tür war ein Flügelfenster, durch das man in die Küche hineinsehen konnte. Martin spähte durch das Glas. Aber abgesehen von einem kleinen Tisch mit Leinentischtuch, der Arbeitsplatte, dem Herd, der Spüle und der geschlossenen Tür zum Eßzimmer konnte er nichts erkennen. Er mußte sich ein anderes Fenster suchen. Am besten eines auf dieser Seite des Hauses; ihm war nämlich ziemlich unbehaglich bei seiner Spannertätigkeit. Keinesfalls wollte er dabei von der Straße aus gesehen werden.
Er mußte durch ein Blumenbeet steigen, um zum Eßzimmerfenster zu gelangen, und achtete darauf, die Veilchen nicht zu zertrampeln. Er zwängte sich an einem Fliederstrauch vorbei und erreichte das Fenster.
Seltsam, dachte er. Er konnte zwar die Umrisse der Vorhänge erkennen, die geöffnet waren wie die anderen, aber sonst nichts. Das Glas schien schmutzig zu sein, völlig verdreckt sogar, was noch seltsamer war, da ja das Küchenfenster absolut sauber war und das Haus selbst weiß wie ein Lamm. Er rieb mit den Fingern über das Glas. Das nun war am allerseltsamsten: Das Glas war gar nicht schmutzig. Jedenfalls nicht außen.
Er stieg wieder über das Blumenbeet und ging den Weg, den er gekommen war, zurück. Er versuchte, die Hintertür zu öffnen. Abgeschlossen. Er lief zur Vordertür. Ebenfalls verschlossen. Er schlich zur Südseite des Hauses, wo Glyzinien die nackten schwarzen Balken überwucherten. Er bog um die Ecke und folgte dem Plattenweg, der sich an der Westmauer des Hauses entlangzog. Ganz hinten fand er das andere Eßzimmerfenster.
Dieses wiederum war nicht schmutzig, weder außen noch innen. Er legte die Hände auf den Sims, holte Atem und schaute hinein.
Auf den ersten Blick schien alles ganz normal. Der Eßtisch mit der Platte aus Naturholz, die Stühle um ihn herum, der offene Kamin mit der eisenverkleideten Rückwand und den kupfernen Bettflaschen, die an der Backsteinumrandung hingen. In einem Geschirrschrank stand Porzellan, auf einem antiken Waschtisch sammelten sich Karaffen und Gläser. Auf der einen Seite des offenen Kamins stand ein schwerer Lehnsessel und ihm gegenüber, auf der anderen Seite des Raums, am Fuß der Treppe, sein Pendant –
Martins Finger am Fenstersims verkrampften sich plötzlich. Er spürte, wie ein Holzsplitter sich in seine Handfläche bohrte, und griff dann hastig in seine Tasche, vergebens nach einem Gegenstand suchend, mit dem er den Fensterflügel hätte aufstemmen können. Die ganze Zeit über blieb sein Blick auf den Lehnstuhl geheftet.
Dieser stand schräg am Fuß der Treppe, und eine seiner Ecken stieß an die Wand unter dem Fenster, das so schmutzig war, daß man nicht hindurchsehen konnte. Jetzt erkannte Martin, daß das Fenster gar nicht im landläufigen Sinn dreckig war. Nein, es war von Qualm schwarz gefärbt; von einem Qualm, der in einer finsteren, dichten Wolke von dem Lehnsessel aufgestiegen war; von einem Qualm, der das Fenster, die Vorhänge, die Wand geschwärzt hatte; von einem Qualm, der auch im Treppenhaus seine Spuren hinterlassen hatte, als er in Schwaden nach oben gezogen war, zum Schlafzimmer hinauf, in dem Miss Gabriella, die süße Gabriella ...
Martin lief über den Rasen, kletterte über die Mauer und rannte dann den Fußweg hinunter zur Quelle.
Es war kurz nach Mittag, als Inspector Isabelle Ardery das Celandine Cottage zum erstenmal sah. Die Sonne stand hoch am Himmel und legte kleine Schattenteiche unter den Tannen, die die Einfahrt säumten. Diese war bereits mit gelbem Plastikband abgesperrt. Ein Polizeifahrzeug, ein roter Sierra, und ein blauweißer Milchwagen parkten hintereinander auf der schmalen Straße.
Sie stellte ihren Wagen hinter dem Milchauto ab und sah sich um, mißmutig trotz ihrer anfänglichen Freude darüber, so bald zu einem neuen Fall gerufen zu werden. So wie das hier aussah, würde bei den Nachbarn nicht viel zu holen sein. Ein Stück weiter unten an der Straße lagen zwar mehrere Häuser, Fachwerkhäuser mit Schindeldächern wie das Haus, in dem es gebrannt hatte, aber alle waren von Grundstücken umgeben, die Ruhe und Ungestörtheit garantierten. Wenn sich also herausstellen sollte, daß das Feuer auf Brandstiftung zurückzuführen war – wie das die Worte »Brandursache ungewiß« unterstellten, die auf dem Zettel gestanden hatten, den Ardery vor einer knappen Stunde von ihrem Chief Constable erhalten hatte –, würde sich wahrscheinlich ergeben, daß keiner der Nachbarn etwas Verdächtiges bemerkt hatte.
Sie duckte sich unter der Absperrung hindurch und öffnete das Tor zur Einfahrt. Auf der anderen Seite einer Koppel, auf der eine braune Stute graste, lehnte eine Handvoll Gaffer an einem Holzzaun. Sie konnte das Gemurmel der Leute hören, als sie die Auffahrt hinaufging. Ja, ganz recht, sagte sie lautlos zu ihnen, als sie durch eine kleinere Pforte in den Garten trat, eine Frau, die ermittelt. So ist das am Ende dieses Jahrhunderts.
»Inspector Ardery?« Eine Frauenstimme. Isabelle drehte sich um. Die Frau stand auf dem Backsteinweg und war offenbar von hinten aus dem Garten gekommen. »Sergeant Coffman«, stellte sie sich freundlich vor. »CID Greater Springburn.«
Isabelle trat zu ihr und reichte ihr die Hand.
Coffman sagte: »Der Chef ist im Augenblick nicht hier. Er ist mit der Leiche nach Pembury ins Krankenhaus gefahren.«
Isabelle runzelte die Stirn über diese ungewöhnliche Vorgehensweise. Der Chief Superintendent von Greater Springburn war derjenige gewesen, der sie hierherzitiert hatte. Es kam einem Verstoß gegen die Polizei-Etikette gleich, daß er vor ihrer Ankunft verschwunden war.
»Ins Krankenhaus?« fragte sie. »Haben Sie keinen Arzt, der die Leiche begleiten kann?«
Coffman verdrehte flüchtig die Augen zum Himmel. »Oh, der war natürlich auch hier und hat uns feierlich versichert, daß die Leiche tot sei. Aber nach der amtlichen Identifizierung des Opfers soll eine Pressekonferenz stattfinden, und der Chef liebt so was. Man braucht ihm nur ein Mikrofon in die Hand zu drücken, und er ist nicht mehr zu halten.«
»Wer ist dann überhaupt noch hier?«
»Zwei Constables, Neulinge, die hier ihre erste Gelegenheit bekommen, mal ins Geschäft reinzuriechen. Und der Mann, der die Bescherung entdeckt hat. Snell heißt er.«
»Was ist mit der Feuerwehr?«
»Die sind schon wieder weg. Snell hat vom Nachbarn aus angerufen. Von dem Haus drüben an der Quelle. Die sind dann sofort gekommen.«
»Und?«
Coffman lächelte. »Freuen Sie sich. Als sie reinstürmten, haben sie gleich gesehen, daß das Feuer schon seit Stunden erloschen war. Sie haben nichts angerührt, sondern lediglich bei uns angerufen und gewartet, bis wir kamen.«
Das wenigstens war ein Segen. Die Feuerwehr war bei den Ermittlungen nach einem Brandfall eines der größten Probleme. Diese Leute waren zur Erfüllung zweier Aufgaben ausgebildet: Leben zu retten und Feuer zu löschen. In Verfolgung dieser beiden Ziele pflegten sie Türen einzuschlagen, Zimmer zu überfluten, Decken einstürzen zu lassen und vernichteten dabei wertvolles Beweismaterial.
Isabelle ließ ihren Blick kurz über das Haus schweifen. »Gut. Ich seh mich zuerst mal hier draußen um.«
»Soll ich –«
»Allein bitte.«
Coffman erwiderte: »Natürlich. Bitte sehr«, und ging zum hinteren Teil des Hauses. An der Nordostecke des Gebäudes blieb sie stehen, drehte sich um und schob sich eine dunkelbraune Locke aus dem Gesicht. »Der Brandherd ist hier, in dieser Richtung, wenn Sie nachher soweit sind«, sagte sie. Sie wollte schon den Zeigefinger zum kollegialen Gruß an die Mütze legen, besann sich dann offensichtlich anders und verschwand um die Hausecke.
Isabelle trat vom gepflasterten Weg ins Gras und ging über den Rasen zur hinteren Ecke des Grundstücks. Von dort aus musterte sie zuerst das Haus, dann das Gelände, das es umgab.
Wenn hier tatsächlich Brandstiftung vorlag, würde es nicht leicht werden, außerhalb des Hauses Spuren zu finden. Es konnte Stunden beanspruchen, das Gelände abzusuchen, weil der Garten von Celandine Cottage der Traum eines jeden Hobbygärtners war: das Haus selbst an der Seite von Glyzinien überwachsen, die gerade zu blühen begannen; von Blumenbeeten umgeben, in denen vom Vergißmeinnicht bis zum Heidekraut, vom weißen Veilchen bis zum Lavendel, vom Stiefmütterchen bis zur Tulpe so ziemlich alles wucherte, was man sich vorstellen konnte. Wo keine Blumenrabatten waren, polsterte weicher Rasen den Boden. Wo kein Rasen wuchs, standen blühende Büsche und Sträucher. Wo keine Büsche und Sträucher waren, ragten Bäume in die Höhe. Sie schirmten das Haus teilweise vor Blicken von der Straße und vom Haus des nächsten Nachbarn ab. Wenn es hier Fuß- oder Reifenabdrücke gab, weggeworfene Werkzeuge, Brennstoffbehälter oder Streichholzheftchen, so würde es einige Mühe kosten, sie zu entdecken.
Sich von Osten nach Nordwesten bewegend, umrundete Isabelle aufmerksam das Haus. Sie suchte den Boden ab und nahm Dach und Türen in Augenschein. Am Ende ging sie nach hinten, zur offenstehenden Küchentür. Unter einer Pergola mit wildem, Wein, der gerade die ersten Blättchen entfaltete, saß dort mit hängendem Kopf, die Hände zwischen den Knien zusammengepreßt, ein Mann an einem Korbtisch. Ein Glas Wasser stand unberührt vor ihm.
»Mr. Snell?«
Der Mann hob den Kopf. »Sie haben sie mitgenommen«, sagte er. »Sie war ganz zugedeckt. Von Kopf bis Fuß. Eingepackt und verschnürt. Als hätten sie sie in einen Sack gesteckt. Das tut man doch nicht. Das gehört sich doch nicht. Da fehlt jede Pietät.«
Isabelle zog sich einen Stuhl heran und setzte sich zu ihm. Flüchtig verspürte sie eine Verpflichtung, ihn zu trösten, aber sich um Mitgefühl zu bemühen, schien sinnlos. Tot war tot, ganz gleich, was man sagte oder tat. Nichts konnte für die Lebenden daran etwas ändern.
»Mr. Snell, waren die Türen abgesperrt oder unverschlossen, als Sie kamen?«
»Ich hab versucht reinzukommen, als sich nichts rührte. Aber es ging nicht. Da hab ich durch das Fenster geschaut.« Er drückte wieder seine Hände aneinander und holte zitternd Atem. »Sie hat doch nicht gelitten, nicht wahr? Ich hab gehört, wie einer von denen gesagt hat, die Leiche hätte überhaupt keine Verbrennungen, und deshalb hätten sie sofort erkennen können, wer es war. Ist sie an einer Rauchvergiftung gestorben?«
»Mit Sicherheit können wir erst etwas sagen, wenn eine Obduktion gemacht worden ist«, bemerkte Sergeant Coffman, die zur Tür gekommen war, mit professioneller Vorsicht.
Der Mann schien die Antwort zu akzeptieren. Er sagte: »Was ist mit den kleinen Katzen?«
»Katzen?« fragte Isabelle.
»Miss Gabriellas Katzen, ja. Wo sind sie? Niemand hat sie rausgebracht.«
Coffman meinte: »Sie müssen aber irgendwo draußen sein. Im Haus haben wir sie nicht gesehen.«
»Sie hatte seit letzter Woche zwei kleine Kätzchen, hat sie drüben bei der Quelle gefunden. Da hatte sie jemand in einem Karton am Fußweg ausgesetzt. Sie hat sie mit nach Hause genommen und sich um sie gekümmert. Die haben in der Küche in ihrem Körbchen geschlafen und –« Snell wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Ich muß mich um meine Lieferungen kümmern. Sonst wird mir die Milch noch schlecht.«
»Haben Sie seine Aussage?« fragte Isabelle, als sie durch die niedrige Tür zu der Beamtin in die Küche trat.
»Ja. Aber ich dachte, Sie würden vielleicht mit ihm persönlich sprechen wollen. Soll ich ihn gehen lassen?«
»Wenn wir seine Adresse haben.«
»Gut. Ich kümmere mich darum. Da drüben sind wir fertig.« Coffman deutete auf eine Tür. Im Raum konnte Isabelle die Rundung eines Eßtischs sehen und einen Teil eines großen offenen Kamins.
»Wer hat das Zimmer betreten?«
»Drei Männer von der Feuerwehr. Die Leute vom CID.«
»Wer genau?«
»Nur der Fotograf und der Pathologe. Ich hielt es für das beste, alle anderen draußen warten zu lassen, bis Sie sich umgesehen haben.«
Sie führte Isabelle ins Eßzimmer. Die zwei jungen Constables waren zu beiden Seiten des vom Feuer stark mitgenommenen Ohrensessels postiert, der schräg am Fuß der Treppe stand. Stumm und stirnrunzelnd blickten sie auf ihn hinab. Der eine ernst und bedächtig, der andere mit einem Gesicht, als fühlte er sich durch den beißenden Geruch der verbrannten Polsterung beleidigt. Keiner konnte älter als dreiundzwanzig sein.
»Inspector Ardery«, stellte Coffman vor. »Maidstones Brandspezialistin. Gehen Sie beide bitte ein Stück zurück und machen Sie ihr Platz. Und versuchen Sie gleich mitzuschreiben, wenn Sie schon mal da sind.«
Isabelle nickte den beiden jungen Männern zu und richtete dann ihre Aufmerksamkeit auf den Sessel, wo sich das Feuer offensichtlich entwickelt hatte. Sie stellte ihre Tasche auf den Tisch, steckte das Maßband sowie Pinzette und Zange in ihre Jackentasche, nahm ihr Notizbuch zur Hand und fertigte zunächst einmal eine Skizze des Zimmers an, wobei sie sagte: »Es ist doch nichts verändert worden hier?«
»Überhaupt nichts«, versicherte Coffman. »Deswegen hab ich ja den Chef angerufen, nachdem ich mir das hier angesehen hatte. Wegen des Lehnstuhls an der Treppe. Schauen Sie. Der steht doch irgendwie nicht richtig.«
Isabelle stimmte Sergeant Coffman nicht so ohne weiteres zu. Sie wußte, daß die andere auf eine logische Frage hinaus wollte: Wieso steht der Sessel in einem solchen Winkel am Fuß der Treppe? Man mußte um ihn herumgehen, um in die erste Etage hinaufsteigen zu können. Sein Standort legte nahe, daß man ihn von anderer, gewohnter Stelle dorthin geschoben hatte.
Andererseits jedoch war der Raum voll mit weiteren Möbelstücken, von denen kein einziges Brandmale aufwies, die aber alle durch den Qualm verfärbt oder mit Ruß bedeckt waren. Neben dem Eßtisch und den vier dazugehörigen Stühlen standen rechts und links vom offenen Kamin ein altmodischer, geschnitzter Stuhl und ein zweiter Ohrensessel. An einer Wand fand sich ein Geschirrschrank, an einer anderen ein Tisch mit Karaffen, an einer dritten eine Kommode, auf der Porzellangegenstände zur Dekoration angeordnet waren. Und an allen Wänden hingen Gemälde und Drucke. Die Wände waren offensichtlich weiß gewesen. Eine war jetzt schwarz verrußt; die anderen wiesen variierende Grautöne auf. Ebenso wie die Spitzenvorhänge, die, schlaff und rußverkrustet, an ihren Stangen hingen.
»Haben Sie den Teppich untersucht?« fragte Isabelle Sergeant Coffman. »Wenn der Sessel vorher anderswo gestanden hat, müßten wir irgendwo die Abdrücke der Beine finden. Vielleicht in einem anderen Raum?«
»Eben«, erwiderte Coffman. »Schauen Sie sich das hier an.«
Isabelle sagte: »Einen Moment noch« und stellte ihre Skizze fertig, indem sie in schraffierten Linien die Positionen der Verrußungen an der Wand eintrug. Danach strichelte sie einen Grundriß und bezeichnete die verschiedenen Komponenten – Möbel, offener Kamin, Fenster, Türen, Treppe. Und erst dann trat sie zu dem Brandherd. Hier fertigte sie eine dritte Skizze des Sessels selbst an, wobei sie insbesondere das charakteristische Brandbild vermerkte. Ganz normal.
Ein Feuer, das sich an einer begrenzten Fläche entzündete, wie dieses hier, pflegte sich in Form eines Keils auszubreiten, mit dem Brandherd an der Spitze des Keils. Dieses Feuer hatte sich nicht anders verhalten. Auf der rechten Seite des Sessels, die mit der Treppe einen Winkel von fünfundvierzig Grad bildete, waren die Versengungen am stärksten. Das Feuer hatte zuerst geschwelt – wahrscheinlich mehrere Stunden lang –, sich durch Polsterung und Füllstoff hindurchgefressen und war dann nach oben, zum Sesselrahmen auf der rechten Seite, vorgedrungen, ehe es erloschen war. Und auf dieser rechten Seite breitete sich der Brandschaden vom Herd her in zwei Winkeln nach oben aus, der eine stumpf, der andere spitz, so daß sich etwa eine Keilformation ergab. Bei Isabelles erster, oberflächlicher Untersuchung wies nichts an dem Möbelstück auf Brandstiftung hin.
»Das sieht nach einer glimmenden Zigarette aus, wenn Sie mich fragen«, bemerkte einer der beiden jungen Constables. Er wirkte genervt. Es war nach Mittag. Er war hungrig. Isabelle sah den Blick aus schmalen Augen, den Sergeant Coffman dem jungen Mann zuwarf. Sie sagte klar und deutlich: »Aber es hat Sie niemand danach gefragt, stimmt’s, Sonnenschein?«
Er korrigiert hastig seinen Fehler und sagte: »Eines verstehe ich nicht – wieso ist nicht das ganze Haus abgebrannt?«
»Waren die Fenster alle geschlossen?« wandte sich Isabelle an Sergeant Coffman.
»Ja.«
Über die Schulter hinweg erklärte Isabelle dem Constable: »Das Feuer in dem Sessel hat allen Sauerstoff aufgezehrt, der im Haus war. Danach ist es ausgegangen.«
Sergeant Coffman kniete neben dem verkohlten Sessel nieder, und Isabelle gesellte sich zu ihr. Der Spannteppich war einfarbig – beige. Unter dem Sessel war er mit einer dichten Rußschicht bedeckt. Coffman wies auf drei schwache Abdrücke, jeder etwa sieben Zentimeter von je einem Stuhlbein entfernt. Sie sagte: »Das habe ich vorhin gemeint.«
Isabelle holte eine Bürste aus ihrer Tasche. »Möglich, ja«, gab sie zu und fegte behutsam den Ruß aus der nächstliegenden kleinen Mulde und dann aus einer zweiten. Als sie die Abdrücke im Teppich alle gesäubert hatte, sah sie, daß diese ein regelmäßiges Bild ergaben: die genaue ursprüngliche Position, in der der Sessel früher gestanden hatte.
»Sehen Sie. Er ist verstellt worden. Auf einem Bein gedreht.«
Isabelle hockte sich auf ihre Fersen und studierte die Position des Sessels im Verhältnis zum Raum. »Es könnte jemand dagegen gestoßen sein.«
»Aber glauben Sie denn nicht –«
»Wir brauchen mehr.«
Sie trat näher an den Sessel heran und untersuchte die Stelle, an der das Feuer sich entzündet hatte, eine verkohlte Wunde, die versengtes Füllmaterial ausblutete. Wie das bei Schwelfeuern der Fall zu sein pflegte, hatte der Sessel langsam gebrannt. Eine stetige Wolke giftigen Qualms war in die Höhe gestiegen, während ein glühendes Teilchen sich durch den Sesselbezug zur Füllung darunter durchgefressen hatte. Aber, und auch das war typisch für das Schwelfeuer, der Sessel war nur teilweise zerstört, weil aller vorhandener Sauerstoff bereits aufgezehrt war, als die ersten Flammen aufloderten, und das Feuer daher sogleich wieder erlosch.
So war es Isabelle möglich, die verkohlte Wunde zu sondieren, indem sie vorsichtig den verbrannten Stoff zur Seite schob und dem Weg der Glut folgte, der auf der rechten Seite des Sessels in die Tiefe führte. Es war ein mühseliges Unterfangen, eine schweigend durchgeführte, konzentrierte Untersuchung jedes einzelnen Zentimeters beim Licht einer Taschenlampe, die Coffman ruhig über Isabelles Schulter hielt. Mehr als eine Viertelstunde verging, ehe Isabelle fand, was sie suchte.
Mit der Pinzette zog sie ihren Fund heraus und musterte ihn mit Genugtuung, ehe sie ihn in die Höhe hielt.
»Doch eine Zigarette.« Coffman war sichtlich enttäuscht.
»Nein.« Im Gegensatz zu Coffman war Isabelle höchst zufrieden. »Es war eindeutig Brandstiftung.« Sie sah die beiden Constables an, die bei ihren Worten wach zu werden schienen. »Draußen muß alles abgesucht werden«, sagte sie. »Gehen Sie spiralenförmig vom Haus aus ans Ende des Grundstücks. Achten Sie auf Fuß- und Reifenabdrücke, Streichholzheftchen, Werkzeug, Behälter jeglicher Art, auf alles eben, was ungewöhnlich erscheint. Markieren Sie zuerst den Fundort. Dann fotografieren Sie und nehmen das Objekt mit. Verstanden?«
»Ja, Madam«, antwortete der eine; »in Ordnung«, der andere. Sie trabten zur Küche und von dort aus hinaus.
Coffman sah stirnrunzelnd auf den Zigarettenstummel, den Isabelle noch immer in der Hand hielt. »Das verstehe ich nicht«, sagte sie.
Isabelle wies sie auf das regelmäßig verformte Papier der Zigarette hin.
»Und?« fragte Coffman. »Für mich sieht es trotzdem wie eine Zigarette aus.«
»Das war auch beabsichtigt. Kommen Sie näher mit dem Licht. Bleiben Sie möglichst vom Sessel weg. Gut. Genau da.«
»Sie meinen, es ist gar keine Zigarette?« fragte Coffman, während Isabelle weitersuchte. »Es ist keine richtige Zigarette?«
»Es ist eine, und doch ist es keine.«
»Versteh ich nicht.«
»Genau darauf spekulierte der Brandstifter.«
»Aber –«
»Wenn ich mich nicht irre – und wir werden schon in ein paar Minuten Gewißheit haben, weil der Sessel es uns verraten wird – , haben wir es hier mit einem primitiven Zeitzünder zu tun. Er läßt dem Brandstifter vier bis sieben Minuten Zeit zu verschwinden, ehe das Feuer ausbricht.«
Coffman gestikulierte mit der Taschenlampe, als sie zum Sprechen ansetzte, besann sich, sagte: »Entschuldigung« und hielt die Lampe wieder still. »Wenn das zutrifft«, sagte sie, »wieso ist dann nicht der ganze Sessel in Flammen aufgegangen, als das Feuer tatsächlich ausbrach? Wäre das nicht das Ziel des Brandstifters gewesen? Ich weiß, die Fenster waren geschlossen, aber das Feuer hatte doch Zeit genug, sich vom Sessel zu den Vorhängen auszubreiten und dann die Wand hinauf, ehe der Sauerstoff ausging. Wieso ist das nicht geschehen? Wieso sind die Scheiben nicht von der Hitze zersprungen, so daß frische Luft ins Zimmer eindringen konnte? Wieso ist nicht das ganze verdammte Haus in Flammen aufgegangen?«
Isabelle fuhr in ihrem vorsichtigen Sondieren fort. Es war etwa so, als nähme sie Bezug und Füllmaterial des Sessels Fädchen um Fädchen auseinander. »Sie sprechen von der Geschwindigkeit, mit der ein Feuer sich ausbreitet«, sagte sie. »Diese Geschwindigkeit hängt aber von allen möglichen Faktoren ab – von Bezugsstoff und Füllung des Sessels, von der Stärke der Zugluft im Raum; von der Webart des Stoffes; vom Alter des Füllmaterials, von seiner chemischen Behandlung, wenn es behandelt worden ist.« Sie befingerte eine Kante des versengten Stoffs. »Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir erst Tests machen. Aber eines steht für mich fest.«
»Brandstiftung?« fragte Coffman. »Die nach Zufall aussehen soll?«
»Ja, eindeutig.«
Coffman sah zur Treppe, die hinter dem Sessel ins obere Stockwerk führte. »Na, das kann ja heiter werden.« Ihr Ton kündete von Unbehagen.
»Tja, das ist bei Brandstiftung meistens so.« Isabelle zog aus den Tiefen des Sessels den ersten Holzspan und legte ihn mit einem befriedigten Lächeln in einen Behälter. »Ausgezeichnet«, murmelte sie. »Welch erfreulicher Anblick.« Sie war sicher, daß in den verkohlten Gedärmen noch mindestens fünf weitere solche Holzspäne vergraben waren. Von neuem begann sie zu tasten, zu trennen, zu suchen. »Wer ist sie übrigens?«
»Wer? «
»Das Opfer. Die Frau mit den Katzen.«
»Das ist es ja«, antwortete Coffman. »Darum ist der Chef mit nach Pembury gefahren. Deswegen findet wohl später auch eine Pressekonferenz statt. Und daher hab ich gesagt, das kann heiter werden.«
»Wie meinen Sie das?«
»Hier wohnt eine Frau, verstehen Sie?«
»Ja. Ist sie ein Filmstar oder so was? Eine Prominente?«
»Nein, das ist sie nicht. Sie ist überhaupt keine Sie.«
Isabelle hob den Kopf. »Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
»Snell weiß es nicht. Niemand außer uns weiß Bescheid.«
»Worüber?«
»Daß die Leiche da oben ein Mann war.«
2
Als die Polizei am Markt von Billingsgate aufkreuzte, war es später Nachmittag, und von Rechts wegen hätte Jeannie überhaupt nicht da sein dürfen, weil der Londoner Fischmarkt um diese Zeit so leer und verlassen war wie ein Untergrundbahnhof morgens um drei. Aber sie war da, weil sie auf einen Monteur wartete, der den Herd von Crissys Café reparieren sollte. Der hatte ausgerechnet im dümmsten Moment seinen Geist aufgegeben, mitten in der Hauptgeschäftszeit gegen halb zehn, wenn die Fischhändler ihre Geschäfte mit den Einkäufern der Nobelrestaurants abgeschlossen hatten und der Arbeitstrupp mit der Säuberung des riesigen Parkplatzes von Styroporbehältern und Fischabfällen fertig war.
Die Mädels – alle wurden sie bei Crissys so genannt, ohne Rücksicht darauf, daß die älteste der Frauen achtundfünfzig war und die jüngste, Jeannie, zweiunddreißig – hatten es geschafft, den Herd mit gutem Zureden soweit zu bringen, daß er den Rest des Morgens wenigstens mit halber Kraft funktionierte, so daß sie weiterhin knusprig gebratenen Schinkenspeck, Eier, Blutwurst, Käsetoast und andere Gerichte auftischen konnten, als wäre alles in bester Ordnung. Wenn sie aber eine Meuterei unter ihren Gästen vermeiden wollten – ja, schlimmer noch: wenn sie ihre Gäste nicht ans verlieren wollten –, dann mußte der Herd des kleinen Cafés schleunigst repariert werden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!