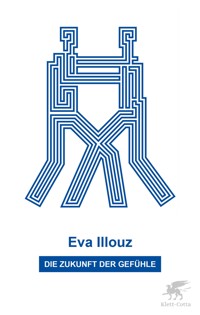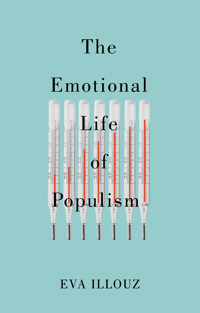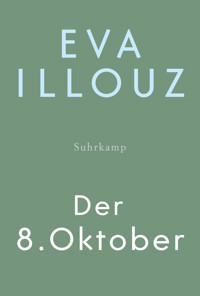
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 7. Oktober 2023 verübte die radikalislamische Terrormiliz Hamas verheerende Anschläge in Israel. Doch am nächsten Tag dominierte nicht Mitgefühl für die Angegriffenen die öffentliche Meinung. Vielmehr wurden die Attacken in progressiven Kreisen von Berlin über Paris bis New York als Akt des Widerstands legitimiert, ja teilweise sogar bejubelt. Woher kommt dieser Hass, der sich selbst für moralisch überlegen hält?
Die Ereignisse vom 7., aber auch die vom 8. Oktober haben Eva Illouz tief erschüttert. In ihrer kämpferischen Intervention zeichnet sie nach, wie Identitätspolitik und vom französischen Poststrukturalismus inspirierte Theorien zum Nährboden für ein Denken werden konnten, das historische Tatsachen und die ihnen innewohnende Komplexität ausblendet und Israel zum Inbegriff des kolonialistischen Bösen stilisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Eva Illouz
Der 8. Oktober
Aus dem Französischen von Michael Adrian
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die französische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Le 8-Octobre bei Éditions Gallimard, Paris.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5530.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025 © Éditions Gallimard, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
eISBN 978-3-518-78488-4
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
1 Ein moralisches Rätsel
2 Gegen die Natur: das fehlende Mitleid
3 Die Geisteswissenschaften, die Hauptverdächtigen
4
French Theory
als Denkstil
Pantextualismus und pouvoirisme
Die Superkritik
Umherwandernde Strukturen
5 Die Konkurrenz zwischen den Minderheiten
6 Dekolonialismus,
pouvoirisme
und der Westen
7 Vom rot-grünen zum grün-grünen Bündnis
Die dekoloniale Matrix
Das rot-grüne Bündnis
Die Parti des Indigènes
8 Ein sich tugendhaft gebender Hass
Kognitiver Trost
Identitärer Trost oder der Kampf der Minderheiten
Anmerkungen
Informationen zum Buch
3
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
Der 8. Oktober
7Bis zum 7. Oktober 2023 glaubte ich, Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien die letzten Ereignisse, die abweichende Überzeugungen und Meinungen in einer moralischen Gemeinschaft des Mitgefühls noch zusammenbringen könnten. Und mir schien, dass die politische Sensibilität, die sich am ehesten über Gräueltaten empören würde, meine sei, die linke. Ich habe mich geirrt. Ein beträchtlicher Teil der globalen Linken – unter wechselnden Namen wie identitäre, wache bzw. aufgeweckte, dekoloniale oder progressive Linke – hat die Existenz dieser Gräueltaten geleugnet oder sie als Akt des »antikolonialen Widerstands« gefeiert. Diese Linke hat die schockierten und leidtragenden Juden im Stich gelassen, ignoriert, stigmatisiert und einer vermeintlichen Urschuld, des israelischen Kolonialismus, bezichtigt. Warum? Wie ist es so weit gekommen?
9
1
Ein moralisches Rätsel
Manchmal kommt es auf der Weltbühne zu Ereignissen, die unmittelbar einen grundlegenden Bruch markieren. Der 7. Oktober 2023 war ein solches Ereignis. Die Hamas, jene Organisation, die 2007 gewaltsam (durch Tötung von Anhängern ihrer Gegenpartei, der Fatah) die Macht im Gazastreifen übernommen hatte und von den Vereinigten Staaten wie der Europäischen Union als terroristisch eingestuft worden ist, verübte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, indem sie fast 1200 Israelis ermordete, überwiegend Zivilisten. Selbst diejenigen, die sich in trostloser Weise an die menschliche Barbarei gewöhnt haben, erschauderten angesichts der gezielten Grausamkeit dieser Massaker: Kinder und Babys wurden aus nächster Nähe getötet, es kam zu sexueller Gewalt und Misshandlungen von seltenem Ausmaß, ganze Familien wurden verbrannt und Leichen öffentlich inmitten tanzender und singender 10Menschenmengen zur Schau gestellt – das alles unter großem Jubel gefilmt und über soziale Netzwerke in der ganzen Welt verbreitet. Es handelte sich dabei um ein neues Regime des Gräuels: Statt im Verborgenen zu operieren, zeigten sich die Terroristen stolz mittels Action-Cams und sendeten die Bilder ihrer Mordtaten live. Schockierender noch als dieses »festliche« Regime des Verbrechens gegen die Menschlichkeit waren die Reaktionen einer erstaunlichen Zahl progressiver Beobachter, die in den fröhlichen Chor der Menschenansammlungen aus Gaza einstimmten.
Soweit ich mich erinnern kann, hat kein anderes Massaker – ob im Südsudan oder im Kongo, in Äthiopien, Sri Lanka, Syrien oder der Ukraine – im Westen und in islamischen Ländern so viele Menschen glücklich gemacht. Am Sonntag, dem 8. Oktober, konnte man auf einer Versammlung unter dem Motto »All Out for Palestine« im demokratischen New York laut jubelnde Menschen dabei beobachten, wie sie den Akt des Abstechens mimten. Bret Stephens, Kolumnist der New York Times, war auf dieser Kundgebung. Er suchte dort, wie er 11schrieb, Zeichen von Trauer oder Mitleid, und seien sie erzwungen oder der Form halber. Er konnte aber nichts anderes beobachten als »Euphorie und Schadenfreude«.1 Das war beileibe kein Einzelfall. Joseph Massad, ein Professor jordanischer Herkunft an der Universität Columbia, bezeichnete das Massaker als »atemberaubend«, »innovativ« und »eindrucksvoll«.2 Russell Rickford, Historiker an der Universität Cornell mit dem Forschungsschwerpunkt Black Radical Tradition, äußerte sich »begeistert« über die Nachricht von dem Massaker.3 Im britischen Brighton pries eine Demonstrantin bei einer ähnlichen Versammlung die Attentate mit einem Megafon als »schön«, »inspirierend« und »geglückt«.4 All das, obwohl bereits bekannt war, dass Babys und Kleinkinder brutal abgeschlachtet worden waren.
In Frankreich veröffentlichte die 2009 gegründete Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) eine offizielle Stellungnahme zu diesem 7. Oktober, in der sie ihre »Unterstützung der Palästinenser:innen und der von ihnen gewählten Mittel, um Widerstand zu leisten«, erklärte.5 Die postkoloniale Bewegung PIR (Parti des Indigènes de la République) feierte das 12Massaker als heldenhaften Akt des Widerstands.6 Ein Mitglied der Union juive française pour la paix (UJP, Jüdisch-französische Friedensunion) verglich die Hamas mit der Gruppe Manouchian, also mit einer Gruppe von Ausländern, die sich der französischen Résistance gegen die Nazis angeschlossen hatten, von denen sie gefangengenommen und hingerichtet wurden.7 In dem US-amerikanischen Podcast Democracy now! sah Judith Butler, Professorin für Rhetorik und Komparatistik in Berkeley, in den Gräueltaten einen Akt des Widerstands.8 33 Studierendengruppen an der Universität Harvard haben die alleinige Verantwortung für das Massaker Israel selbst zugeschrieben.9 Unter den hunderten von Erklärungen, die ich gelesen habe, scheint mir die folgende des Star-Professors für Humanökologie Andreas Malm an der Universität Lund exemplarisch: »Das Erste, was wir in diesen frühen Stunden [des 7. Oktobers] sagten, bestand weniger aus Worten als aus Jubelrufen. Diejenigen von uns, die ihr Leben mit der und geprägt durch die Palästinafrage verbracht haben, konnten nicht anders auf die Szenen des Widerstands reagieren, als der Checkpoint Erez 13gestürmt wurde: dieses Labyrinth aus Betontürmen, Einzäunungen und Überwachungssystemen, diese vollendete Installation von Kanonen, Scannern und Kameras – zweifellos das ungeheuerlichste Monument der Beherrschung eines anderen Volkes, in dem ich jemals gewesen bin – plötzlich in den Händen palästinensischer Kämpfer, die die Besatzungskräfte übermannt und ihre Fahne heruntergerissen hatten. Wie sollten wir da nicht vor Erstaunen und Freude aufschreien?«10
Frauen waren mit Kopfschüssen getötet worden, während sie vergewaltigt wurden, andere fand man mit gebrochenem Becken auf, so brutal waren die sexuellen Übergriffe gegen sie gewesen, oder aber mit Nägeln in den Genitalien.11 Ungeachtet solcher Tatsachen verspürte dieser von einer Universität in einer großen Demokratie besoldete Professor nichts als Jubel über die Terroristen auf dem Weg zu ihrem Pogrom. Dass die Palästinenser:innen eine gewisse Schadenfreude empfunden haben mögen, ließe sich vielleicht im Lichte eines seit einem Jahrhundert andauernden Konflikts erklären; was aber war mit den einfachen Kanadiern, Amerikanern, Schweden oder 14Franzosen, für die keine persönliche Erinnerung im Spiel war? Wie soll man ihre merkwürdige Freude oder Gleichgültigkeit angesichts der Nachricht von dem Pogrom erklären? Die weltweite Erregung der Universitäten, Intellektuellen und Künstler:innen war von trostloser und verblüffender Einförmigkeit.
Judith Butler, die bereits erwähnte Ikone der queeren Linken, nahm am 3. März 2024 an einem Runden Tisch in Paris teil, veranstaltet von der dekolonialen Partei PIR. Butlers Anmerkungen zu den kaltblütig vergewaltigten, gefolterten und abgeschlachteten Frauen mussten jeden Menschen mit einem Mindestmaß an Anstand sprachlos machen. »Ob es Beweise für die behaupteten Vergewaltigungen israelischer Frauen gibt oder nicht«, sagte sie mit skeptisch verzogenem Gesicht, »o.k., wenn es Beweise gibt, dann werden wir das beklagen […], aber wir wollen diese Beweise sehen und wir wollen wissen, ob es stimmt.«12