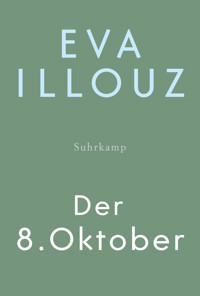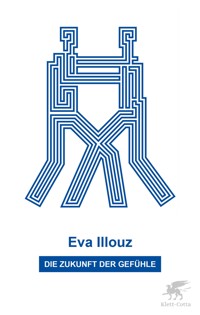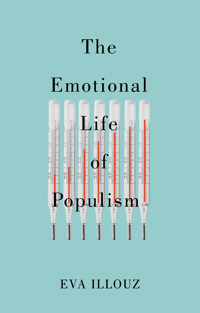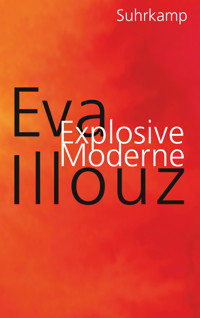17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ist es für einen Herrscher besser, geliebt oder gefürchtet zu werden? Da sich beides schwer vereinen lasse, gibt Machiavelli in Der Fürst, seiner berühmten Abhandlung zu den Grundsätzen der Staatsräson, der Furcht den Vorrang. In ihrem neuen Buch schließt die israelische Soziologin Eva Illouz in zweierlei Hinsicht an Machiavelli an: Sie unterstreicht die Bedeutung von Emotionen in der Politik und arbeitet heraus, wie Rechtspopulisten bestimmte Gefühle instrumentalisieren.
Israel ist seit seiner Gründung wie kaum ein anderes Land von Sicherheitsfragen geprägt. In dieser Situation sei dem langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu das machiavellistische Kunststück gelungen, gerade wegen der Furcht, die er sät, geliebt zu werden. Anhand ausführlicher Interviews mit u. a. Menschenrechtsaktivisten zeigt Illouz, wie Angst und Ressentiment Gesellschaften spalten und die Demokratie unterminieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
3Eva Illouz
Undemokratische Emotionen
Das Beispiel Israel
Unter Mitarbeit von Avital Sicron
Aus dem Englischen von Michael Adrian
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2780.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© Eva Illouz 2022Alle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Textund Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77616-2
www.suhrkamp.de
Widmung
Zum Gedenken an meinen Vater Haim Illouz, der Israel so sehr liebte
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Einleitung: Der Wurm im Apfel
Gefühlsstrukturen
Gefühle, Charakter und Politik
1. Versicherheitlichte Demokratie und Angst
Israel und Sicherheit
Die Auswirkungen der Angst auf das Gemeinwesen
Resümee
2. Abscheu und Identität
Abscheu als Angst vor Vermischung
Abscheu und die Logik des Rassismus
Abscheu-Unternehmer und die Angst vor Verunreinigung
Resümee
3. Ressentiment oder der verborgene Eros des nationalistischen Populismus
Ein internationaler politischer Stil
Warum ist die Opferrolle so erfolgreich?
Resümee
4. Nationalstolz als Loyalität
Nationalismus und Gemeinschaft
Der israelische Nationalismus
Resümee
Epilog: Die Gefühle einer anständigen Gesellschaft
Die Gefühle einer »anständigen« Gesellschaft
Von der Solidarität zur Brüderlichkeit
Brüderlichkeit und Universalismus
Die Juden und der Universalismus
Anmerkungen
Einleitung: Der Wurm im Apfel
1. Versicherheitlichte Demokratie und Angst
2. Abscheu und Identität
3. Ressentiment oder der verborgene Eros des nationalistischen Populismus
4. Nationalstolz als Loyalität
Epilog: Die Gefühle einer anständigen Gesellschaft
Informationen zum Buch
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
7
Einleitung: Der Wurm im Apfel
1967 hielt Theodor W. Adorno in Wien einen Vortrag, der trotz aller Unterschiede zwischen seiner und unserer Zeit von erstaunlicher Relevanz für die Gegenwart ist. Obwohl die Niederlage des Faschismus offiziell besiegelt sei, so Adorno, bestünden die gesellschaftlichen Voraussetzungen für faschistische Bewegungen fort. Die Hauptschuld daran lastete er der unverändert herrschenden »Konzentrationstendenz des Kapitals« an, bedeute sie doch nach wie vor »die Möglichkeit der permanenten Deklassierung von Schichten, die ihrem subjektiven Klassenbewußtsein nach durchaus bürgerlich« seien, »die ihre Privilegien, ihren sozialen Status festhalten möchten und womöglich ihn verstärken«. Diese von Abwärtsmobilität bedrohten Gruppen seien es, die
zu einem Haß auf den Sozialismus oder das, was sie Sozialismus nennen, [tendieren], das heißt, sie verschieben die Schuld an ihrer eigenen potentiellen Deklassierung nicht etwa auf die Apparatur, die das bewirkt, sondern auf diejenigen, die dem System, in dem sie einmal Status besessen haben, jedenfalls nach traditionellen Vorstellungen, kritisch gegenüber gestanden haben […].1
In diese wenigen Zeilen packte Adorno einige der zentralen Einsichten der Kritischen Theorie. Für ihn ist der Faschismus kein Unfall der Geschichte und auch keine Anomalie. Er ist vielmehr im Inneren der Demokratie am Werk und gehört zu ihr dazu. Er ist, um eine altbekannte Metapher zu gebrauchen, der Wurm im Apfel, der die Frucht, für das nackte Auge unsichtbar, von innen heraus zerfrisst. In einem Handbuch zur Kritischen Theorie heißt es: »Es war eines der großen Themen der frühen Frankfurter Schule, dass zwischen dem Extrem des politischen Faschismus und den eher alltäglichen sozialen Pathologien des westlichen bürgerlichen Ka8pitalismus keine scharfe Grenze zu ziehen ist.«2 Damit ist zugleich gesagt, dass Faschismus nicht als voll ausgebildetes Regime in Erscheinung treten muss. Er könnte auch einfach nur eine Tendenz sein, ein Bündel pragmatischer Orientierungen und Vorstellungen, die sich innerhalb einer Demokratie zur Geltung bringen. In Adornos Bemerkungen steckt darüber hinaus die Behauptung, dass der Kapitalismus zur Konzentration von Kapital und Macht neigt, ein wenig überraschender Gedanke für einen Marxisten, den aber selbst Nichtmarxisten nur schwerlich würden bestreiten können. Adorno hatte noch nicht miterlebt, auf wie spektakuläre Weise demokratische Wahlen durch konzentriertes Kapital vereinnahmt werden können. Er bezog sich vielmehr auf Dynamiken, die das Kapital in liberalen Gesellschaften entfesselte und die unablässig genau die bürgerlichen Klassen zu degradieren drohten, die zuvor zum kapitalistischen System beigetragen und von ihm profitiert hatten. Man beachte, dass Adorno die Träger dieses neuen Faschismus in der bürgerlichen Klasse (einer Mischung aus der Oberschicht und bestimmten Segmenten der Mittelschicht) ausmacht, nicht im Proletariat. In Anlehnung an eine soziologische Tradition, die den Faschismus als Ausdruck der Angst vor Abwärtsmobilität verstand,3 behauptet Adorno, dass die Klasse, die über Privilegien verfügt hat und immer noch verfügt, den Faschismus befürwortet, wenn sie diese Privilegien bedroht sieht. Der Verlust von Privilegien scheint somit ein entscheidendes Motiv dafür zu sein, antidemokratische Führer zu unterstützen (bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 lag die Zustimmung zu Trump in Gruppen mit hohem und mittlerem Einkommen tendenziell höher als bei Bürgerinnen und Bürgern mit sehr niedrigen Gehältern, die sich eher für Clinton entschieden4). Der Wunsch, Privilegien zu bewahren, oder die Angst, sie zu verlieren, ist, wie Adorno sagt, eine treibende 9Kraft in der Politik im Allgemeinen und in der faschistischen Politik im Besonderen.
Der dritte und vielleicht (zumindest für das vorliegende Buch) bedeutendste Schritt in Adornos bündigen Bemerkungen besteht in der These, die Identifikation mit dem Faschismus gründe in einer bestimmten Weise, über Ursachen nachzudenken (also darüber, warum die Dinge so sind, wie sie sind) sowie Schuld und Verantwortung zuzuschreiben. Die degradierte bürgerliche Klasse wird gerade nicht dem kapitalistischen System wirtschaftlicher Konzentration die Schuld geben, das ihren Verlust an Status und Privilegien herbeiführt. Stattdessen wird sie die Schuld auf diejenigen abschieben, die genau dieses System kritisieren. Bei aller lakonischen Kürze gibt uns Adorno zu verstehen, dass die abstiegsbedrohte Klasse ihre soziale Welt wie in einer Camera obscura wahrnimmt, als ein auf dem Kopf stehendes Bild der äußeren Welt. In der marxistischen Tradition der Ideologiekritik benennt Adorno hier einen sehr wichtigen kognitiven Prozess, der im Protofaschismus am Werk ist: die Unfähigkeit, die Kausalkette zu verstehen, die für die eigene gesellschaftliche Situation verantwortlich ist. Adorno legt damit nahe, dass Menschen die soziale Welt unter Umständen grundlegend verzerrt wahrnehmen. Die bürgerliche Klasse (wie andere wahrscheinlich auch) kann die Ursachen ihres Statusverlusts nicht richtig bestimmen und sich daher auch nicht mit jener Kritik solidarisieren, die zwar nicht gerade die bürgerlichen Interessen verteidigt, aber doch zumindest das System infrage stellt, das für ihre Abstiegserfahrung verantwortlich ist.
In seinen knappen Ausführungen stellt Adorno somit eine Behauptung über das beharrliche Fortbestehen faschistischer Tendenzen in unseren Gesellschaften auf, die sich sowohl ökonomischen Prozessen der Kapitalakkumulation und -konzentration als auch bestimmten verzerrten oder lückenhaften 10Denkweisen verdanken, wie sie sich insbesondere einschleichen, wenn wir Kausalketten konstruieren, uns Ereignisse verständlich machen wollen und Schuldige suchen. In einem anderen Zusammenhang hat Jason Stanley dies als eine fehlgeleitete Ideologie (flawed ideology) bezeichnet. Eine fehlgeleitete Ideologie – so die Definition in seinem Buch How Propaganda Works – beraubt »Gruppen des Wissens über ihre eigenen mentalen Zustände, indem sie ihnen ihre eigenen Interessen systematisch verschleiert«.5 Was die wahren Interessen einer Klasse oder Gruppe von Menschen sind, versteht sich natürlich nicht von selbst. Jedes Urteil darüber setzt bestimmte Vorannahmen seitens derjenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler voraus, die zwischen wahren und falschen Interessen unterscheiden möchten und dabei eine gewisse epistemische Autorität für sich reklamieren. Wenn wir aber die soziale Welt verstehen wollen, scheint mir das Einnehmen einer solchen Position der epistemischen Autorität unvermeidlich zu sein. Ansonsten geraten wir in eine Situation des Relativismus oder des epistemologischen Chaos, in der jeder Versuch, sich der Wahrheit zumindest anzunähern, sinnlos wäre. Es gibt kein Denken ohne Lücken, Verdrängung, Fehler und Verleugnung. Diese Verleugnungen und Auslassungen ans Licht zu bringen, bleibt daher die Aufgabe der kritischen sozialwissenschaftlichen Analyse.
Die Idee der Ideologiekritik ist ausgiebig kritisiert worden, doch wie uns die jüngsten politischen Entwicklungen zeigen, können wir nicht gut auf sie verzichten. Für manche ist diese Form von Kritik im Regelfall unredlich,6 weil sie nur an anderen, nicht an sich selbst geübt werde, während sie anderen Stimmen zufolge der kritisierenden Person zu viel Autorität einräumt. Ein weiteres Argument gegen die Ideologiekritik lautet, dass jede Wahl, die Menschen treffen, insofern rational ist, als sie ihre Präferenzen widerspiegelt. Und gewiss 11sollte die soziologische Analyse die Gründe respektieren, die Bürgerinnen und Bürger für ihre Meinungen und Entscheidungen haben, statt sie lächerlich zu machen oder vom Tisch zu wischen. In einer Zeit aber, in der haarsträubende Verschwörungstheorien um sich greifen und die demokratischen Prozesse der Meinungsbildung behindern, können wir uns den Luxus der Annahme, dass alle Perspektiven gleich oder gleich gut fundiert sind, nicht mehr leisten. Genauso wenig können wir es uns leisten, die Manipulationen zu ignorieren, die eine zunehmend raffiniertere, in den Fertigkeiten der Meinungssteuerung und im Streuen von Gerüchten außerordentlich versierte politische Klasse vornimmt. Die Macht dieser Formen von Manipulation hat sich mit der rasanten Übermittlung von Informationen durch die sozialen Medien verzehnfacht.7 Ob wir wollen oder nicht, müssen wir somit auf die Idee der Ideologiekritik zurückkommen.
Eine Ideologie ist dann fehlgeleitet, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllt: Sie widerspricht den Grundprinzipien der Demokratie und damit dem Wunsch der Bürgerinnen nach politischen Institutionen, die sie repräsentieren; die konkrete Politik, die die Verfechter einer Ideologie verfolgen, steht im Widerspruch zu ihren erklärten ideologischen Grundsätzen oder Zielen (wenn etwa der Anspruch, die kleinen Leute zu vertreten, mit Maßnahmen einhergeht, die ihnen den Erwerb von Wohneigentum sehr erschweren); und sie ist blind für die Schwächen der politischen Anführerinnen und Anführer (wie selbstsüchtiger Korruption oder einer Gleichgültigkeit gegenüber der Wohlfahrt der Nation). Es sollte freilich klar sein, dass nicht nur die Anhängerinnen und Anhänger populistischer Protofaschisten in diese kognitive Falle gehen und solche blinden Flecke aufweisen können; zu zahlreich sind die Gegenbeispiele. So hat Jerome McGann die Ansicht vertreten, die romantische Dichtung 12habe die materiellen Bedingungen, unter denen sie entstand, durch Ausflüchte und Auslassungen verleugnet.8 Und die französischen Kommunisten, die noch in den fünfziger Jahren an das sowjetische Regime glaubten, als ihnen Stalins Mordlust hätte bekannt sein können, sind kein weniger triftiges Beispiel für eine solche fehlgeleitete Ideologie.9
Um an Adornos Gedanken festzuhalten, wirkt der Faschismus also nach wie vor aus dem Herzen demokratischer Gesellschaften heraus, weil viele derjenigen, denen die Logik der wirtschaftlichen Konzentration am meisten zusetzt, die einzelnen Glieder der Kausalkette nicht zu verbinden wissen und sich sogar gegen jene stellen können, die sich bemühen, diese Logik aufzudecken. So entsteht seltsamerweise ein Gegensatz zwischen denen, die sich darum bemühen, Ungerechtigkeit und Ungleichheit anzuprangern, und denen, die genau darunter zu leiden haben. Dieser Gegensatz ist zu einem zentralen Merkmal vieler Demokratien rund um den Erdball geworden. Das Thema der fehlgeleiteten Ideologie ist für unsere Gegenwart von besonderer Bedeutung, weil die Demokratie auf der ganzen Welt und besonders in Israel von einem »nationalistischen Populismus« unter Beschuss genommen wird, wie Francis Fukuyama dieses Phänomen nennt. Der nationalistische Populismus ist eine politische Form, die die Institutionen der Demokratie von innen heraus aushöhlt und es damit den mächtigsten Akteuren der Gesellschaft – Unternehmen und Lobbys – ermöglicht, den Staat für ihre eigenen Interessen einzuspannen, zum Schaden des demos, der sich dadurch ausgerechnet von den Institutionen entfremdet fühlt, die historisch seine Souveränität garantiert haben. Wie die Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Ziblatt meinen, sterben Demokratien nicht nur durch Militärputsche und andere dramatische Ereignisse dieser Art. Sie können auch einfach dahinsiechen.10 Der Popu13lismus ist eine politische Form, die dieses Dahinsiechen annimmt.
Populismus per se ist nicht faschistisch, sondern eher eine faschistische Tendenz, ein Vektor, der das politische Feld in Richtung regressiver Züge und antidemokratischer Einstellungen verschiebt. Eine umfangreiche Forschungsliteratur hat sich darum bemüht, das Aufkommen solcher faschistischer Tendenzen zu erklären.11 Manche verweisen auf die ökonomische Globalisierung; andere sehen im Populismus eine Reaktion auf einen kulturellen Wertewandel. Fehlgeleitete Ideologien verdanken sich aber auch einer Transformation der medialen Landschaft, bei der in vielen Ländern Zeitungen oder TV-Sender in der bewussten Absicht lanciert oder gekauft werden, um die vermeintlich »linksliberale Agenda« der »Mainstreammedien« zu revidieren. In Frankreich etwa besitzt der milliardenschwere Geschäftsmann Vincent Bolloré mehrere Fernsehsender, darunter CNews, einen 24-Stunden-Nachrichtenkanal mit stramm rechter Ausrichtung. Bolloré ist als Geldgeber der Kampagne Éric Zemmours genannt worden, eines rechtsextremen französischen Populisten.12 Ein anderes Beispiel ist der aus Australien stammende US-amerikanische Milliardär Rupert Murdoch, der weltweit Hunderte Zeitungen und TV-Sender – darunter in den USA die Propagandamaschine Fox News – besitzt und beschuldigt worden ist, diese zur Unterstützung seiner politischen Verbündeten zu nutzen.13 In Israel wiederum übt die von einem mittlerweile verstorbenen Kasinomogul finanzierte Gratiszeitung Israel Hayom enormen Einfluss aus. So hat die Konzentration des Kapitals überall auf der Welt das Schmieden beachtlicher Waffen zur Verzerrung des Bewusstseins ermöglicht.
Parallel zu dieser zunehmenden Kontrolle von Informationsflüssen hat die Globalisierung der Wirtschaft die Arbei14terschicht in prekäre Lebensumstände versetzt.14 Die globalisierungsfreundliche Politik von Präsident Bill Clinton, etwa die Unterzeichnung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta, hat viele Wähler aus den arbeitenden Klassen wütend gemacht; der seinerzeitige Vorsitzende einer Gewerkschaft der Beschäftigten der Elektroindustrie wird mit den Worten zitiert: »Clinton hat uns verarscht, und wir werden das nicht vergessen.«15 Diese Klassen fühlen sich von der Linken nicht mehr vertreten und zweifeln an ihrer Fähigkeit, ihre Interessen zur Sprache zu bringen, ein Umstand, in dem sich die Implosion sozialdemokratischen Gedankenguts rund um den Erdball und vielleicht auch die schiere Erschöpfung des Liberalismus widerspiegeln.16 Die Kombination dieser Faktoren erklärt, warum wir in vielen als gefestigt geltenden Demokratien eine Zunahme faschistischer Tendenzen sehen – noch keinen regelrechten Faschismus, aber eine Geisteshaltung, die zweifellos für einen solchen prädisponiert.
Das vorliegende Buch konzentriert sich auf einen Aspekt dieser komplexen Mischung: die Wahrnehmung der sozialen Welt anhand fehlgeleiteter sozial-kausaler Bezugssysteme, mithin falsche Erklärungen gesellschaftlicher und ökonomischer Zusammenhänge. »Fehlgeleitet«, das scheint dem Wort »falsch« vielleicht unangenehm nahezukommen und uns zu den epistemologischen und moralischen Problemen der Ideologiekritik zurückzubringen. Und doch sollte man »fehlgeleitet« von »falsch« unterscheiden, weil ersteres Attribut das Denken und Empfinden der Bürger nicht abqualifiziert und verneint. Es birgt die Möglichkeit, dass dieses Denken zwar nicht perfekt, aber auch nicht falsch, sondern schlicht fehlgeleitet ist. Es ist insofern nicht falsch, als es die Spur einer echten sozialen Erfahrung enthält, die von der Analyse eingeholt werden muss. Diese Spuren bringen Gründe ans Licht, die sowohl verstanden als auch in Rechnung gestellt werden 15müssen. Ich interessiere mich für diese Gründe, wie sie aus einem Dutzend Interviews hervorgehen, welche ich mit Menschen geführt habe, die sich zu rechten, populistischen, ultranationalistischen Weltanschauungen bekennen: Ich versuche die innere Logik ihrer Weltanschauungen zu verstehen und frage, wo und wie genau Gedanken über unsere soziale Umwelt verdreht worden sind. Undemokratische Emotionen beschäftigt sich mit den kausalen Rahmen zur Erklärung unserer sozialen Welt und mit den Mechanismen, durch die sie die politische Wahrnehmung und das Verhalten der Bürger tiefgreifend beeinflussen.
Wenn wir verstehen wollen, warum manche Bezugnahmen unsere Wahrnehmung der sozialen Welt verzerren können, warum wir unfähig sind, eine echte Misere beim Namen zu nennen, müssen wir Adornos Überlegungen auf neue Bereiche anwenden und die Verquickung des sozialen Denkens mit Gefühlen klarer erfassen, als er es tat. Nur Gefühle verfügen über die Macht, empirische Beweise zu leugnen, unsere Motivation zu bestimmen, unsere eigenen Interessen in den Schatten zu stellen und dabei zugleich Antworten auf konkrete soziale Situationen zu geben. Damit folgt dieses Buch dem Vorschlag der schwedischen Soziologin Helena Flam, den Einfluss von Emotionen auf die Makropolitik zu untersuchen und »Gefühle zu kartografieren, die soziale Herrschaftsstrukturen und -verhältnisse aufrechterhalten«.17 Die Politik ist mit affektiven Strukturen verwoben, ohne die wir nicht verstehen können, wie fehlgeleitete Ideologien die sozialen Erfahrungen der Akteurinnen durchdringen und ihre Bedeutung prägen. Dies ist das generelle Thema des vorliegenden Buches. Es nimmt Israel als seine Haupt-Fallstudie in der Hoffnung, dass sich seine Befunde entweder verallgemeinern oder zumindest mit denen zu anderen Ländern vergleichen lassen.
16
Gefühlsstrukturen
Raymond Williams, der bedeutende britische Literaturtheoretiker, prägte den Begriff »Gefühlsstrukturen« zur Bezeichnung von Denkweisen, die sich zwischen der Hegemonie der Institutionen, den Reaktionen der Bevölkerung auf die offiziellen Regelungen und den literarischen Texten herausbilden, in denen diese Reaktionen zum Ausdruck kommen.18 Das Konzept der Gefühlsstruktur verweist auf eine rudimentäre, noch unausgereifte Erfahrung, etwas, das wir heute vielleicht als Affekt bezeichnen würden und das sich unterhalb der Ebene kohärenter Bedeutungen abspielt. Es handelt sich um eine geteilte Weise des Denkens und Fühlens, die die Kultur und Lebensform einer bestimmten Gruppe beeinflusst und von ihr beeinflusst wird.19 Dabei deutet der Begriff der Struktur darauf hin, dass dieser Erfahrungsebene Muster zugrunde liegen, dass sie also eine Systematik aufweist. Solche Strukturen können eine wichtige Rolle bei der Herausbildung von individuellen und Gruppenidentitäten spielen.20 Auch die Politik prägt derartige Gefühlsstrukturen und wird durch sie geprägt,21 und sei es in der Form von Angst, Ressentiment, Abscheu oder Nationalstolz, wie sie in diesem Buch untersucht werden. Politische Akteure sind in einer besonders starken Position, um Narrative in Umlauf zu bringen, die sozialen Erfahrungen emotionale Bedeutungen beilegen.22 Sie sprechen die Wählerschaft unmittelbar mit Erzählungen an, die sie mithilfe von Beratern, Expertinnen und PR-Fachleuten austüfteln. Diese von politischen und medialen Eliten gestalteten Erzählungen können mit dem emotionalen Habitus in Einklang stehen, den jede Person in ihrer Sozialisation entwickelt (wie sich etwa Wut oder Empörung über eine wahrgenommene Ungerechtigkeit oder die Geringschätzung »nie17derer« sozialer Gruppen üblicherweise in der Familie herausbilden23). Sie können aber auch gesellschaftlichen Erfahrungen Bedeutung verleihen, noch während diese gemacht werden, beispielsweise dem Erleben von Abwärtsmobilität. Emotionen können materielle sozioökonomische Interessen stützen, mitunter müssen diese aber auch unter dem Ansturm von Gefühlen zurückstehen24 oder können sogar in Widerspruch zu ihnen geraten. Dies geschieht etwa, wenn Angehörige der arbeitenden Klassen für Politiker stimmen, die die Steuern für die Reichen senken, die Gewerkschaften schwächen, das Arbeitsrecht deregulieren und Sozialleistungen abbauen. Emotionen nehmen entscheidenden Einfluss auf das Abstimmungsverhalten und andere politische Entscheidungen der Bürgerinnen und Bürger.25
Emotionen können sich in Affekte, also weniger bewusste Arten des Fühlens, verwandeln. Solche Affekte gründen nicht nur in der eigenen sozialen Position oder Erfahrung. Sie durchdringen auch Räume, Bilder und Geschichten, die im sozialen Verbund zirkulieren, und schaffen dabei öffentliche Atmosphären, auf die wir unterhalb und jenseits unserer Selbstwahrnehmung reagieren.26 Wir reagieren auf sie, indem wir die zentralen emotionalen Assoziationen in uns aufnehmen, die Worte, Ereignisse, Geschichten oder Symbole erzeugen. Der Affekt bewegt sich auf einer nicht- oder vor-kognitiven Ebene der Erfahrung. Er ist sozusagen in öffentlichen und kollektiven Objekten oder Ereignissen wie Ansprachen, Nationalfeiertagen, Militärparaden, staatlichen Symbolen und Politiken »eingelagert«.27 Dieses symbolische und emotionale Material ist gleichermaßen der Effekt bewusster Manipulation durch mächtige politische Akteure und eine Art von roher Energie, die durch soziale Medien, zwischenmenschliche Interaktionen und nichtstaatliche Organisationen in der Zivilgesellschaft zirkuliert.28 Solche Emo18tionen verfügen über eine bestimmte »Klebrigkeit« (stickiness), wenn sie mit Geschichten verbunden werden, die uns im sozialen Raum Orientierung verleihen und unsere soziale Identität sowie unser Verständnis der Welt prägen. Aus dieser Perspektive beeinflussen Emotionen folglich unser Gespür für die Themen, die wirklich wichtig sind, manchmal unterschwellig, oder sie tun dies ersichtlich, wenn sie von Akteuren im politischen Feld manipuliert werden. Sie sind weder völlig rational (da sie oft das Eigeninteresse vernachlässigen und die wahren Ursachen von Ereignissen ignorieren) noch irrational (da sie die eigene Position in der sozialen Welt zum Ausdruck bringen).29 Weil Gefühle eudämonistisch sind – das heißt die Wahrnehmung des eigenen Wohlbefindens in einer gegebenen Situation ausdrücken –, fügen sie sich nicht nahtlos in die Rational/irrational-Unterscheidung. In der folgenden Analyse werden Gefühle somit als Reaktionen auf soziale Bedingungen verstanden, Reaktionen, die durch kollektive Narrative geformt werden, wobei diese Narrative gezielt Ursachen und Wirkungen in einer bestimmten Weise miteinander verbinden, Schuldzuweisungen vornehmen und Lösungen für Notlagen anbieten. Wie Arlie Russell Hochschild in ihrer bemerkenswerten Untersuchung über die Trump-Wählerschaft in Louisiana nachgezeichnet hat, sind Gefühle in »Tiefengeschichten« eingelassen, die nicht notwendigerweise wahr sind oder sich auf Tatsachen stützen, die sich aber wahr anfühlen müssen.30 Dass Gefühle unsere politischen Orientierungen anleiten, gilt für das gesamte politische Spektrum, doch bei manchen führenden Politikern, manchen Ideologien und unter manchen historischen Umständen trifft diese Tatsache in besonderem Maße zu – wie im Fall des gegenwärtigen Populismus. So mag das Übergewicht emotionaler Orientierungen der Grund dafür sein, warum sich an Trumps Popularität im Lauf der Jahre 19kaum etwas geändert hat, ganz gleich, in welche Skandale er verwickelt war.31
Man kann Gefühlsstrukturen eine doppelte Eigenschaft zusprechen: Eine Gefühlsstruktur kann auf eine soziale Erfahrung verweisen, die von den Angehörigen einer sozialen Gruppe geteilt und im Lauf der Zeit gesammelt wird; sie kann dabei, muss aber nicht explizit benannt werden, und sie kann, muss aber nicht Teil des politischen Diskurses werden.32 So beneideten die nicht jüdischen Österreicher beispielsweise an der Wende zum 20. Jahrhundert die Juden, die überproportional häufig in Berufen wie Medizin, Recht und Journalismus vertreten waren.33 Dieser Neid bildete wahrscheinlich ein wichtiges Element in dem aggressiven ideologischen Antisemitismus, der zum Nazismus führte, doch wurde diese affektive Erfahrung, obwohl sie in der außergewöhnlichen sozialen Mobilität der Juden gründete, nicht explizit bei ihrem Namen genannt: Sozialneid. Sie nahm vielmehr den Umweg einer Dämonisierung der Juden in Schmähschriften, Zeitungsartikeln, Karikaturen, Gerüchten und pseudowissenschaftlichen Theorien. Sie bildete ein Meinungsklima und eine öffentliche Atmosphäre.
Die andere Dimension der Gefühlsstruktur betrifft den öffentlichen Charakter der Politik und politischer Maßnahmen sowie ihr Vermögen, die Affekte ihrer Adressatinnen zu prägen. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit von Führungspersönlichkeiten, öffentlichen Medien, staatlichen Stellen, offiziellen politischen Akteuren und Parteivorsitzenden, Emotionen oder affektive Atmosphären mehr oder weniger bewusst und mehr oder weniger manipulativ zu gestalten, indem sie (vergangene, gegenwärtige oder künftige) Ereignisse mit bestimmten Etiketten und Interpretationsrahmen versehen. Führende Politiker berufen sich oft auf ihre eigenen Gefühle, um dieselben Gefühle bei ihrer Wählerschaft auszulösen und so20mit deren Identifikation zu bewirken. Wie Walter Lippmann 1927 in The Phantom Public schrieb:
Da die allgemeinen Meinungen einer großen Zahl von Personen mit ziemlicher Sicherheit ein vages und verwirrendes Sammelsurium bilden, kann erst dann gehandelt werden, wenn diese Meinungen heruntergebrochen, kanalisiert, komprimiert und vereinheitlicht worden sind. Die Bildung eines Gemeinwillens aus der Vielzahl allgemeiner Wünsche ist kein hegelsches Mysterium, wie so viele Sozialphilosophen geglaubt haben, sondern eine Kunst, auf die sich Führer, Politiker und Lenkungsausschüsse sehr gut verstehen. Sie besteht hauptsächlich aus der Verwendung von Symbolen, die Gefühle bündeln, nachdem sie von ihren gedanklichen Gehalten losgelöst worden sind.34
Diese beiden Arten von Interpretationsrahmen – der aus der sozialen Erfahrung abgeleitete und der gezielt konstruierte – sind manchmal auf komplexe Weise miteinander verflochten und spiegeln die kognitiven und affektiven Bedeutungen wider, mit denen Bürgerinnen und Wähler ihre soziale Welt interpretieren. Der Prozess des Bündelns von Symbolen, aus denen gewissermaßen ihre affektive Bedeutung herausgezogen wird, ist der Schlüssel zum Verständnis der Art und Weise, wie sich Emotionen und Affekte, sobald sie in öffentliche Sprache und Bilder überführt sind, mit fehlgeleiteten Ideologien verbinden. Politische Gefühlsstrukturen bestehen aus der erfolgreichen Verbindung zwischen beiden Ebenen, der geteilten sozialen Erfahrung und der von Elitegruppen (Politikerinnen und Politikern, Medienleuten, Lobbyisten) bewusst manipulierten. Natürlich kann eine soziale Erfahrung die eines allgemeinen und vagen Unbehagens sein. Um politische Relevanz und Wirksamkeit zu erlangen, muss sie auf einen Bedeutungsrahmen bezogen werden, der das Unbehagen in eine bestimmte Reihe von Vorstellungen und Gefühlen codiert. Der Populismus ist eine – oft erfolgreiche – Strategie, Unbehagen zu codieren oder eine soziale Erfahrung umzucodieren.
21Das vorliegende Buch entfaltet die These, dass die populistische Politik in Israel drei einflussreiche soziale Erfahrungen umcodiert hat. Da sind zunächst die verschiedenen kollektiven Traumata, die die Jüdinnen und Juden während ihrer gesamten Geschichte erlebt haben, einschließlich der Geburt des Staates Israel und der damit verbundenen Kriege gegen die britische Kolonialmacht und die arabischen Nachbarstaaten. Diese Traumata wurden in eine allgemeine Angst vor dem Feind übersetzt. Die zweite wirkmächtige soziale Erfahrung ist die israelische Landnahme, die seit 1967 zunehmend zum Gegenstand intensiver ideologischer Kämpfe um den Charakter des israelischen Nationalismus geworden ist, wobei die entsprechenden Gebiete längst auch eine wirtschaftliche Ressource darstellen.35 Die Besatzung bringt emotionale Praktiken der Spaltung, ja sogar des Abscheus zwischen verschiedenen Gruppen in der israelischen Gesellschaft hervor. Die dritte soziale Erfahrung, von der das mächtige Gefühl des Ressentiments zehrt, ist die lang anhaltende Diskriminierung und Ausgrenzung der Mizrachim, also jener Jüdinnen und Juden, die oder deren Vorfahren aus arabischen Ländern stammen. Dieses Ressentiment wiederum bewirkte eine radikale Veränderung der politischen Landschaft Israels, die sich weit nach rechts verschoben hat. Diese drei sogenannten negativen Emotionen (Angst, Abscheu und Ressentiment) sind alle in der Liebe zur Nation und/oder zum jüdischen Volk aufgehoben. Sobald diese Gefühle in der Öffentlichkeit mobilisiert werden, verbinden sie sich mit einem Überschuss imaginärer Affekte, wie ich das nennen möchte: Gefühle speisen sich aus sozialen Erfahrungen ebenso sehr wie aus der Beschwörung imaginierter Drehbücher, die beispielsweise vom »Feind« handeln oder vom »wahren Volk« und ihrerseits starke affektive Orientierungen nach sich ziehen. Der öffentliche Gebrauch von Gefühlen lädt uns somit 22ein zu analysieren, wie konkrete soziale Erfahrungen in öffentlichen Narrativen, die einen Überschuss imaginärer Affekte produzieren, gerahmt und (um)codiert werden, denn Gefühle reagieren gleichermaßen auf die Wirklichkeit wie auf Gegenstände der Imagination.
Gefühle, Charakter und Politik
Dieses Buch charakterisiert den Populismus in Israel als eine Politik, die vier bestimmte Emotionen – Angst, Abscheu, Ressentiment und Liebe – vermengt und zu prägenden Vektoren des politischen Prozesses macht. Es nimmt sich Israel als Fallstudie vor, weil das Land trotz seiner höchst einzigartigen Probleme und Geografie als paradigmatisch für den inzwischen weltweit verbreiteten nationalistischen und populistischen Politikstil betrachtet werden kann. Zweifellos ist Israel als ein jüdischer Staat, der in eine überwiegend arabische Region eingezwängt ist und über eine bedeutende arabische Minderheit verfügt, in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall. Nicht zuletzt schafft diese Konstellation einen Nährboden für militärische Konflikte, wie es sie in vielen anderen Ländern, in denen der Populismus zu einer dominanten Stimme geworden ist, nicht oder nur in viel geringerem Maße gibt. Doch genau das macht Israel auch zu einem Paradebeispiel für die Entwicklung populistischer Bewegungen, ist doch der Populismus in den Worten des israelischen Politikwissenschaftlers Dani Filc ein »politisches Projekt, das durch eine Reihe gemeinsamer ideologischer Prämissen gestützt wird, wie sie in Gesellschaften auftauchen, in denen Konflikte um die Einbeziehung oder Ausgrenzung unterge23ordneter Gruppen herrschen«.36 Selbstverständlich wollen die folgenden Seiten nicht besagen, dass Israel in seiner Hinwendung zum Populismus schlimmer sei als andere Demokratien. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Angesichts der beträchtlichen Menge äußerer Konflikte und innerer Spannungen, die diese junge Demokratie erlebt hat, haben sich ihre Institutionen verblüffend lang als erstaunlich und außergewöhnlich stabil erwiesen (wobei sie nun unter dem Angriff der populistischen und messianischen Rechten zusammenbrechen könnten). Vor allem im Vergleich zu Ländern wie Polen, Ungarn, den Vereinigten Staaten oder Brasilien, die keine Feinde an ihren Grenzen haben (und von denen die ersten beiden sogar relativ homogen sind), kann man nur beeindruckt von der Tatsache sein, dass sich Israel nicht in eine kraftstrotzende Militärdemokratur verwandelt hat. Nichtsdestotrotz war Benjamin Netanjahu einer der ersten Politiker, die auf einen populistischen Regierungsstil setzten. Die Entscheidung für Israel als Fallstudie ist umso gerechtfertigter, als Netanjahu diplomatische, politische und persönliche freundschaftliche Beziehungen zu vielen antidemokratischen Staatsführern wie dem ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, Jair Bolsonaro, Trump, Wladimir Putin, Narendra Modi und Viktor Orbán geknüpft hat.37 Diese Charaktere teilen einen bestimmten politischen Stil und gemeinsame Interessen:38 Sie sind extrem maskulin (von Netanjahu ist nie eine feministische Initiative bekannt oder sichtbar geworden, und das in einer Zeit, in der sich alle führenden sozialdemokratischen Politiker diesem Thema verpflichtet fühlen); sie greifen den Rechtsstaat und etablierte demokratische Institutionen an; sie schüren Verschwörungstheorien über einen »tiefen Staat« (der genau der Staat ist, den sie repräsentieren sollen); sie spielen gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aus; sie identifizieren Feinde, die (angeb24lich) den Staat oder die Integrität der Mehrheitsgesellschaft bedrohen; und, was am wichtigsten ist, sie behaupten, das Volk gegen die Eliten zu vertreten, ein Punkt, der in der wachsenden Literatur zum Populismus oft festgestellt worden ist. Auch wenn diese Politiker die Parteien, die sie angeblich repräsentieren, in vielen Fällen kontrollieren und sich völlig unterwerfen, wird ihre ideologische Plattform von einem Parteiapparat getragen. Sie alle misstrauen dem Völkerrecht und internationalen Organisationen, nicht wenige verabscheuen die EU, und einer wie der andere hätte gerne eine freiere Hand, um sein Land ohne ein starkes Parlament oder Justizsystem zu regieren.
Die heutige israelische Partei Likud (Zusammenschluss) wird immer wieder als eine extreme Version ihrer Vorgängerin, der von Menachem Begin geführten Cherut-Partet, bezeichnet. Doch vergessen wir dabei, dass die Cherut zumindest anfangs als Terrororganisation betrachtet wurde, die außerhalb des zionistischen Konsenses stand. Am 4. Dezember 1948 veröffentlichte eine Gruppe amerikanischer Intellektueller anlässlich von Begins Staatsbesuch in den USA ein vernichtendes Urteil über seine Partei. Darin hieß es unter anderem:
Zu den beunruhigendsten politischen Phänomenen unserer Zeit im neugegründeten Staat Israel gehört die Entstehung der »Freiheitspartei« (Tnu'at haCherut), einer politischen Partei, die in Organisation, Methoden, politischer Philosophie und gesellschaftlicher Anziehungskraft Nazi- und faschistischen Parteien sehr nahekommt. Sie wurde aus Mitgliedern und Anhängern der ehemaligen Irgun Zwai Leumi [IZL] gebildet, einer terroristischen, rechten, chauvinistischen Organisation in Palästina. […] Der Vorfall von Deir Yasin veranschaulicht den Charakter und die Vorgehensweise der Freiheitspartei.
In der jüdischen Gemeinschaft hat sie eine Beimischung von Ultranationalismus, religiöser Mystik und rassischer Überlegenheit gepredigt. Wie andere faschistische Parteien hat sie sich als Streikbrecher betätigt und auf die Zerstörung freier Gewerkschaften hingear25beitet. Stattdessen hat sie Standesverbände nach dem Vorbild des italienischen Faschismus angeregt.
Während der letzten Jahre sporadischer Gewalt gegen die Briten haben die IZL und die Stern-Gruppen in der jüdischen Gemeinschaft in Palästina ein Terrorregime errichtet. Lehrer wurden verprügelt, wenn sie sich gegen sie äußerten, Erwachsene wurden erschossen, wenn sie ihren Kindern verboten, sich ihnen anzuschließen. Mit ihren Gangstermethoden, Prügelattacken, eingeworfenen Scheiben und weitverbreiteten Raubüberfällen haben die Terroristen die Bevölkerung eingeschüchtert und ihr einen schweren Tribut abverlangt.
Die Mitglieder der Freiheitspartei haben keinen Anteil an den konstruktiven Errungenschaften in Palästina gehabt. Sie haben kein Land wiedergewonnen, keine Siedlungen gebaut und lediglich die jüdischen Verteidigungsmaßnahmen beeinträchtigt.39
Unterzeichnet war dieser Brief von Geistesgrößen wie Albert Einstein, Hannah Arendt und Sidney Hook. In den Augen dieser liberalen Juden und Jüdinnen war die Cherut eine gefährliche rechtsradikale Partei. Sie wollte weiteres Land annektieren, verweigerte die Anerkennung der Souveränität Jordaniens und war gegen einen Frieden mit den Arabern. Begin wurde von Ben-Gurion (was diesem selbst nicht unbedingt zur Ehre gereicht) sogar mit Hitler verglichen. Als er sich unter dem Eindruck des Sechstageskriegs einer Regierung der nationalen Einheit anschloss, leitete er damit den Prozess der Legitimierung der Rechten ein, die sich zu einer moderateren Version ihrer selbst entwickelte. Netanjahu trat ein zweideutiges Erbe an, als er den Vorsitz der Likud übernahm, die 1973 gegründet worden und seinerzeit in vielen Aspekten eine moderate Partei war, vergleichbar der gemäßigten Rechten in ihren europäischen oder nordamerikanischen Varianten. In den neunziger Jahren gelang es ihr, die Mittelschicht hinter sich zu versammeln und zur Partei der Liberalen zu werden, die freie Märkte sowie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte verteidigte. Netanjahu verwandelte diese Partei unumkehrbar in eine populistische und 26führte sie in vielerlei Hinsicht zur früheren radikalen Ideologie ihres Vorläufers zurück, wenn auch auf einem anderen Weg.
Es gibt noch einige weitere Gründe, warum sich Israel als Fallstudie anbietet, um die populistische Politik zu verstehen. Zum einen, wie Yonatan Levi und Shai Agmon erläutern,
aufgrund der Langlebigkeit seines populistischen Regimes. […] Israel hat in den vergangenen zehn Jahren populistische Regierungen gehabt. […] Es ist deshalb ein lehrreiches Beispiel dafür, wie ein volles Jahrzehnt ununterbrochener populistischer Herrschaft aussieht.40
Den beiden Politologen zufolge sind demnach die entscheidenden Merkmale des Populismus – von der Delegitimierung der Presse und der Gerichte bis zur Politisierung der staatlichen Bürokratie – seit mindestens einem Jahrzehnt Teil der israelischen Politik.41 Hinzu kommt:
Israel spielt eine zentrale Rolle in der neuen populistischen Achse auf internationaler Bühne – wie seine immer engeren Beziehungen zu Brasilien und Indien zeigen, aber auch die Einladung an Israel, sich der Visegrád-Gruppe anzuschließen, einem Bündnis mitteleuropäischer Länder, die von rechten Populisten regiert werden.42
Ich möchte einen weiteren wichtigen Grund hinzufügen: Netanjahu hat neoliberale Maßnahmen umgesetzt und kann sich trotzdem der konstanten Unterstützung einer Vielzahl benachteiligter sozialer Gruppen erfreuen.43 Insofern steht er exemplarisch für das Rätsel, das die populistische Politik insgesamt kennzeichnet: Es ist eine Politik, die ungerührt Steuersenkungen für Reiche, eine Verschlankung des öffentlichen Sektors sowie eine Verschärfung von Ungleichheiten betreibt und die dennoch von genau denen unterstützt wird, die unter einer solchen Politik am meisten zu leiden haben. So stiegen etwa die Immobilienpreise in Israel zwischen 272011 und 2021 um sage und schreibe 345,7 Prozent und damit stärker als irgendwo sonst auf der Welt. Im selben Zeitraum legten die israelischen Gehälter um 17,5 Prozent zu.44 Eine solche Entwicklung kann klarerweise nur den obersten Rängen der Gesellschaft nützen, während es für Bürgerinnen und Bürger mit geringerem sozioökonomischem Status praktisch unmöglich wird, bezahlbare Wohnungen zu finden. Trotzdem rekrutiert die Likud ihre Anhänger überwiegend abseits der gesellschaftlichen Eliten. Wie schon oft und von einem breiten Spektrum an Kommentatoren sowie Gelehrten festgestellt wurde, zeigt diese Tatsache deutlich, dass der Populismus ausgesprochen attraktiv sein kann, obwohl er den wirtschaftlichen Interessen seiner Anhängerinnen und Anhänger schadet.45 Und sie zeigt zugleich, dass der Populismus vor allem eine Form der Identitätspolitik ist: Er zielt darauf ab, die Identität einer gesellschaftlichen Mehrheit zu stärken, (reale oder imaginierte) symbolische Verletzungen zu heilen und verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen.
Dani Filc beschreibt drei Dimensionen der von ihm als Post-Populismus bezeichneten Politik Netanjahus: eine materielle in Form des ökonomischen Neoliberalismus, eine politische in Form des Autoritarismus und eine symbolische in Form des konservativen Nationalismus.46 Die drei Dimensionen von Netanjahus (Post-)Populismus verbinden sich zu einem nahtlosen Ganzen, in dessen Zentrum ein emotionaler Stil steht, der den Bürgerinnen Überzeugungen und Geschichten einprägt, die besonders gut haften bleiben. Sie überzeugen eine Vielzahl von Israelis, weil sie sich vor dem Hintergrund der realen sozialen Bedingungen und kulturell mächtiger Symbole und Bedeutungen als plausibel erweisen. Die Argumentation der folgenden Kapitel nimmt Filcs Triptychon zum Ausgangspunkt. Ich möchte das Phänomen Po28pulismus weniger erklären als vielmehr durch das Prisma der Emotionen beschreiben. Dabei werde ich darlegen, dass Autoritarismus und konservativer Nationalismus auf vier Emotionen beruhen: Der Autoritarismus legitimiert sich durch Angst, während der konservative Nationalismus (ein Verständnis der Nation, das auf der Tradition und der Ablehnung des Fremden beruht) von Abscheu, Ressentiment und einer sorgsam kultivierten Liebe zum Land lebt. Diese vier zentralen Gefühle sollen im Folgenden untersucht werden, da ihre Verflechtung entscheidend für das Verständnis der Wende zur populistischen Politik ist. Die Betonung dieser Gefühle schließt die Bedeutung anderer Emotionen nicht aus, mit denen sie ja eng benachbart sind – so ist Ressentiment eng mit Wut verbunden und Abscheu mit Hass. Doch zumindest im israelischen Fall scheinen die genannten vier Gefühle am genauesten die Affektstruktur des Populismus zu erfassen, der sich zwar je nach nationalem Kontext als vielgestaltiges Phänomen erweist, aber dennoch einen identifizierbaren ideologischen Kern hat; das so entwickelte Analyseraster kann und sollte für andere Länder entsprechend deren Besonderheiten modifiziert werden. Zweifellos können dieselben Gefühle auch im linken Populismus eine Rolle spielen, wenngleich sie sich dort mit anderen Inhalten verbinden, doch möchte ich mich hier mit dem rechten Populismus befassen, weil sich diese Form in der israelischen Politik durchgesetzt hat und weil sie in der Welt viel weiter verbreitet ist. Die Kombination dieser vier Gefühle und ihre unablässige Präsenz auf der politischen Bühne könnte für die populistische Politik bezeichnend sein. Diese Vermutung deckt sich mit Befunden wie denen von Mikko Salmela und Christian von Scheve, die den Aufstieg des rechten Populismus einer Verbindung mehrerer zusammenwirkender Emotionen zuschreiben; in ihrem Fall sind es Ressentiment, Angst, 29Scham und Wut.47 Deshalb sollten Angst, Abscheu, Ressentiment und Liebe zur Nation als ein kompaktes Bündel verstanden werden, auch wenn jedem dieser Gefühle ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Im realen sozialen Leben sind sie eng miteinander verwoben und bilden womöglich ein einziges Narrativ, das aus vielen Erzählsträngen besteht.
* * *
In seiner Politik fragte sich Aristoteles bekanntlich, »ob man die Tugend des guten Mannes und des rechtschaffenen Bürgers als ein und dieselbe ansetzen soll oder nicht«.48 Insofern Tugend gewisse emotionale Dispositionen voraussetzt (und wir uns beispielsweise Neid nicht als Charakterzug einer tugendhaften Person vorstellen können), ist dies zugleich eine Einladung, über die Emotionen zu reflektieren, die in einer guten Gesellschaft kultiviert oder gerade nicht kultiviert werden sollten. Genauer gesagt regt uns Aristoteles zu der Frage an, wie bestimmte Emotionen jenseits der simplen Beschwörung von Gefühlen in der Rhetorik gewisser Führungsfiguren den Denkhorizont einer Bürgerschaft verändern können. Obwohl Aristoteles kein uneingeschränkter Befürworter der Demokratie war (er bevorzugte eine Mischform mit demokratischen und oligarchischen Elementen), können wir seinem Beispiel folgen und erkennen, wie eine bestimmte Reihe emotionaler Dispositionen, die von populistischen Führern kultiviert werden, den Wurm in der Demokratie nährt. Martha Nussbaum hat in ihrem Opus magnum Politische Emotionen mit einer solchen Analyse begonnen und gefragt, welche Emotionen in liberalen Demokratien gefördert werden sollten und welchen man entgegentreten sollte (als Beispiel für Letztere nennt sie Abscheu, als Beispiel für Erstere Liebe und Mitgefühl).49 Das vorliegende Buch verfolgt diese Analyse 30weiter, indem es Emotionen als integralen Bestandteil dessen betrachtet, was Pierre Bourdieu als Habitus bezeichnete, jene Reihe von Dispositionen, die eine Matrix des Denkens und Handelns strukturieren.50