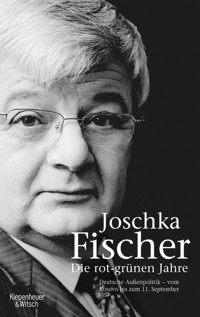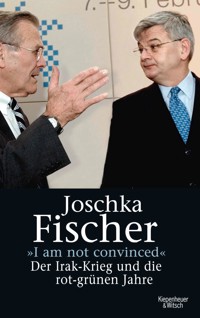9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zeitenwende – was folgt auf das »Jahrhundert des Westens«? »Der Abstieg des Westens«, das neue Buch des ehemalige Außenminister Joschka Fischer, ist eine schonungslose Analyse über das Ende der Dominanz des Westens und den Beginn einer neuen Weltordnung. Wir alle haben in den letzten Jahren die dramatischen Brüche in der internationalen Politik erlebt, die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, den Brexit und den Auftstieg nationalistischer, autoritärer und fremdenfeindlicher Parteien und Politiker in Europa. Joschka Fischer untersucht in seiner Studie die dahinterliegenden geopolitischen Verschiebungen, das Ende des »Jahrhunderts des Westens«, den unaufhaltsamen Aufstieg Chinas zur neuen Weltmacht und die dramatischen Erschütterungen, in denen sich die neue Epoche der Weltgeschichte Bahn bricht.Dabei blickt Joschka Fischer auf die gefährlichen Prozesse der Selbstdemontage, die die westliche Welt durchlebt, und die Bedrohungen für den Frieden, die Nationalismus und Isolationismus auch für Europa bedeuten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Joschka Fischer
Der Abstieg des Westens
Europa in der neuen Weltordnung des 21. Jahrhunderts
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joschka Fischer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joschka Fischer
Joschka Fischer, geboren 1948 in Gerabronn.
Von 1994 bis 2006 Mitglied des Bundestages, von 1998 bis 2005 Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. 2006/07 Gastprofessor an der Universität Princeton, USA. Joschka Fischer lebt in Berlin.
Im Verlag Kiepenheuer & Witsch sind bisher erschienen
»Risiko Deutschland«, 1994, »Für einen neuen Gesellschaftsvertrag«, 1998, »Die Rückkehr der Geschichte. USA, Europa und die Welt nach dem 11. September«, 2005, »Die rot-grünen Jahre. Deusche Außenpolitik – vom Kosovo bis zum 11. September«, 2009, »I am not convinced«, 2011, »Scheitert Europa?«, 2014
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wir alle haben in den letzten Jahren die dramatischen Brüche in der internationalen Politik erlebt, die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, den Brexit und den Aufstieg nationalistischer, autoritärer und fremdenfeindlicher Parteien und Politiker in Europa.
Joschka Fischer untersucht in seiner Studie die dahinterliegenden geopolitischen Verschiebungen, das Ende des »Jahrhunderts des Westens«, den unaufhaltsamen Aufstieg Chinas zur neuen Weltmacht und die dramatischen Erschütterungen, in denen sich die neue Epoche der Weltgeschichte Bahn bricht. Dabei blickt Joschka Fischer auf die gefährlichen Prozesse der Selbstdemontage, die die westliche Welt durchlebt, und die Bedrohungen für den Frieden, die Nationalismus und Isolationismus auch für Europa bedeuten.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2018, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Urban Zintel
ISBN978-3-462-31834-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort – Von der Ordnung der Staatenwelt
Das Jahr der großen Veränderung
Im Übergang – zwischen der Welt von gestern und der Welt von morgen
Eine neue Dimension im globalen Staatensystem – Staatenwelt und Menschheitsfragen
Wachablösung oder Duopol? Die USA und China
Europa im 21. Jahrhundert – Erneuerung oder Selbstaufgabe
Die Krise der liberalen westlichen Demokratie
Deutschland – das Land in der Mitte Europas
Donald Trump und die europäische Reifeprüfung
Vorwort – Von der Ordnung der Staatenwelt
Die Geschichte als der niemals abreißende Strom der Zeit wird von innen heraus in der Regel als eine Kontinuität von Alltagserfahrungen erlebt – gerade eben noch war sie Gegenwart und schon ist diese zur Vergangenheit, zur Geschichte geworden. Sowenig man in der Regel beim Gebrauch seiner Muttersprache groß über diese oder gar über ihre grammatikalische Ordnung nachdenkt, so wenig geschieht dies im Alltag der Politik oder gar in der Außenpolitik. Dabei gilt für diese, was auch für die Sprache gilt: So wie der Gebrauch der Wörter und der Satzbau den Regeln einer Ordnung folgen, einer Grammatik, so gilt dies auch für die Politik und ganz besonders für den Umgang und das Verhältnis der Staaten zu- und untereinander. Und genauso wenig, wie Sprachen statische Konstrukte sind, sondern ganz im Gegenteil hochdynamisch der permanenten Veränderung und Anpassung unterworfen sind, genau so gilt dies auch für die internationalen Ordnungssysteme, für die Ordnung der Staaten.
Solche Systeme und ihre Ordnungen sind ein entscheidender Faktor für die Gestaltung des Friedens oder Unfriedens zwischen den Staaten. Haben Staaten einander widersprechende Gebietsansprüche und Machtinteressen oder arbeiten sie zusammen, legen sie ihre Konflikte auf dem Verhandlungswege bei oder erheben sie Dominanz- und Herrschaftsansprüche, vertrauen sie auf Gewalt oder Recht, herrscht zwischen ihnen Vertrauen oder Misstrauen, wollen sie erobern oder friedliche Nachbarschaft – all das sind die traditionellen Fragen in der internationalen Ordnung, die über Krieg oder Frieden entscheiden. Und über allem steht die Frage, ob es eine Macht oder einen Staat gibt, der die Vorherrschaft in einem solchen mehrere Staaten und Mächte umfassenden System ausübt. Ein solcher Hegemon gestaltet das System und garantiert dessen Sicherheit und inneren Frieden mit überlegener Gewalt und kultureller Dominanz.
Beginnen sich die Machtgewichte in einer solchen etablierten Ordnung zu verschieben und beginnt das System sich als Ganzes zu verändern, dann spürt man früher oder später die Erschütterungen dieses Vorgangs im Strom der Zeit. Geschichte und ihre Ordnung dringt in den Alltag ein und droht diesen dramatisch zu verändern. Die Frage nach der Ordnung wird virulent. Der Schriftsteller Stefan Zweig, der sich am Ende des Ersten Weltkriegs in der neutralen Schweiz aufhielt, wollte damals zurück in sein besiegtes heimatliches Österreich und erlebte auf dem Grenzbahnhof in Buchs, wie eine jahrhundertealte Ordnung an ihm vorbei in die Vergangenheit fuhr. Es war eine bizarre Szene: »Schon beim Aussteigen hatte ich eine merkwürdige Unruhe bei den Grenzbeamten und Polizisten wahrgenommen. Sie achteten nicht besonders auf uns. … offenbar warteten sie auf Wichtigeres. Endlich kam der Glockenschlag, der das Nahen eines Zuges von der österreichischen Seite ankündigte. … Langsam, ich möchte fast sagen majestätisch rollte der Zug heran, ein Zug besonderer Art … ein Salonzug. Die Lokomotive hielt an. Eine fühlbare Bewegung ging durch die Reihe der Wartenden, ich wusste noch immer nicht warum. Da erkannte ich hinter der Spiegelscheibe des Waggons hoch aufgerichtet Kaiser Karl, den letzten Kaiser von Österreich, und seine schwarzgekleidete Gemahlin, Kaiserin Zita. Ich schrak zusammen: der letzte Kaiser von Österreich, der Erbe der habsburgischen Dynastie, die siebenhundert Jahre das Land regiert, verließ sein Reich!«[1]
Stefan Zweig hat diesen hoch symbolischen Augenblick des Verschwindens einer jahrhundertealten Ordnung – das Ende des dynastischen Europas auf einem Schweizer Grenzbahnhof – literarisch festgehalten. Die Weltgeschichte fuhr damals mit der Eisenbahn, auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. hatte sich mit dem Zug ins holländische Exil davongemacht.
Wenn eine Ordnung der Staaten wankt oder gar durch eine andere abgelöst wird, dann geschieht dies meistens durch eine schwere Krise oder gar im Gefolge einer Zeit des Krieges, wie im Jahre 1918, und es berührt den Alltag von Millionen von Menschen. Plötzlich ist die Frage nach der Ordnung von alltäglichem Interesse, weil sie, jenseits der ruhigen Selbstverständlichkeit in friedlichen Zeiten, umstürzende Konsequenzen für den Alltag hat. Die Menschen in Osteuropa und auch in Ostdeutschland erlebten einen solchen Umsturz ihres Alltags im Gefolge des 9. November 1989, als in der Nacht zum 10. November die Mauer in Berlin gefallen war und eine neue internationale Ordnung jenseits des Kalten Krieges sich abzuzeichnen begann.
Blickt man auf die europäische Geschichte der letzten 200 Jahre zurück, so war die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg an der Oberfläche durch ein hohes Maß an Stabilität und einen lang anhaltenden Frieden bestimmt, unter der Oberfläche aber hatten die Spannungen zwischen den europäischen Großmächten immer mehr zugenommen, bedingt durch die neuen Fähigkeiten und Interessen, welche die Industrialisierung der großen europäischen Staaten mit sich gebracht hatte, auch durch die Ambitionen eines neuen Akteurs im Zentrum Europas, durch Deutschland. Nach einer unruhigen Zwischenkriegszeit kam der noch sehr viel furchtbarere Zweite Weltkrieg, an dessen Ende die alte europäische Staatenordnung definitiv unterging und durch die bipolare Ordnung des Kalten Krieges abgelöst wurde.
Diese wiederum verschwand mit dem Ende der Sowjetunion und wird gerade durch eine neue Weltordnung ersetzt, deren Konturen zwar für uns Zeitgenossen bereits ahnbar sind, aber deren konkrete Form noch im Dunkel der Zukunft liegt.
Der Zeitgeist reagiert auf solche spürbaren Veränderungen mit Nervosität und Ambivalenz. Dem Westen geht es nach wie vor gut, verglichen mit anderen Teilen der Welt. Nur – wird es so bleiben? Aus dieser Ambivalenz zwischen Gegenwart und Zukunft und der Ahnung, dass die neu entstehende Weltordnung des 21. Jahrhunderts zu seinen Lasten gehen wird, entsteht im Westen vielfach das Bedürfnis nach Rückversicherung in einer »besseren« Vergangenheit, die unwiederbringlich dahin ist. Der Boden, auf dem der Westen stand – Eliten wie die Bevölkerungen gleichermaßen –, ist schwankend geworden und die Fragen nach der Zukunft des Westens und Europas, die noch vor wenigen Jahren als absurd erschienen wären, sind heute in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Was also wird diese absehbare Veränderung der globalen Ordnung für den Westen und für dessen ältesten Teil, für Europa, bringen? Wie wird sie aussehen, diese neue Ordnung? Wer werden die Gewinner und wer die Verlierer sein?
Das Jahr der großen Veränderung
Das Jahr, von dem hier die Rede sein soll, begann nicht an einem ersten Januar um Mitternacht, sondern irgendwann in den Morgenstunden eines frühsommerlichen Junimorgens, und es sollte sich im Rückblick als ein Schicksalsjahr zumindest für den Westen erweisen. An jenem Morgen des 24. Juni 2016, als klar wurde, dass bei dem EU-Referendum im Vereinigten Königreich die Austrittsbefürworter zwar eine knappe, gleichwohl aber eindeutige Mehrheit für das Verlassen der Europäischen Union erzielt hatten, begannen die Grundlagen einer Weltordnung, die meine Generation und auch meine Arbeit als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland über sieben Jahre hinweg geprägt hatten, in Bewegung zu geraten. Langsam zuerst und fast unmerklich, zunächst anscheinend auf Europa beschränkt, ging diese Bewegung einher mit der Wiederkehr von Gedanken und Glaubenssätzen einer untergegangen geglaubten Epoche Europas.
Mit der Brexit-Entscheidung wurde eine Entwicklung auch für eine breitere Öffentlichkeit sichtbar, die sich seit Längerem schon in verschiedenen Staaten Europas in Gestalt einer historischen Regression angedeutet hatte, nämlich eine mentale Abkehr von der Gegenwart und einer für die Europäer nur trübe Aussichten versprechenden Zukunft, verpackt in eine aggressive Ablehnung bis hin zur offenen Feindschaft gegenüber dem europäischen Einigungsprozess und eine Rückkehr zur Nation, ja zum Nationalismus, unter dem Banner der nationalen Selbstbestimmung. Es zeigte sich, dass dieser neue Nationalismus keineswegs nur auf Osteuropa beschränkt war, wo er im Widerstand gegen die Sowjetherrschaft eine gleichermaßen revolutionäre wie zentrale Rolle gespielt hatte, sondern er gewann auch unter den alten Mitgliedstaaten in Westeuropa zunehmend an Kraft. In den Niederlanden, Belgien, Frankreich, in Skandinavien, in Österreich, nicht nur in Ungarn und Polen, erhielten nationalistische, offen europafeindliche Parteien bei Wahlen großen Zulauf, und in diesen den gesamten Kontinent betreffenden neonationalistischen Trend platzte nun die britische Entscheidung mit ihrem Ja zum Brexit. Diese warf sofort die Frage auf, welche anderen Mitgliedstaaten den Briten folgen würden und ob die Brexit-Entscheidung am Ende nicht gar der Beginn der Auflösung der EU sein würde.
Damit war zugleich das Thema für das Jahr 2016/17 gesetzt: Hat die EU als transnationales Gebilde überhaupt noch eine Zukunft? Oder ist die Idee eines vereinigten Europas gemeinsam mit dem Kalten Krieg im Orkus der Geschichte verschwunden? Wird das Jahr 2016/17 den Anfang vom Ende der EU markieren? Wohin waren all der Optimismus, all die Aufbruchsstimmung der Jahre zwischen dem Fall der Mauer in Berlin und der großen EU-Osterweiterung verschwunden? Das Jahr war mit dem Brexit und seinen möglichen Folgen für Europa aber noch keineswegs zu Ende, es sollte noch schlimmer kommen.
Für die EU, und dies wird sich mehr noch für Großbritannien erweisen, war diese Brexit-Entscheidung ein heftiger Schlag. Auf dem Hintergrund der britischen Geschichte ist das Rätsel dieses Vorgangs weniger die Brexit-Entscheidung als solche als vielmehr die Frage: Warum jetzt? Vier Jahrzehnte nach dem Ende des Empires und dem EU-Beitritt des Landes. Warum erlebt das Vereinigte Königreich, das Mutterland des politischen Pragmatismus, erst jetzt, in unseren Tagen, diese völlig unerwartete Transformation vom Realismus hin zur Fantasie, ja Halluzination unter Führung des englischen Nationalismus?
Für die EU bedeutet der Brexit, dass zum ersten Mal (wenn man von dem Austritt des eher randständigen Grönlands in den 80er-Jahren einmal absieht) die Europäische Union nicht mehr weiterwachsen, sondern schrumpfen wird. 65 Mio. Briten würden fortan nicht mehr der EU und ihrem gemeinsamen Markt angehören. Die nach Deutschland zweitgrößte nationale Volkswirtschaft Europas und gemeinsam mit Frankreich stärkste Militär- und Nuklearmacht, neben Frankreich zudem mit einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten, würde fortan wieder ihre eigenen Wege gehen und sich von jenem Prinzip »Integration«, das die europäische Nachkriegsgeschichte so überaus erfolgreich geprägt und die EU mit ihrem gemeinsamen Markt überhaupt erst möglich gemacht hatte, definitiv verabschieden.
Gewiss, die Briten waren erst 1973 zur EU gestoßen (damals noch EWG) und mental eigentlich nie wirklich ganz dabei. Sie sahen in Europa immer nur eine Art verbesserter Freihandelszone und erhandelten sich im Laufe ihrer Mitgliedschaft zahlreiche Ausnahmeregelungen, mittels derer sie sich eher am Rand des europäischen Spiels aufhielten als in dessen spielgestaltender Mitte, waren dadurch mehr Bremser als Motor des europäischen Einigungsprozesses gewesen, und vielleicht würde es ja sogar ohne diesen Bremser in der Union einfacher vorangehen. In den Fragen aber, in denen das britische nationale Interesse mit den Interessen der EU übereinstimmte, wie in manchen Sicherheits- und Handelsfragen oder bei der Osterweiterung der EU, zeigte sich das ganze positive Gewicht des Vereinigten Königreichs und auch die große Erfahrung der früheren Weltmacht für die EU. In diesen Fällen war der europäische Staatenverbund mit Großbritannien wesentlich stärker als ohne Großbritannien.
Jenseits der Schwächung der EU in den Sektoren Wirtschaft und Sicherheit setzte das Brexit-Referendum unter dem Banner der Wiedergeburt der nationalen Souveränität auch ein nicht zu übersehendes politisch-symbolisches Signal gegen den europäischen Integrationsprozess, und das war alles andere als eine feuilletonistisch anmutende Kleinigkeit. Denn die EU ist keineswegs nur ein gemeinsamer Markt und das Ergebnis eines wohlmeinenden proeuropäischen Idealismus, sondern das Ergebnis brutaler historischer Prozesse auf dem europäischen Kontinent, denen vor allem in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts Millionen von Europäern zum Opfer gefallen sind.
Begriffe und Realitäten wie »Nation«, »Nationalstaat« und »nationale Souveränität« sind alles andere als von der Natur oder Gott oder wem auch immer gegeben und keineswegs schon immer vorhanden gewesen, sondern es sind historische Konstrukte. Als Europa (und ganz besonders das alte deutsche Reich im Dreißigjährigen Krieg) im 16. und 17. Jahrhundert von blutigen Religionskriegen zerrissen und verheert worden war, trat am Ende dieser Katastrophe – als schließlich alle beteiligten inneren wie äußeren Mächte völlig erschöpft waren, keine Seite also mehr die Aussicht auf einen Sieg und Deutschland etwa ein Drittel seiner Bevölkerung verloren hatte – eine Friedenskonferenz in Münster und Osnabrück zusammen, die sich nach langen und zähen Verhandlungen schließlich auf einen Friedensvertrag einigte, den sogenannten »Westfälischen Frieden«, der nicht nur das Grauen in Deutschland beenden, sondern der zugleich auch Europa eine neue politische Ordnung geben sollte.[2] Diese Frage nach der europäischen Ordnung war und ist die entscheidende Frage für einen dauerhaften Frieden bis zum heutigen Tag. Die neue europäische Staatenordnung – nach ihren Entstehungsorten die »westfälische Ordnung« genannt – musste vor allem den hochgefährlichen Sprengsatz der Religion entschärfen (der durch die christliche Glaubensspaltung in der Reformation entstanden war), sie musste im Deutschen Reich einen Modus Vivendi für einen dauerhaften Frieden finden und zugleich die Interessen der beteiligten europäischen Großmächte ausgleichen, was ihr beides über einen beachtlichen Zeitraum hinweg gelang.[3]
Fortan begegneten sich alle Staaten, die in dem von ihnen kontrollierten Territorium als alleinige Souveräne regierten, in diesem neuen europäischen System der Theorie nach als Gleiche, nicht aber der Macht nach. Die Stabilität des Systems, das in den kommenden Jahrhunderten Europa bestimmen sollte, wurde machtpolitisch immer durch ein Gleichgewicht der Mächte garantiert, es wurde aber durch das Streben einer großen europäischen Macht nach der Vorherrschaft über den Kontinent häufig gefährdet und dann mittels zyklisch immer wieder stattfindender Kriege gegen den jeweiligen Hegemon verteidigt.[4]
Spanien/Habsburg, Ludwig XIV., Napoleon, das deutsche Kaiserreich, Hitler – sie alle scheiterten an diesem europäischen Staatensystem und seinen antihegemonialen Reflexen.[5] Das »westfälische System« endete in Europa endgültig erst im 20. Jahrhundert, genauer am 8. Mai 1945, nach zwei großen europäischen Kriegen, die sich zu Weltkriegen ausgedehnt hatten. Was darauf folgte, war die Teilung Europas in Ost und West, die Ordnung des Kalten Krieges, wie sie von den USA und der Sowjetunion – zwei Europa eng verbundenen, gleichwohl nicht europäischen Mächten – mittels ihrer historisch einmaligen Militärmacht garantiert wurde.
Bei der Verhinderung einer dauerhaften kontinentaleuropäischen Hegemonialmacht unterwühlte der europäische Kontinent »seine Herrenstellung indirekt«, wie der Historiker Ludwig Dehio lakonisch feststellte: »Denn der weltmächtige Aufstieg Englands und hinter ihm der Vereinigten Staaten, und auf der anderen Seite der entsprechende Aufstieg Russlands, das war der Preis, den unser Kontinent für die Freiheit seiner einzelnen Souveränitäten und für die Freiheit seines Gleichgewichtssystems im Ganzen zu bezahlen hatte.«[6] Die »westfälische Ordnung« war durch den Zweiten Weltkrieg zu einer globalen, bipolaren Ordnung und der Kampf um die Hegemonie in Europa war zu einem Kampf zweier globaler Systeme geworden und nicht mehr nur auf Europa beschränkt.
Damit aber hatte Europas Staatenwelt ihre Souveränität ganz oder zumindest teilweise an Washington und Moskau verloren. Die EU war und ist bis heute auch der Versuch, eine »postwestfälische« europäische Ordnung zu schaffen, die nun allerdings nicht mehr auf dem Gleichgewicht der Mächte auf dem europäischen Kontinent beruht, sondern den Fallstricken dieses Gleichgewichtssystems und dessen inhärenter Kriegsgefahr zu entkommen versucht. Die neue europäische Staatenordnung sollte aber auch nicht mehr auf der Ordnung der Bipolarität der Supermächte und der Teilung des Kontinents beruhen. Diese neue Ordnung, deren sichtbarer Ausdruck die Europäische Union ist, beruht auf der Integration der europäischen Staatenwelt und ihrer Wirtschaft und begann mit der Versöhnung und engen Zusammenarbeit der beiden traditionellen Erbfeinde Deutschland und Frankreich. Schritt für Schritt und in enger Anlehnung an die USA sollte so wieder eine europäische Souveränität in neuer Form entstehen.
Der Brexit, und darin liegt seine historische Bedeutung, ist nun nichts weniger als eine klare Absage an diesen europäischen Neuordnungsversuch durch eine der beiden Gründungsmächte des Westens, nämlich das Vereinigte Königreich, zugunsten einer Rückkehr zum Europa der Nationalstaaten und des traditionellen Gleichgewichts der Mächte, zum klassischen westfälischen System also. Dabei übersehen die Brexit-Befürworter und ihre Anhänger in den anderen Mitgliedstaaten der EU allerdings eine gleichermaßen banale wie zentrale Tatsache: Europa beherrscht nicht mehr die Welt, selbst die größten europäischen Mächte sind global gesehen machtpolitisch und ökonomisch auf den Rang von regionalen Mittelmächten geschrumpft. Der Kontinent hat seit dem 8. Mai 1945 seine Souveränität an die beiden großen, nicht europäischen Siegermächte in Ost und West verloren. Ein Zurück kann es für Europa und entgegen der Brexit-Illusion nicht mehr geben, da dem eine radikal veränderte Realität entgegensteht und Europa dazu selbst die Macht fehlt: Die Welt des 19. Jahrhunderts, dominiert von den großen europäischen Mächten, ihrem globalen Expansionsstreben und ihren Hegemonialkonflikten, wird im 21. Jahrhundert gewiss nicht wiedererstehen. Ganz andere und sehr viel größere Mächte werden in dieser neuen Welt das Sagen haben, wie es ja bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall war. Das Zentrum dieser neuen Weltordnung wird diesmal in Asien und im Pazifik liegen, nicht mehr in Europa oder im transatlantischen Raum. Daher heißt die tatsächliche Alternative für die Europäer nicht: EU oder Nationalstaat. Sondern: endgültiger Abschied der Europäer von der Weltbühne und dauerhafte Fremdbestimmung in einer mehr als ungewissen Zukunft oder Mut zu einer neuen Ordnung für den alten Kontinent. Diese Alternative wird in den kommenden Jahren ganz praktisch, auch für die »normalen« Bürger, nicht nur für die politischen und wirtschaftlichen Eliten, sichtbar werden.
Doch zurück zum Jahr 2016/17. Erneut sollte sich der Tragödie zweiter Akt in den frühen Morgenstunden ereignen, diesmal aber nicht in Europa, sondern jenseits des Atlantiks, in den USA. Die 58. Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten endete mit einer Sensation: Donald Trump und nicht Hillary Clinton hieß der neue Präsident der Vereinigten Staaten, seit dem 20. Januar 2017 ist er im Amt. Und wie beim Brexit zuvor hatte eine breite Öffentlichkeit, darunter die allermeisten seriösen Medien und professionellen Beobachter, die Wahl Trumps schlicht nicht für möglich gehalten. Zum zweiten Mal war innerhalb weniger Monate eine große politische Illusion geplatzt, im alten transatlantischen Westen schienen bisher für unverrückbar gehaltene Grundlagen weich zu werden und diese historisch einmalig erfolgreiche Ordnung des Westens schien, völlig überraschend, am Beginn ihres Endes angelangt zu sein.
Das letzte Mal war in Europa ein solcher Ordnungsbruch mit dem Ende des Kalten Krieges und der Auflösung des damaligen Ostblocks geschehen. Als Michail Gorbatschow sich in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts daranmachte, die Sowjetunion zu reformieren, die sich allerdings als unreformierbar erweisen und in der Folge dieses Reformversuchs dann auch auflösen sollte, gab es für diesen Versuch durchaus zwingende Gründe. Das sowjetische Imperium konnte ökonomisch nicht mehr aufrechterhalten werden, es war hoffnungslos überdehnt und seine Wirtschaft heillos ineffizient. Die Sowjetunion war schlicht pleite, konnte den Rüstungswettlauf mit den USA nicht mehr weiterführen und ihren Supermachtstatus nicht mehr finanzieren. Aber warum droht jetzt dem Westen mit fast dreißigjähriger Verzögerung ein ähnliches Schicksal, scheinbar ganz ohne Not? Schleichend und nicht so spektakulär wie der Untergang der Sowjetunion? Warum will der Westen partout historischen Selbstmord begehen?
Die von der Wahl Trumps ausgelöste Veränderung sollte an erster Stelle die Rolle der USA als westliche Führungsmacht, als eherner Sicherheitsgarant für ihre Alliierten und als letzte globale Ordnungsmacht infrage stellen.[7] Trump sieht in dieser globalen Rolle der USA und in den damit einhergehenden Beistands- und Bündnisverpflichtungen und Sicherheitsgarantien keinen Gewinn für das Land, sondern er betrachtet die USA als eine wohlmeinende Führungsmacht, die seit vielen Jahrzehnten von perfiden Bündnis- und Handelspartnern zulasten der amerikanischen Arbeiter ausgebeutet wird. Die USA zahlen mit dem Leben ihrer Soldaten für fremde Sicherheitsinteressen und bluten auch massiv ökonomisch aus, während andere Partner (Japan und Deutschland vorneweg) im Schatten der amerikanischen Sicherheitsgarantie und des ebenfalls von den USA garantierten Systems eines freien Welthandels immer reicher und stärker wurden. In Trumps Augen und in denen seiner Wählerschaft war Amerika bestenfalls ein naiver Hegemon, der sich unter der Führung seiner alten Elite über Jahrzehnte hinweg von anderen hatte ausbeuten lassen. Damit gedachte Trump Schluss zu machen.
Die Wahl von Donald Trump war ganz offensichtlich kein Betriebsunfall der amerikanischen Geschichte, vielmehr Ausdruck einer tiefen, lang anhaltenden Entfremdung zwischen der politischen und wirtschaftlichen Elite des Landes und weiten Teilen der weißen Arbeiterklasse, der Mittelschicht und dem tiefen Amerika in der Provinz und den alten Industriegebieten. Vor allem die Finanzkrise von 2008, aber auch der massive Arbeitsplatzexport nach China und Asien über die Jahrzehnte hinweg und die mit der Finanzkrise einhergehende Bankenrettung haben entscheidend zur Delegitimierung der alten Eliten beigetragen. Die Verursacher und Profiteure der Finanzkrise wurden nicht zur Rechenschaft gezogen, während Main Street Wall Street mit Milliarden an Steuergeldern retten durfte!
Donald Trump, was immer man von ihm halten mag, hatte als Einziger in dem weiten Kandidatenfeld der Republikaner und später dann, bei den Präsidentschaftswahlen gegen Hillary Clinton, den politischen Instinkt für die Wut, die sich unter der weißen Wählerschaft in den Weiten der amerikanischen Provinz aufgebaut hatte, machte sich zu deren Sprecher und nutzte sie für seinen überraschenden Wahlsieg. Er war gerade deshalb zum Hoffnungsträger dieser Wählerschicht aufgestiegen und von ihr gewählt worden, weil er das Establishment in den beiden großen Parteien und in den Medien, auch den dazugehörigen imperial-liberalen Konsens der Eliten, wie er sich nach dem Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg entwickelt hatte, radikal infrage stellte und zu beenden versprach.
Trumps Wähler waren der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs anhaltenden globalen Führungsrolle der USA und auch jener mühevollen Balance unter allen Präsidenten zwischen internationalistischen Idealen und den nationalen und imperialen Interessen in der US-Politik müde. Sie waren der Meinung, dass dieser Konsens der imperialen Elite zu ihren Lasten ging, und wollten eine eindeutige Entscheidung zugunsten ihrer Interessen. Amerika sollte auch weiterhin stark sein, stärker als jeder denkbare Rivale, aber eben kein globaler Hegemon mehr, auch nicht mit all den Folgekosten, die eine solche hegemoniale Rolle mit sich brachte. Zumindest war und ist dieser Teil der amerikanischen Wählerschaft nicht mehr bereit, den Preis für die globale Führungsrolle ihres Landes zu zahlen und in den Erhalt des internationalen liberalen Systems, wie es die USA seit 1945 geschaffen hatten, weiterhin zu investieren.
Genau dieses Versprechen bekamen sie von Donald Trump. Er kandidierte mit einem offen nationalistischen Wahlprogramm: »America first!«, ein politischer Slogan, der in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts von amerikanischen Faschisten, radikalen Isolationisten und Sympathisanten Nazi-Deutschlands verwandt wurde. Trump ist gegen das »System« angetreten und hat gegen alle Vorhersagen und gegen das System gewonnen.
Und nichts spricht dafür, dass er mittels eines Kompromisses mit dem System eine Chance auf Erfolg hätte. Ganz im Gegenteil würde dieser Weg für ihn in die sichere Niederlage führen, denn das System wird ihn nicht akzeptieren. Nur wenn er die Unterstützung seiner Wähler in der traditionellen Arbeiterklasse und in der Provinz, vor allem in den Südstaaten der USA, bewahren kann, hat er Aussicht auf Erfolg. Daher spricht wenig bis gar nichts für einen Kompromiss oder gar ein Einlenken seinerseits. Gewiss, Trump wird in der Auseinandersetzung mit dem System und seinen Institutionen zu einer gewissen taktischen Flexibilität gezwungen werden, aber strategisch wird er an seinem nationalistischen Kurs festhalten und so den Charakter des Landes, dessen Außenpolitik und globale Führungsrolle radikal verändern.
Sein zweiter erfolgreicher Slogan lautete: »Make America great again!« Es war das Versprechen, dass es mit ihm ein Zurück in die glücklichen Zeiten amerikanischer Vorherrschaft geben würde, als Amerikas wirtschaftliche Stärke noch auf Kohle, Stahl und Öl gründete, als der amerikanische Arbeiter noch im Zentrum des politischen und öffentlichen Interesses stand und nicht »Identitäten«, nicht ethnische oder sexuelle Minderheiten, als die Geschlechterarbeitsteilung noch klar definiert war, niemand vom Klimawandel sprach und überhaupt die amerikanische Gesellschaftsordnung auf der anerkannten Vorherrschaft der weißen Männer beruhte.
Dass es in der US-Politik radikal nationalistische und isolationistische Strömungen innerhalb wie außerhalb der beiden großen Parteien gab, war nun keineswegs ein neues Phänomen. Bisweilen waren diese Strömungen durchaus erfolgreich und vermochten breite Massen zu mobilisieren, auch an der Wahlurne. Aber noch niemals vor Donald Trump war es einem Kandidaten, der auf einer explizit nationalistischen und isolationistischen Plattform zu den Präsidentschaftswahlen angetreten war, in jüngerer Zeit gelungen, auch das Zentrum der Macht, das Weiße Haus, zu erobern.
Der amerikanische Präsident ist in der Innenpolitik eher schwach, da er dort auf ein fein gesponnenes Netz von »checks and balances« in einem bundesstaatlichen System trifft, welches die Macht des Präsidenten erheblich beschränkt. Ganz anders ist es jedoch in der Außenpolitik. Dort verfügt der US-Präsident über weitgehende Machtbefugnisse, insofern wird der Wahlsieg von Trump vor allem dort seinen Niederschlag finden. Die amerikanische Außenpolitik war, seit dem Eintritt des Landes in den Ersten Weltkrieg im Jahr 1917 unter Präsident Woodrow Wilson, immer in sich widersprüchlich gewesen. Einerseits kämpften die USA für idealistische Ziele wie Freiheit und Demokratie, andererseits waren sie aber immer auch stark ihren Interessen und der Realpolitik verpflichtet und verfolgten höchst eigennützige, ja seit dem Ende des 19. Jahrhunderts auch imperialistische Ziele (Kuba, Philippinen). Mittels dieser ganz spezifischen US-amerikanischen Mischung von Idealismus und Realismus war es den USA gelungen, zu dem mächtigsten Staat der Geschichte aufzusteigen und eine liberale politische und wirtschaftliche Weltordnung zu schaffen, die zumindest im nordatlantischen Raum und in Teilen Ostasiens beispiellosen Wohlstand und Sicherheit über viele Jahrzehnte hinweg garantiert hat.
Wenn sich die USA nun unter Trump ernsthaft daranmachen, sich von ihrer globalen Führungsrolle, deren Mühen und Lasten und ihrer ganz spezifischen strategischen Ambivalenz zwischen Internationalismus und Nationalismus zu verabschieden – zugunsten einer überwiegend auf einen engen Egoismus von sehr kurz gefassten nationalen Interessen basierenden Rolle –, so wird ein solcher Schritt sehr ernste Auswirkungen für die Stabilität des internationalen Systems und für die Zukunft des Westens insgesamt haben. Im Klartext: Sollte die US-Außenpolitik unter Trump zum Risikofaktor werden, dann wird das gesamte System nicht mehr funktionieren. Eine Jahrzehnte währende, erfolgreiche Ordnung würde dadurch ohne wirkliche Not zum Untergang verdammt, denn es ist weit und breit keine andere Macht sichtbar – nicht China, nicht Indien, nicht Europa und nicht Russland –, die in der Lage wäre, gegenwärtig die globale Rolle der USA zu übernehmen und in deren sehr große Schuhe als globale Ordnungsmacht zu schlüpfen. Gewiss, China wird es versuchen, und man wird sehen, ob es im 21. Jahrhundert eine globale Weltordnung zu errichten und zu garantieren vermag.
Die Konsequenz einer solchen Entwicklung für das globale Staatensystem ist daher recht einfach zu benennen: erhöhte Instabilität und Unberechenbarkeit durch ein länger anhaltendes Führungsvakuum. Stabilität und Berechenbarkeit des gesamten Systems werden durch einen solchen Systemwechsel verloren gehen, und das in einer hoch vernetzten Welt mit über 7 Mrd. Menschen und anhaltenden thermonuklearen und global anwachsenden pandemischen Risiken. Hinzu kommen die globalen Herausforderungen, die sich aus einer zunehmend überlasteten Umwelt und der Klimakrise ergeben. Dies ist alles andere als eine beruhigende Aussicht.
Sehr schwerwiegend werden die Folgen der Wahl von Donald Trump für den Westen selbst sein: Denn wenn die westliche Führungsmacht sich aus ihrer Rolle verabschiedet, was sie ganz offensichtlich beabsichtigt, dann wird dieser Westen sehr kurzfristig vor die Existenzfrage gestellt werden.
Was ist unter dem Westen zu verstehen? »Nicht nur Bücher, auch Begriffe haben ihre Schicksale. Der Begriff ›Westen‹, wenn er politisch oder kulturell gemeint ist, macht da keine Ausnahme: Er hat zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches bedeutet«, schreibt Heinrich August Winkler gleich zu Beginn seiner monumentalen »Geschichte des Westens«.[8] Ursprünglich eine geografische Richtungsangabe, wurde diese in Europa seit den Perserkriegen im antiken Griechenland des 5. vorchristlichen Jahrhunderts und später mit der Teilung des Römischen Reiches in Ost und West, verstärkt noch über dessen historisches Ende hinaus durch die westöstliche Kirchenspaltung des christlichen Europas, als identitätsversichernder Abgrenzungsbegriff gegenüber dem Osten verwendet. »Abendland« (Okzident) und »Morgenland«(Orient) bilden das ältere Begriffspaar, das sich nicht nur an Himmelsrichtungen orientiert, sondern am täglichen Lauf der Sonne. Der Begriff des »Abendlandes« ist im Gegensatz zu dem moderneren Begriff des Westens zudem politisch, kulturell und historisch sehr viel eher mediterran begründet, während der moderne Begriff des Westens ursprünglich die nordwesteuropäischen Nationen und Reiche meinte, um dann spätestens mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg den gesamten nordatlantischen Raum zu umfassen: »Euramerica« oder auch »Imperium Anglosaxonicum«[9], wie der deutsche Historiker Ludwig Dehio den transatlantischen Westen in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts zutreffend genannt hatte.
Deutschland, in der Mitte des europäischen Kontinents gelegen und politisch eine »verspätete Nation«[10]