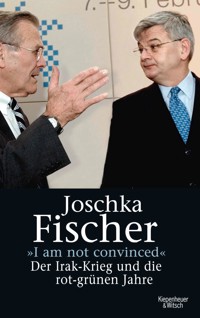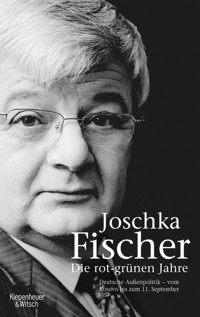
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Joschka Fischer – das Buch Die politischen Erinnerungen des deutschen Außenministers und Vizekanzlers Joschka Fischer an die Jahre der rot-grünen Koalition. Die deutsche Außenpolitik in Zeiten der weltpolitischen Umbrüche nach dem 11. September, zwischen innenpolitischer Reformpolitik und parteipolitischen Krisen und Kontroversen. Die sieben Jahre der rot-grünen Regierungszeit von 1998 bis 2005 sind schneller als erwartet zum Gegenstand zeitgeschichtlicher Erinnerung und Bewertung geworden. Joschka Fischer hat als Außenminister und Vizekanzler die Politik der Regierungskoalition entscheidend geprägt und getragen. In seinem großen autobiographischen Buch stellt Joschka Fischer die Außenpolitik in diesen Jahren tiefster weltpolitischer Umbrüche dar, schildert die Krisen vom Kosovo bis zum 11. September, von Afghanistan bis zum Irak-Krieg. Er zeichnet eindringlich die historischen Entscheidungssituationen nach, denen sich die Regierung ausgesetzt sah, porträtiert die internationalen Akteure von George W. Bush bis zu Jassir Arafat oder Kofi Annan und analysiert die Bedrohungsszenarien vom Nahen Osten bis zum pakistanisch-indischen Konflikt. Hinzu kommen die Auseinandersetzungen über den EU-Beitritt der Türkei, die Reform der UN, die Russland- und Chinapolitik. Eingebettet sind diese Erinnerungen in die wichtigsten innenpolitischen Ereignisse und Krisen der Zeit, parteipolitische Kämpfe und die Kontroversen etwa um die Visa-Politik und die 68er-Vergangenheit von Joschka Fischer.Joschka Fischer, der seit Sommer 2006 in Princeton an der Woodrow Wilson School als Gastprofessor Internationale Krisen-Diplomatie unterrichtet, hat ein hochlebendiges, kontroverses, kritisches und selbstkritisches Buch von großer erzählerischer und analytischer Qualität geschrieben. Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch:»Risiko Deutschland«, 1994. »Für einen neuen Gesellschaftsvertrag«, 1998. »Die Rückkehr der Geschichte. USA, Europa und die Welt nach dem 11. September«, 2005.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Joschka Fischer
Die rot-grünen Jahre
Vom Kosovokrieg bis zum 11. September
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joschka Fischer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joschka Fischer
Joschka Fischer, geboren in Gerabronn. Von 1994 bis 2006 Mitglied des Bundestages, von November 1998 bis Oktober 2005 Außenminister der Bundesrepublik Deutschland.
Im Verlag Kiepenheuer & Witsch sind bisher erschienen: »Risiko Deutschland« (1994), »Für einen neuen Gesellschaftsvertrag« (1998), »Die Rückkehr der Geschichte. USA, Europa und die Welt nach dem 11. September« (2005), »Die rot-grünen Jahre. Deutsche Außenpolitik – vom Kosovo bis zum 11. September« (2009), »I am not convinced« (2011), »Scheitert Europa?« (2014), »Der Abstieg des Westens« (2018), »Willkommen im 21. Jahrhundert« (2020).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Joschka Fischer – das Buch Die politischen Erinnerungen des deutschen Außenministers und Vizekanzlers Joschka Fischer an die Jahre der rot-grünen Koalition. Die deutsche Außenpolitik in Zeiten der weltpolitischen Umbrüche nach dem 11. September, zwischen innenpolitischer Reformpolitik und parteipolitischen Krisen und Kontroversen.
Die sieben Jahre der rot-grünen Regierungszeit von 1998 bis 2005 sind schneller als erwartet zum Gegenstand zeitgeschichtlicher Erinnerung und Bewertung geworden. Joschka Fischer hat als Außenminister und Vizekanzler die Politik der Regierungskoalition entscheidend geprägt und getragen. In seinem großen autobiographischen Buch stellt Joschka Fischer die Außenpolitik in diesen Jahren tiefster weltpolitischer Umbrüche dar, schildert die Krisen vom Kosovo bis zum 11. September, von Afghanistan bis zum Irak-Krieg. Er zeichnet eindringlich die historischen Entscheidungssituationen nach, denen sich die Regierung ausgesetzt sah, porträtiert die internationalen Akteure von George W. Bush bis zu Jassir Arafat oder Kofi Annan und analysiert die Bedrohungsszenarien vom Nahen Osten bis zum pakistanisch-indischen Konflikt. Hinzu kommen die Auseinandersetzungen über den EU-Beitritt der Türkei, die Reform der UN, die Russland- und Chinapolitik.
Eingebettet sind diese Erinnerungen in die wichtigsten innenpolitischen Ereignisse und Krisen der Zeit, parteipolitische Kämpfe und die Kontroversen etwa um die Visa-Politik und die 68er-Vergangenheit von Joschka Fischer.Joschka Fischer, der seit Sommer 2006 in Princeton an der Woodrow Wilson School als Gastprofessor Internationale Krisen-Diplomatie unterrichtet, hat ein hochlebendiges, kontroverses, kritisches und selbstkritisches Buch von großer erzählerischer und analytischer Qualität geschrieben.
Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch:»Risiko Deutschland«, 1994. »Für einen neuen Gesellschaftsvertrag«, 1998. »Die Rückkehr der Geschichte. USA, Europa und die Welt nach dem 11. September«, 2005.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2007, 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudi Linn, Köln
Covermotiv: © Jim Rakete
Wissenschaftliche Mitarbeit: Lars Nebelung
Übersetzungen: Viola Platte (S. 116 und S. 186) und Ingo Herzke (S. 385 und S. 407)
ISBN978-3-462-30014-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Das Jahr 1998 und ein fast verspielter Wahlsieg
Beginn unter dunklen Wolken – ein Krieg zieht herauf
Der rot-grüne Albtraum – Krieg im Kosovo
Herausforderung Europa – von Berlin über Nizza nach Laeken
Die neue Weltunordnung – vom Nahostkonflikt über Mazedonien bis zum 11. September 2001
Abkürzungen
Personenregister
Meinen zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die meine Arbeit in all den Jahren nicht möglich gewesen wäre
Vorwort
Auch wenn für eine geschichtliche Betrachtung der Abstand zur Regierungszeit der rot-grünen Koalition noch sehr kurz ist, so lässt sich doch bereits heute guten Gewissens die Feststellung treffen, dass für Deutschland diese sieben Jahre formative Jahre sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik waren. Die Ursache dafür lag vor allem in zwei Entwicklungen – eine objektive und eine subjektive –, die sich in jener Zeit gekreuzt haben: eine durch den Epochenbruch von 1989 ausgelöste radikale Verschiebung in den Fundamenten der Weltpolitik und Weltwirtschaft und der Anspruch von Rot-Grün zur Reform, zur Veränderung und Erneuerung Deutschlands. Dass dieser Anspruch zuerst und vor allem die Außenpolitik und die internationale Rolle Deutschlands betreffen sollte, war damals den Akteuren nur eingeschränkt bewusst. Im Rückblick ist dieses mangelnde Bewusstsein über das ganze Ausmaß von Veränderungen, die auf uns zukamen, nur schwer verstehbar. Denn die Radikalität des Bruchs durch das Ende der bipolaren Weltordnung und dessen gravierende Folgen für die internationale Politik sind heute, in der Welt nach dem 11. September, nur allzu offensichtlich. Zwischen dem Erleben einer radikalen Umwälzung und deren Begreifen und Verständnis besteht aber ganz offensichtlich eine erhebliche zeitliche Verzögerung.
Es gibt in der Politik keinen »optimalen Zeitpunkt« für eine Koalition oder eine Regierung, und genauso wenig kann man sich seine Aufgaben aussuchen. Beides wird vom Leben diktiert. Die Regierung Kohl musste den Epochenbruch von 1989/90 managen und die sich daraus ergebende Chance zur deutschen Einheit ergreifen und nutzen. Die Regierung Schröder hingegen musste beginnen, diese neue Epoche zu gestalten und die Gleise der deutschen Politik in kaum bekanntes Terrain zu verlegen. Genau über diese Zeit des Neuanfangs nach dem großen Epochenbruch und ihre außenpolitischen Herausforderungen für unser Land handeln meine »Erinnerungen«.
Ein Autor politischer Memoiren ist kein Historiker. Er war ein Handelnder und erinnert sich. Und sich erinnern heißt, die Ereignisse und Akteure aus subjektiver Sicht zu schildern. Gewiss, ich habe meine Aufzeichnungen, Terminpläne, zahlreiche Dokumente und Archive zu Rate gezogen und immer wieder Zeitzeugen um Hilfe bei der Arbeit der Erinnerung gebeten, aber die Grundperspektive bleibt doch immer die subjektive Sicht eines handelnden Akteurs. Ein Buch sei hier gewürdigt, das bei der Abfassung der Kapitel über den Krieg im Kosovo besonders hilfreich war »Der letzte Krieg in Europa? Das Kosovo und die deutsche Politik« von Günter Joetze. Ich muss gestehen, dass ich die Fülle der Ereignisse und die Dichte des Materials als Autor unterschätzt habe. Offensichtlich war auch dies das Ergebnis jenes Erlebens im Handeln, das die Erinnerung nicht unbeeinflusst lässt. Diese Unterschätzung der Aufgabe durch den Autor hat zu Verzögerungen bei der Ablieferung des Manuskripts geführt. Und sie hat nach intensiven Beratungen mit meinem Verleger zu der Entscheidung geführt, meine Erinnerungen an die »rot-grünen Jahre« in zwei Bände aufzuteilen. Und in der Tat, wenn ich auf meine Amtszeit als deutscher Außenminister zurückblicke, dann teilt sich diese sehr klar in zwei Abschnitte. Die Trennlinie wird durch den 11. September 2001 markiert.
Ich habe mich nicht für ein rein chronologisches Vorgehen entschieden, sondern meistens versucht, die historische Zeitabfolge den großen außenpolitischen Themenkomplexen unterzuordnen. Deshalb werden Themen wie die Türkei- und Iranpolitik erst im nächsten Band ausführlich behandelt werden, weil sie dort ihren thematischen Schwerpunkt haben. Andere große Themen wie der Nahost-Konflikt oder die Europa-Politik und ebenso unsere Beziehungen zu den USA werden immer wieder eine ausführliche Erwähnung finden. Darüber hinaus hatte ich auch nicht die Absicht, eine umfassende Geschichte der rot-grünen Koalition auf Bundesebene zu verfassen. Dennoch sind zentrale innenpolitische Konflikte und auch die wichtigsten inner-koalitionären und innerparteilichen Entwicklungen in meiner Darstellung der Ereignisse nicht auszublenden, da sie bisweilen doch einen großen Einfluss auf die Außenpolitik und auf meine Arbeit als Vizekanzler in der Regierung hatten.
Ich versuche in meiner Darstellung, den von mir geschilderten Akteuren gerecht zu werden; ich wollte weder eine unfaire noch eine geschönte Darstellung der Akteure geben, auch wenn gerade hier die subjektive Sicht des Autors unterstrichen werden muss. Abschließende Urteile mögen sich die Leserinnen und Leser bitte bis zum Schluss meiner Erinnerungen aufsparen.
Die in meinen Erinnerungen beschriebenen außen-, innen-und parteipolitischen Entscheidungen waren nur sehr selten einsame Entscheidungen, sondern gingen meistens auf Diskussionsprozesse mit anderen zurück. Wenn ich daher im Text immer wieder vom Ich zum Wir übergehe, so ist dies nicht Ausdruck einer überdrehten Leidenschaft für den Pluralis Majestatis, sondern entspricht der geschilderten Realität. Viele politische Weggefährten und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir durch ihre Anregungen, Korrekturen und Erinnerungen wertvolle Hilfe geleistet. Ihnen allen bin ich zu großem Dank verpflichtet. Meinen Freund und früheren Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Dietmar Huber, muss ich hier aber ganz besonders hervorheben, da seine nimmermüde Recherchearbeit mir eine unverzichtbare Hilfe war, vor allem während meines neunmonatigen Aufenthalts in den USA.
Das Jahr 1998 und ein fast verspielter Wahlsieg
Wir waren endlich angekommen. »Kneif mich«, flüsterte ich meinem neben mir stehenden Ministerkollegen und Freund Otto Schily zu. »Ich kann es einfach nicht glauben. Sag mir, dass es kein Traum ist.« Bundespräsident Roman Herzog hatte uns soeben die Ernennungsurkunden überreicht, und wir standen jetzt während dessen kurzer Rede einträchtig nebeneinander. Ort der Handlung war die ehrwürdige Villa Hammerschmidt in Bonn am Rhein. Am Morgen hatte die erfolgreiche Kanzlerwahl stattgefunden, und jetzt, am späten Nachmittag dieses denkwürdigen Tages, hielten wir, die Mitglieder der rot-grünen Bundesregierung, unsere Urkunden in der Hand. Anschließend würde noch die Vereidigung im Bundestag erfolgen und am frühen Abend dann die erste Sitzung des neuen Bundeskabinetts.
Ich saß zum ersten Mal im großen Kabinettssaal des Kanzleramtes in Bonn. Ein wahres Blitzlichtgewitter tobte sich vor unseren Augen aus. Wir – die SPD und Die Grünen, die Generation der 68er – waren angekommen im Zentrum der politischen Macht, in der Bundesregierung, im Kanzleramt, in den Bundesministerien. Vier Jahre sollten wir jetzt unser Land, Deutschland, regieren. Lust oder Last? – vermutlich beides. Verantwortung, Bürde und viel Mühsal auf jeden Fall. Helmut Kohl, der scheinbar »ewige« Kanzler, war nach sechzehn langen, endlos langen Jahren abgewählt worden und damit Geschichte. Vor wenigen Stunden, am 27. Oktober 1998, hatte der 14. Deutsche Bundestag den Abgeordneten Gerhard Schröder (SPD), gemäß der Vorgabe der Verfassung »ohne Aussprache«, zum Kanzler gewählt. Die rot-grüne Koalition verfügte über einundzwanzig Mandate Vorsprung vor der Opposition, und Gerhard Schröder hatte, wie die Auszählung zeigen sollte, in der geheimen Kanzlerwahl noch sieben Stimmen aus den Reihen der Opposition bekommen. Dies war zwar noch kein Wunder, wohl aber ein Zeichen der Hoffnung. Schienen es die höheren Mächte gut mit uns zu meinen? Die Ursachen für diese zusätzlichen Stimmen waren jedoch höchst irdischer Natur, d. h. es wurden informelle Gespräche mit einzelnen Mitgliedern der Opposition geführt, damit diese für Gerhard Schröder stimmten, nichts weiter. Wir hatten die Kanzlerwahl einfach nur sorgfältig vorbereitet, gut gearbeitet, wie die Eingeweihten wussten.
Ich saß jetzt also im großen Kabinettssaal, neben Gerhard Schröder und all den anderen Ministern – als Mitglied der Bundesregierung, als Bundesaußenminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Irgendwie verrückt, unfassbar eigentlich, und obwohl ich mich selbst für einen großen Realisten hielt, hatte ich in diesem Moment einige innere Zweifel daran zu überwinden, ob ich wirklich wach war oder am Ende nur träumte. Es kam jedoch niemand, der mich wachrüttelte, kein Wecker klingelte, und niemand machte das Licht an. Stattdessen hörte ich die Stimme des Bundeskanzlers, sah einen vergnügten Otto Schily und all die zufriedenen und zugleich erstaunten Gesichter der anderen Kabinettsmitglieder.
Die gesamte Szenerie war das gerade Gegenteil eines trügerischen Traumbildes. Tatsächlich befand ich mich innerlich im Zustand einer aufgewühlten Wachheit. Rot-Grün würde also in den kommenden vier Jahren Deutschland regieren. Willkommen in der harten Realität! Zum ersten Mal würde die Bundesrepublik Deutschland von einer linken Mehrheit regiert werden, nicht Mitte-Links, wie es die sozialliberale Koalition gewesen war, sondern Links. Machtpolitisch hatte die Gründungsidee der Partei Die Grünen mit diesem Tag ihr zweites Etappenziel erreicht: Erst der Einzug in den Bundestag im Jahr 1983, jetzt, mit einem Abstand von fünfzehn Jahren, die Bildung der ersten rot-grünen Bundesregierung, und nun lag als letzte Herausforderung die ökologische und soziale Erneuerung unseres Landes vor uns.
Meine Gedanken gingen zurück zu jenem kühlen Märzmorgen im Jahr 1983, als sich die erste Fraktion der Grünen – eine angeblich am sauren Regen verstorbene, traurig anzusehende Nadelbaumleiche mit sich schleppend – auf dem Weg zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Bundestages gemacht hatte und im Blitzlichtgewitter der Fotografen gerade am Kanzleramt vorbeizog. Das ist unser nächstes Ziel, sagte ich damals zu mir selbst. Dort residierte erst seit wenigen Monaten Helmut Kohl. Sechzehn Jahre insgesamt sollte er dann Bundeskanzler bleiben, und wenn ich diese Zahl schon damals gekannt hätte, so hätte ich wohl eher resigniert, als meinen luftigen Gedanken über die zugegebenermaßen recht utopischen weiteren Ziele des grünen Marsches durch die Institutionen nachzuhängen. Und ich wusste damals auch noch nicht, dass fast mein gesamtes parlamentarisches Oppositionsleben eigentlich darin bestehen würde, Helmut Kohl aus dem Sattel zu heben und eine rot-grüne Mehrheit zu schaffen. Selbst meine neun Jahre in Regierung und Opposition in Hessen folgten schlussendlich immer diesem großen Ziel, die Grünen im Bund in die Regierung zu führen und damit zum eigenständigen Gestaltungsfaktor in der deutschen Politik zu machen. Und jetzt – jetzt! – war dieses Ziel erreicht, fünfzehn Jahre später.
Ich war glücklich, aber zugleich dachte ich zurück an jenes furchtbare Jahr, voller Rückschläge und Beinahe-Katastrophen, das hinter mir lag. Dieses verfluchte Jahr 1998 hatte für mich bis zur Bundestagswahl im Wesentlichen darin bestanden zu verhindern, dass die Grünen erfolgreich Selbstmord begingen und dadurch eine erschöpfte bürgerliche Bundesregierung unter Helmut Kohl vier weitere Jahre im Amt halten würden. Zugleich wäre damit auch der Traum von einer rot-grünen Mehrheit im Bund erledigt gewesen. Ich erinnerte mich in dieser Stunde des Triumphes aus guten Gründen auch an all die Plagen, die Mühen und das mehrfach drohende Scheitern der zweiten rot-grünen Landesregierung in Hessen zwischen 1991-94, an all die kaum vorhersehbaren Fallen und Abgründe des Regierungsalltages als hessischer Umweltminister.
Und ich ahnte auch, ja ich wusste es, dass es noch um ein Vielfaches härter werden würde, die Bundesrepublik Deutschland mit ihren 82 Millionen Menschen zu regieren. Ein Deutschland, das jetzt wieder vereinigt und nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft auf dem Globus war, zudem mit einer, diplomatisch formuliert, sehr schwierigen Geschichte, in der Mitte Europas gelegen und damit für die zukünftige Entwicklung des gesamten Kontinents, für dessen Frieden und für die Stabilität des atlantischen Bündnisses nach wie vor von entscheidender Bedeutung.
Würde unsere rot-grüne Koalition diesen Herausforderungen gerecht werden können? Sind wir Grüne, die von der konservativen Opposition immer wieder und nicht immer zu Unrecht als »Chaoten« attackiert wurden, dazu erfahren genug, im Kopf genügend aufgeräumt, hart genug? Und vor allem: Weiß meine Partei dies alles und wird sie die vor uns liegenden vier Jahre in der Regierung durchhalten, vom erfolgreichen Gestalten ganz zu schweigen?
Damals, an jenem 27. Oktober 1998, wäre ich darauf gewiss keine Wette eingegangen, denn erstens hatten wir Grüne mit unserer Performance im Wahljahr 98 der konservativen These von den grünen Chaoten überreichlich Nahrung gegeben, und zweitens erinnerte das ganze Unternehmen Rot-Grün außenpolitisch, angesichts der sich dramatisch zuspitzenden Lage im Kosovo, mehr und mehr an die Ballade »Der Reiter und der Bodensee« von Gustav Schwab, die das geflügelte Wort vom »Ritt über den Bodensee« so berühmt gemacht hatte. »Es stocket sein Herz, es sträubt sich sein Haar, dicht hinter ihm grinst noch die grause Gefahr«, heißt es dort. Der Reiter soll zwar den Ritt über den zugefrorenen See unwissentlich und unbeschadet hinter sich gebracht haben, aber anschließend, so die Geschichte, traf ihn am rettenden anderen Ufer vor Schreck der Schlag, als er der Wahrheit schließlich gewahr wurde.
Hoffentlich, so dachte ich damals, würde es uns nicht ebenso ergehen. Zudem war bei uns die Wahrscheinlichkeit, mitten im See einzubrechen, noch um Faktoren größer als bei Schwabs wackrem Reitersmann.
Aber an jenem großen Tag eins der rot-grünen Bundesregierung waren das nur bängliche Nachtgedanken eines frisch vereidigten Bundesministers und Vizekanzlers. Jetzt galt es, unseren »Bodensee« anzugehen und unbeschadet hinter uns zu bringen.
Wir standen mit der ersten Sitzung der neuen Bundesregierung am Beginn einer Herausforderung, die keiner der hier im Bundeskabinett versammelten Minister, unter Einschluss des Bundeskanzlers, auch nur annähernd überschauen konnte. Vielleicht war und ist das ja auch gut so, denn wenn eine neue Regierung antritt, dann strahlen die Augen und färben sich die Wangen vor Aufregung und vor Glückshormonen leicht rot. Das gibt sich dann sehr schnell im Regierungsalltag, und das frische Wangenrot wird durch ein verhärmtes Grau im Gesicht abgelöst. Allein der alte Wehner machte nach Wahlsiegen im Fernsehen auf mich immer den Eindruck, als wenn es statt zur Siegesfeier zu einer Beerdigung ginge. Er hatte eben vieles durchgemacht in seinem Leben und war dabei ein gnadenloser Realist geworden. Von diesem reifen Stadium politischer Weisheit waren wir an unserem großen Tag aber noch weit entfernt, denn keiner der im Kabinettssaal Versammelten hatte in seinem bisherigen politischen Leben auch nur annähernd Vergleichbares erlebt und durchzustehen gehabt.
Gewiss, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine waren erfolgreiche Ministerpräsidenten gewesen, ich stellvertretender Ministerpräsident, darüber hinaus gab es einige ehemalige Landesminister in der neuen Bundesregierung. An Regierungserfahrung auf Landesebene gab es keinen Mangel, aber die Bundesregierung war etwas anderes, eine ganz andere Größenordnung politischer Verantwortung und Handelns. Und diese Herausforderung galt es nun mit meiner Partei, den Grünen, anzugehen, deren Verhältnis zur Realität nach wie vor durchaus verbesserungsbedürftig war. Dennoch waren wir alle stolz und glücklich an diesem Tag, wenn auch nur für einen längeren Augenblick. Was Wunder also, dass sich bei allem Glück und aller Freude, die ich in dieser Stunde genoss, mich doch zugleich auch ein nagend mulmiges Gefühl beschlich. Es war keine Angst, gleichwohl aber eine Ahnung dessen, was kommen sollte, Re spekt eher vor der Größe der Herausforderung, der Verantwortung und der Aufgabe.
Rückblick. Wir schreiben den 13. Oktober 1997. Die ersten nebelverhangenen Tage legten sich über Bonn am Rhein, als eine gutgelaunte, weil in der Opposition während der vergangenen drei Jahre erfolgreiche grüne Bundestagsfraktion die immer noch ganz andere Realität (oder besser: Irrealität) der eigenen Bundespartei mit aller Macht wieder einholte. Der Bundesvorstand stellte an diesem Tag den ersten Entwurf eines grünen Wahlprogramms für die im nächsten Jahr stattfindenden Bundestagswahlen vor, und die Wirkung dieses Entwurfes auf die bis dahin für die Grünen sehr positive politische Stimmung war umwerfend. Saurer Regen auf junges Grün muss wohl eine ähnliche Wirkung haben.
»Auseinandersetzung über die Außenpolitik neu entbrannt«, titelte die Süddeutsche Zeitung (SZ). »Der Fraktionschef [Fischer] nennt Entwurf des Wahlprogramms seiner Partei dürftig und prophezeit für 1998 ›Absturz‹. Forderung nach Auflösung von Bundeswehr und NATO besonders umstritten. Linke beharren auf ›Utopien‹.« Und weiter hieß es in dem Artikel: »In dem von der Parteispitze erarbeiteten Entwurf wird die Halbierung der Bundeswehrstärke und letztlich die Abschaffung der Armee gefordert. Die NATO-Osterweiterung wird abgelehnt, die Auflösung der NATO als Ziel genannt. Fischer setzte dagegen, in der Außenpolitik müsse Kontinuität gelten, um kein ›Mißtrauen gegen eine rot-grüne Bundesregierung‹ zu schüren.«
Plötzlich war die schon überwunden geglaubte Angstdebatte in den Medien wieder da, nämlich die Frage, ob man den Grünen die Regierung Deutschlands tatsächlich anvertrauen könne. Und diese »Vertrauensfrage« war für uns Grüne unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Machtwechsels hochgefährlich, denn die konservativ-liberale Mehrheit und ihre Bataillone in den Medien würden genau diese Vertrauensfrage gegenüber den »grünen Chaoten« in den Mittelpunkt ihres Angstwahlkampfes stellen. Für diese Vorhersage bedurfte es nun wahrlich keiner größeren prophetischen Gaben, wir verfügten in dieser Angelegenheit über einen reichlichen Erfahrungsschatz.
Aber eigentlich, so meinte damals nicht nur ich, sondern viele in Fraktion und Öffentlichkeit, würde man sich darüber keine allzu großen Sorgen mehr machen müssen, da dieser Angstkampagne von rechts aufgrund der sichtbar positiven Veränderungen der Grünen und mehrerer erfolgreicher Regierungsbeteiligungen auf Landesebene in der Öffentlichkeit zunehmend der Boden entzogen worden war. Freilich, böse Erfahrungen machten auch misstrauisch, und so blieb ein Restzweifel an der Richtigkeit dieser These bestehen. Denn eigentlich wäre es zu schön, um wirklich wahr zu sein, wenn wir uns in diesem Wahljahr, geschlossen und programmatisch und personell gut aufgestellt, mir nichts, dir nichts in die Wahlschlacht stürzen könnten. Der Wechsel lag in der Luft. Die Regierung Kohl war erschöpft, sie war zunehmend handlungsunfähig durch die Blockadepolitik der SPD unter Lafontaine im Bundesrat, und auch die Menschen im Lande hatten von Helmut Kohl mehr als genug.
Jetzt also bloß keine Fehler machen! Gelänge es Rot-Grün, alle wesentlichen Fehler zu vermeiden, so wäre ein Sieg eigentlich kaum noch zu verhindern. Der richtige Kanzlerkandidat, eine positive Beantwortung der »Vertrauensfrage« im Wahlkampf durch SPD und vor allem uns Grüne und eine Wahlkampfstrategie der Fehlerminimierung – diese Elemente würden im Wahljahr 1998 für Rot und Grün den fast narrensicheren Erfolg bringen, da war ich mir, gemeinsam mit zahlreichen anderen innerhalb und außerhalb der beiden Parteien, ziemlich sicher.
Ach, wie schön kann man sich die Dinge doch ausmalen, auch und gerade in der Politik – und ganz besonders in der damaligen kleinen politischen Welt grüner »Utopien«. In dem weiter oben bereits zitierten Artikel der SZ brachte der grüne Bundestagsabgeordnete Ludger Volmer, einer der führenden außenpolitischen Sprecher der Linken innerhalb der Partei, diesen Vorrang der Wunschwelt über die Wirklichkeit ganz oberschlau zum Ausdruck: »Die Grünen«, so Volmer, »sollten auch weitreichende Utopien in der Zielsetzung‹ nicht aufgeben, ›nur weil das Nadelöhr‹ für eine Realisierung in der Regierung so klein sei.« Die Wirklichkeit als »Nadelöhr«, das war schön gesagt. Blieb allein die Frage: Wie kommt man mit einem programmatischen Elefanten durch eben dieses?
Dazu gab es seitens unserer linken Mehrheit in der Partei keine Antwort, sondern lediglich das übliche wortreiche und doch zugleich dröhnende Schweigen. Zwar wäre die Feststellung seitens der Linken immer mit großer Empörung zurückgewiesen worden, aber faktisch sollten die Realos diesen Elefanten namens »irreales Programm« durch das Nadelöhr der Wirklichkeit und der Mehrheitsfähigkeit bei den kommenden Wahlen ziehen, die Linken beabsichtigten allein, ihre programmatischen Illusionen und damit ihre innerparteiliche Machtposition zu verwalten. Macht mal, hieß deshalb die Ansage mittels des Programmentwurfs des Bundesvorstandes an uns Realos. Schafft ihr es, dann sind wir beim Regieren gerne dabei. Aber bis dahin erwartet keine programmatischen oder gar machtpolitischen Kompromisse in der Partei. O ja, die Botschaft war angekommen. Damit eröffneten sich herrliche Aussichten für das Wahljahr.
Leider zählt in der Politik immer nur ein Modus, nämlich der Indikativ. Indikativ und Utopie sind zwei sich ausschließende Geistesverfassungen. Würde, müsste, könnte – alles Konjunktiv! Aber leider war die Realität unserer Partei immer noch dem Konjunktiv verhaftet, und diese Parteiirrealität begann sich jetzt mit Macht erneut vor die Realität der politischen Mehrheit in Deutschland zu schieben. Und daraus sollte sich erneut ein sattsam bekannter und für uns zugleich hochgefährlicher Widerspruch zwischen gesellschaftlicher und innerparteilicher Wahrnehmung der Realität eröffnen. Dieser Widerspruch hatte in der Vergangenheit vor allem bei Wahlen meistens zu einem bösen Ende zulasten unserer Partei geführt. Zwar entscheiden Parteitage bekanntlich über Programme und Personal, die Wählerinnen und Wähler aber über die Mehrheiten in den Parlamenten. Und genau darum würde es in dem kommenden Wahlkampf gehen, um die Mehrheit und um nichts anderes!
Aber die Partei sah das, wie gesagt, leicht anders. Wozu – gerade als Grüne! – die Autobahn nehmen, wenn man auch mit der Achterbahn ans Ziel kommen kann? Genau eine solche politische Achterbahnfahrt sollte nun für uns Grüne mit der Vorlage des ersten Entwurfs für das Wahlprogramm 1998 beginnen. Dieses Programm hatte die linke Mehrheit im Parteivorstand über viele Wochen und Sitzungen hinweg ausgebrütet. Und diesem Gremium gehörte ich nicht an. Mehr als einmal musste ich in diesem Jahr wohl wie der Reiter über den Bodensee ausgesehen haben, der mit »gesträubtem Haar« gerade noch einmal der »grinsenden Gefahr« entronnen war.
Über nahezu drei Jahre hinweg hatte die Fraktion in Bonn das Erscheinungsbild unserer Partei nach außen erfolgreich geprägt und verändert. Vom grünen Chaosclub war nicht mehr allzu viel sichtbar geblieben, ohne dass dies jedoch zulasten der Inhalte oder gar der programmatischen Unterscheidbarkeit unserer Partei gegangen wäre. Das Gegenteil war vielmehr der Fall. Die Grünen im Bundestag hatten, obwohl sehr viel kleiner als die Sozialdemokraten, inhaltlich und politisch die Rolle der eigentlichen Oppositionsfraktion übernommen. Und in den Umfragen spiegelte sich sowohl die Schwäche der SPD unter Rudolf Scharping als auch unsere erfolgreiche grüne Oppositionsarbeit wider. Über lange Zeit befanden wir uns deutlich im zweistelligen Bereich. Das sollte sich mit dem Beginn des Wahljahres und der Übernahme des grünen Steuerrades durch Bundesvorstand und Bundesparteitag allerdings radikal ändern.
Im Jahr 1994, als nach der Vereinigung der Grünen mit dem Bündnis 90 in Ostdeutschland die Partei Bündnis 90/Die Grünen mit 7,3 Prozent als drittstärkste Fraktion erneut in den Bundestag eingezogen war (nach dem Scheitern der westdeutschen Grünen bei der Einheitswahl 1990 an der Fünfprozenthürde), waren neben einigen älteren auch zahlreiche jüngere Abgeordnete zum ersten Mal dabei. Sie sollten sich in den folgenden Jahren im Bundestag als ein wahres Talentereservoir für die Oppositionsarbeit, aber auch für die inhaltliche Neuausrichtung der Fraktion als mögliche Regierungsfraktion erweisen. Zu ihnen gehörten Andrea Fischer, Margareta Wolf, Matthias Berninger, Oswald Metzger und Cem Özdemir, um nur einige derer zu nennen, die in dieser Zeit auch einer breiteren Öffentlichkeit jenseits von Fraktion und Partei bekannt wurden.
1994 hatte die Ablösung der christlich-liberalen Mehrheit unter Bundeskanzler Helmut Kohl ein weiteres Mal nicht funktioniert. In den entscheidenden Monaten vor der Wahl hatte Kohl den damaligen Kanzlerkandidaten der SPD, Rudolf Scharping, zuerst in den Umfragen überholt und dann seinen vierten Wahlsieg im Bund erreicht. Es war zum Verzweifeln. The same procedure as every year!, konnte man damals in der Wahlnacht, frei nach dem britischen Komiker Freddie Frinton, nur resigniert feststellen.
Andererseits bestand in der Niederlage auch Hoffnung, denn erstens waren die Grünen zum ersten Mal als drittstärkste Kraft mit 7,3 Prozent und 49 Mandaten in den Deutschen Bundestag zurückgekehrt, und zweitens sprach wenig für einen fünften Wahlsieg von Helmut Kohl und seiner Koalition. 1998 würde also zu unserem magischen Jahr werden, denn dann würde sich eine ernsthafte, bisher niemals da gewesene Chance für einen rot-grünen Machtwechsel eröffnen. Eine Chance wohlgemerkt, nicht mehr! Aber eine überaus realistische Chance. Ob diese Chance genutzt werden würde oder nicht, würde davon abhängen, ob SPD und Grüne auf dem Weg dorthin keine schweren Fehler machen würden und die SPD darüber hinaus ihr offensichtliches Führungs- und Kandidatenproblem lösen könnte. Denn mit Rudolf Scharping würde es erneut nichts werden, das schien mir so gut wie sicher.
1998 würde also die konkrete Chance zum Machtwechsel bestehen, und darauf musste man sich, so zumindest lautete meine hessische Erfahrung mit jeweils einer gescheiterten und einer erfolgreichen Koalition mit der SPD, inhaltlich und personell intensiv vorbereiten. Rot-Grün war damals alles andere als eine selbstverständliche parlamentarische Machtkonstellation und galt (vor allem im Bund) immer noch als ein hohes Risiko für eine stabile Mehrheit und eine verlässliche Bundesregierung. Das Wort vom »rot-grünen Chaos« und die daran geknüpften Ängste mussten in den vor uns liegenden Jahren entkräftet werden, um 1998 jene echte Chance auf den Machtwechsel im Bund erfolgreich zu nutzen. Ängste entkräften, Vertrauen aufbauen und Mehrheiten für unsere ökologischen und sozialen Reformen gewinnen – so lautete also für uns Grüne die oberste strategische Priorität in der damals laufenden 13. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages.
Damals, in den Jahren nach 1994, waren die Erinnerungen an die verschiedenen misslungenen und auch gelungenen »rotgrünen Experimente« noch allzu frisch. Die erste rot-grüne Koalition in Hessen war vor allem daran gescheitert, dass die Koalitionsvereinbarung in den wichtigsten Punkten aus nicht oder nur kaum belastbaren Formelkompromissen bestanden hatte und die Zuständigkeiten des »grünen« Umweltministe riums eben nicht den heißesten Konflikt in der Koalition, nämlich die Atomausstiegspolitik, umfasste. Dies sollte sich dann, verschärft durch die Katastrophe von Tschernobyl, als der eigentliche Bruchpunkt erweisen, an dem diese erste rot-grüne Koalition in einem Bundesland im Februar 1987 nach vierzehn Monaten scheiterte. Die zweite rot-grüne Koalition in Hessen von 1991 bis 1995 war hingegen inhaltlich sehr gut vorbereitet gewesen, der Koalitionsvertrag gerade in den entscheidenden Konfliktpunkten durchverhandelt worden, und, extrem wichtig, die Zuständigkeit für die Atompolitik lag in der zweiten rot-grünen Hessenkoalition beim »grünen« Umweltministerium.
Darüber hinaus war der Umweltminister noch Bundesratsminister und stellvertretender Ministerpräsident, damit wurde eine faire und belastbare Machtbalance in Kabinett und Koalition gewährleistet. Diese Entscheidungen waren von zentraler Bedeutung für die protokollarische und machtpolitische Repräsentanz der Grünen in der Koalition mit der wesentlich größeren SPD. Zwar waren die Grünen der Juniorpartner, aber fortan agierten sie inhaltlich und machtpolitisch auf der gleichen Augenhöhe mit dem sozialdemokratischen Seniorpartner. Die Koalition sollte sich aus all diesen Gründen als stabil und erfolgreich erweisen und wurde deshalb mit einem für die Grünen hervorragenden Ergebnis 1995 (19918,8 Prozent Grüne / 10 Mandate; 199511,2 Prozent Grüne /13 Mandate) bei den Landtagswahlen bestätigt.
Freilich waren die Prioritäten des mehrheitlich von der Parteilinken dominierten Bundesvorstandes und erst recht die der grünen Parteitage und ihrer Mehrheiten etwas andere. Selbstverständlich wollte man auch im Bundesvorstand die Chance auf einen Machtwechsel nutzen, aber dieser sollte keinesfalls um den Preis erreicht werden, die bisherigen programmatischen Positionen so der Wirklichkeit anzunähern, dass sich darauf ein Regierungsprogramm aufbauen ließe. Zudem war die Linke – der Magdeburger Parteitag sollte es an den Tag bringen – noch einmal gespalten in sogenannte »Regierungslinke« und »Überzeugungslinke«. Die Regierungslinke wollte ihren programmatischen Radikalismus bis zu einem Wahlsieg von Rot-Grün aufrechterhalten, die Überzeugungslinke war nach wie vor mehr am rechten Glauben denn an Mehrheitsfähigkeit interessiert und hielt jeden anderen Kurs für Verrat. Und so kam es, dass der Bundesvorstand einen Entwurf zum Wahlprogramm vorlegte, der nur bedingt den neuen programmatischen Geist der von Realos dominierten Bundestagsfraktion der vergangenen drei Jahre atmete (Öffnung der Ökologie in Richtung Marktwirtschaft, Ökosteuer, Entbürokratisierung, nachhaltige Finanzpolitik, Abkehr vom sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie, keine fundamentale Ablehnung mehr von militärischen Auslandseinsätzen (Balkan), keine Abschaffung der Bundeswehr oder der NATO). Stattdessen dominierte der alte grüne Programmradikalismus den Entwurf, und das verhieß nichts Gutes.
Zum Schwur sollte es dann am Wochenende des 6.-8. März 1998 auf dem grünen Bundesparteitag in Magdeburg kommen. Dort stand das grüne Wahlprogramm für die kommende Bundestagswahl zur Entscheidung an, eine der ganz wichtigen Weichenstellungen für einen erfolgreichen Wahlkampf. In langen und zähen Verhandlungen mit der Regierungslinken war es zuvor gelungen, diese in der Außenpolitik von ihrer Position abzubringen, dass sie erst in den Koalitionsverhandlungen und damit nach einem Wahlsieg bereit wäre, die Realität zur Kenntnis zu nehmen und die notwendigen Kompromisse einzugehen, auch wenn die damalige programmatische Öffnung im außenpolitischen Teil nur äußerst maßvoll war.
Wir Realos hielten diese Haltung für suizidal, weil sie den möglichen Wahlsieg im hohen Maße gefährden und unsere Verhandlungsposition, ja unser gesamtes Standing in einer rotgrünen Koalition schwächen würde. Worüber ich nicht laut sprach – und wenn, dann nur im allerkleinsten Kreis –, war meine Erfahrung in Hessen. Ohne die Übernahme eines klassischen Ressorts durch uns Grüne und ohne den Vizekanzler würden wir von vornherein inhaltlich und machtpolitisch auf den Katzentisch in einer rot-grünen Bundesregierung reduziert werden, auf das »Gedöns« also, wie Gerhard Schröder die sogenannten »weichen« Themen und Ressorts – Umwelt, Frauen, Familie etc. – einmal in einem anderen Zusammenhang zu nennen beliebte. Das Innenressort kam für uns nicht in Frage, Justiz war bedeutend, aber machtpolitisch nicht stark genug, und traditionellerweise hatte die FDP in den letzten Koalitionen immer das Außenressort geführt. Mir war klar, dass nur eine starke grüne und auch starke persönliche Position in einer möglichen rot-grünen Regierung ein vorzeitiges Scheitern verhindern konnte. Und das beinhaltete auch weitgehende persönliche Konsequenzen:
Für mich hieß das im Falle eines rot-grünen Wahlsieges, erstens das Außenministerium und den Vizekanzler anzustreben und zweitens mein Bundestagsmandat im Falle des Eintritts in die Bundesregierung auf keinen Fall aufzugeben (für die Grünen war damals die Trennung von Amt und Mandat ein hohes Prinzip!), weil dies meine politische Handlungsfähigkeit extrem einschränken, die eigene Rolle nach innen wie gegenüber dem Koalitionspartner schwächen und die Interessenkonflikte zwischen Regierung und Fraktion im Streitfall erheblich verstärken würde. Denn nur wenn die Alternative für meine Partei, angesichts der absehbaren, extrem schwierigen Entscheidungen und Kompromisse, jeweils personell wie inhaltlich in einem klaren »Alles oder Nichts!« bestehen würde, gäbe es eine Chance auf Erfolg. Und selbst dann würde es noch schwer genug werden. Auch bei den Sozialdemokraten durfte nicht der geringste Zweifel aufkommen, dass es mit den Grünen und mir keine Regierungsbeteiligung zweiter Klasse geben würde. Denn würde in der Öffentlichkeit und in meiner Partei auch nur der leiseste Verdacht grüner Zweitklassigkeit aufkommen, so wäre es um die Stabilität und Durchhaltefähigkeit dieser Koalition geschehen. Könnte ich mich in einem dieser Punkte nicht durchsetzen, so lautete deshalb meine Schlussfolgerung, dann würde ich auf keinen Fall in die Bundesregierung eintreten, sondern in der Fraktion bleiben.
Diesen Entschluss hatte ich schon seit längerer Zeit allein und für mich persönlich getroffen. Ohne diese beiden Grundvoraussetzungen würde nach meiner Überzeugung ein erfolgreiches Regieren in einer rot-grünen Koalition nicht möglich sein. Meine hessischen Erfahrungen hatten mich zutiefst geprägt. Aus all diesen Überlegungen heraus und auch angesichts der jahrelangen grünen Kontroverse um die Außen- und Friedenspolitik, um NATO, Balkan und Bundeswehreinsätze, standen diese Themen im Zentrum des öffentlichen Interesses, des Wahlprogramms und der gegenüber uns Grünen aufgeworfenen »Vertrauensfrage«.
Wir, die Realos, versuchten daher mit den Regierungslinken in Fraktion, Partei- und Landesvorständen eine Formel für die Außenpolitik zu finden, die eine deutsche militärische Beteiligung auf dem Balkan in unserem Wahlprogramm nicht völlig ausschloss. Dafür aber akzeptierten wir Realos u. a. die alte grüne Formel von den »Fünf Mark für einen Liter Benzin«. Die ostdeutschen Realos, angeführt von Gerd Poppe und Werner Schulz, erhoben dagegen die schwersten Bedenken, denn sie waren der Meinung, das würde in Ostdeutschland zu einem Desaster bei den Bundestagswahlen führen. Die Leute wollten nach Jahrzehnten einer automobilen Wüstenei namens DDR endlich Auto fahren, ja sogar rasen, und hätten für ökologisch noch so vernünftige Vorschläge, die auf einen erneuten Verzicht hinauslaufen würden, überhaupt kein Verständnis. Sie sollten recht behalten, sehr sogar.
Für mich stand jedoch aus den genannten Gründen die Außenpolitik im Vordergrund. Daran würde sich, so meine Auffassung, letztendlich die Regierungsfähigkeit der Grünen und damit die erfolgreiche Beantwortung der »Vertrauensfrage« als Regierungspartei beweisen müssen. Der ökologische Programmradikalismus der Grünen war in der Vergangenheit exakt jener Teil der grünen Welt der Illusionen gewesen, für den wir noch am wenigsten von den Wählern bestraft worden waren. Hatte sich dieser ökologische Radikalismus im Gegenteil nicht immer als eine notwendige Antriebskraft für den Umbau der Industriegesellschaft erwiesen, und war dies nicht von den Wählern auch so verstanden und akzeptiert worden? Hinzu kamen die taktischen Überlegungen, nach denen wir Realos auf keinen Fall in allen drei zentralen Fragen – beim Atomausstieg, bei den fünf Mark und in der Außenpolitik – auf dem Parteitag gewinnen würden. Außenpolitik und Atomausstieg – die zweite programmatisch-machtpolitische Priorität der Grünen – würden sich für den Bestand und die Handlungsfähigkeit einer möglichen rotgrünen Bundesregierung als essenziell erweisen, und wer würde die fünf Mark denn schon ernst nehmen – also?
Meine Zustimmung zu dem Fünf-Mark-Beschluss sollte sich als mein ureigenster Riesenfehler in diesem Wahljahr erweisen. Ich hatte die fatale Wirkung unseres programmatischen Öko-radikalismus auf die vor uns liegende »Vertrauensfrage« als mögliche Regierungspartei völlig unterschätzt. Hinzu kam noch die Negativwirkung unserer Niederlage in der Außenpolitik, sodass sich zur Freude von Konservativen und Liberalen, zum Entsetzen der Sozialdemokraten und zum unermesslichen Katzenjammer der Grünen die Kommentierung des Magdeburger Parteitags in den Medien in einem leicht abgewandelten Zitat eines berühmten Galliers zusammenfassen ließ: »Die spinnen, die Grünen!«.
»Bis zum 8. März, 23.12 Uhr, war die kleine grüne Welt noch in Ordnung. Eine Minute später aber hatten die 800 Delegierten des Magdeburger Parteitags mit nur einer Stimme Mehrheit ein Kompromißpapier zur Verlängerung des SFOR-Mandats der Bundeswehr in Bosnien niedergestimmt. Das Unglück nahm seinen Lauf.« Mit diesen Worten schilderte DER SPIEGEL in einer Nachbetrachtung auf den Parteitag jene dramatisch misslungene Abstimmung. Welch ein Desaster! Nie zuvor waren auf einem grünen Parteitag so viele nationale und internationale Journalisten als Beobachter anwesend gewesen, denn in Magdeburg wollte ja eine mögliche Regierungspartei ihr Wahlprogramm für die Zukunft Deutschlands beschließen. Und dann das!
In Magdeburg hatte sich auch gezeigt, dass die Regierungslinke in unserer Partei nur so lange die Partei führen konnte, solange sie dem Programmradikalismus der Mehrheit folgte. Ging sie Kompromisse mit den Realos oder gar der Realität ein, brach ihr sofort die Basis weg. Es waren am Ende eben doch nur Häuptlinge ohne Indianer. Ein pazifistischer Antrag aus Hamburg sollte das in dieser Nacht beweisen. Die Gesinnungslinken um Hans-Christian Ströbele aus Berlin und Uli Cremer aus Hamburg triumphierten. Alle Verhandlungen nach der verlorenen Abstimmung in den Kulissen des Parteitages führten zu nichts, die Niederlage, ja der grüne Super-GAU war Wirklichkeit geworden, herbeigeführt von der eigenen Parteitagsmehrheit.
Ströbele! Immer wieder Ströbele! »Dieser Meister der grünen Selbstzerstörung«, so knurrte ich damals in mich hinein. Während der Nachverhandlungen in den halbdunklen Kulissen des Parteitages tauchte in meiner Erinnerung immer wieder das Bild eines aufgebracht ätzenden Hans-Jochen Vogel auf, der mir gegenüber Hans-Christian Ströbele einmal mit eindeutigen Worten charakterisiert hatte: »Welch ein Narr!« Diese Aussage bezog sich darauf, dass im Vorfeld der Bundestagswahl 1990 die Grünen, angeführt von Hans-Christian Ströbele, gegen das vom Bundestag beschlossene Wahlgesetz beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt und gewonnen hatten. Danach gab es ein neues Gesetz, die Listen in Ost und West wurden getrennt gezählt, und die Grünen waren bei den Bundestagswahlen 1990 draußen! Nach dem alten, vom Bundestag zuerst beschlossenen und dann von den Grünen erfolgreich beklagten Recht aber wären wir im Bundestag geblieben!
O ja, Hans-Jochen Vogel war ein sehr kluger Mann, sagte ich in jener Nacht in Magdeburg zu mir selbst immer wieder. Erneut hatte sich also Ströbele mit schwerem ideologischem Flügelschlag in die Lüfte erhoben und unter dem Jubel der Parteitagsmehrheit den Grünen ein weiteres Mal die Füße weggeschlagen. Es war einfach nur ätzend! Später, in den Jahren der rot-grünen Koalition, sollte sich mein Verhältnis zu Hans-Christian Ströbele allerdings zum Positiven wandeln, denn bei allem grünen Dogmatismus, der ihm zu eigen ist, erwies er sich immer dann, wenn es um die Machtfrage und damit um die Koalition ging, als durchaus pragmatisch, ja hochflexibel und immer verlässlich, selbst bei den schwierigsten Absprachen. In Magdeburg allerdings war bei ihm von solch pragmatischer Erweckung nicht die geringste Spur zu finden.
Mein Gott, wir standen so kurz vor dem Ziel des Machtwechsels, und dann dies! Hilflose Wut, tiefe Enttäuschung, bleierne Resignation – irgendwo dazwischen verlor sich mein Gemütszustand in jener Nacht auf dem Parteitag. Was würden wir Grüne ab Montag durchgeprügelt werden, von der Öffentlichkeit, vom politischen Gegner, vom möglichen Koalitionspartner. Und welch ein Absturz würde uns erst in den Umfragen drohen! Ich hatte mir ja im Laufe von anderthalb Jahrzehnten angesichts der immerwährenden Niederlagen der Realos auf grünen Bundesparteitagen ein gewisses Maß an politischem Masochismus zugelegt. Dadurch war ich politisch und persönlich weitgehend schmerzunempfindlich gegenüber innerparteilichen Niederlagen geworden, aber Magdeburg übertraf alles bisher Erlebte. Und ich selbst konnte mich von der eigenen Schuld an diesem Desaster nicht freisprechen, was diese Niederlage ganz besonders bitter für mich machte.
Hinterher, gegenüber Journalisten an der Bar im Hotel, wurde unsere entscheidende Niederlage in der Außenpolitik dann von den Häuptlingen der mit uns Realos unterlegenen Regierungslinken als ein besonders intelligentes Manöver dargestellt, um die Realos vorzuführen und Fischer zu schwächen. Aber das waren lediglich mühsame Rechtfertigungsversuche ihrer eigenen Niederlage und der Versuch, sich aus dieser davonzustehlen. Nein, nach Magdeburg durfte Helmut Kohl wieder hoffen, das war die ganze, die traurige Wahrheit dieses grünen Parteitages im Schatten des Doms von Otto dem Großen, den ich noch in der Nacht vor der Niederlage besucht hatte. Aber auch diese kleine Wallfahrt zu Dom und Kaisergrab zu nächtlicher Stunde hatte ganz offensichtlich keinen Segen gebracht. Die kommenden Wochen und Monate sollten vielmehr eher an einen bitteren Bußgang erinnern.
Obwohl ich im Laufe der Jahre solch genussvoll zelebrierte Akte der politischen Selbstbeschädigung durch unsere Parteitage immer wieder erlebt und durchlitten hatte, konnte ich die Rationalität (oder auch Irrationalität) dieses Verhaltens niemals wirklich begreifen. Warum beschädigt eine Partei, unter dem lauten Jubel der Mehrheit der Delegierten, so massiv ihre eigenen Interessen oder zerstört diese gar? In den achtziger Jahren verfügte der Fundi-Realo-Konflikt innerhalb der Grünen in seinem Kern ja noch über eine gewisse Rationalität, denn es ging in der Tat um zwei sich ausschließende strategische Ansätze: Systemopposition und Protestpartei hieß die fundamentalistische Strategie, Regierungsfähigkeit und Reformpartei lautete dagegen die Strategie der Realos. Das waren zwei sich widersprechende Parteistrategien, ja Parteien, und dieser Tatsache waren sich damals beide Seiten völlig bewusst gewesen. Früher oder später musste eine Entscheidung herbeigeführt werden, und eine der beiden Seiten würde gehen müssen.
Und genau so ist es dann auch nach der katastrophalen Wahlniederlage der Grünen in den Einheitswahlen 1990 gekommen. Auf dem turbulenten Parteitag in Neumünster (Schleswig-Holstein) vom 26. bis 28. April 1991 verließen, nach wüsten Auseinandersetzungen, die radikalen Linken die Partei, und die Regierungslinken übernahmen damals die Macht im Bundesvorstand. Die Realos – quasi als »running gag« grüner Parteitagsgeschichte – verloren erneut, d. h. unsere Kandidaten für die Sprecher des Bundesvorstandes wurden nicht gewählt.
Lange vor meinem Eintritt in die grüne Partei und nach dem schmerzhaften Abschied von den radikalen Illusionen der siebziger Jahre und der Frankfurter Spontibewegung waren wir, einige Freunde aus der Frankfurter Spontibewegung um Dany Cohn-Bendit und im Umkreis der Stadtzeitung »Pflasterstrand«, nach langen Diskussionen zu der Überzeugung gelangt, dass die Grünen als Partei nur dann Sinn machten, wenn sie bereit wären, nicht nur zu protestieren und zu opponieren, sondern wenn sie um ihre Mehrheitsfähigkeit und damit um die Gestaltungsmöglichkeiten einer Regierungspartei kämpfen würden.
Bliebe es bei Protest und Fundamentalopposition allein, so würde eine Parteigründung auf der Linken nichts beizutragen haben, was eine Protestbewegung nicht wesentlich besser könnte. Eine reine Protestpartei, die aus ideologischen Gründen auf die eigene Machtperspektive verzichtete, würde daher einerseits notwendigerweise versuchen, solche Bewegungen zu vereinnahmen, andererseits aber zur Durchsetzung ihrer inhaltlichen Ziele mangels Machtperspektive wenig bis nichts beitragen können. Am Ende bliebe dann lediglich die institutionelle Dominanz einer Protestpartei über die Protestbewegung, was gerade uns Frankfurter Altspontis ein echter Gräuel war. Und eine solche radikale Protestpartei müsste dann, mangels eigener parlamentarischer Gestaltungsperspektiven, sehr schnell in der bloßen Verwaltung radikaler Dogmen und Glaubenssätze erstarren.
Machtpolitisch gesehen würden ihre Stimmenanteile bei Wahlen immer nur dem politischen Gegner auf der anderen Seite des politischen Spektrums helfen und der Mehrheitsfähigkeit des eigenen Lagers bei Wahlen schaden. Daher war objektiv in der fundamentalistischen Strategie der Hauptgegner die SPD und nicht das konservativ-liberale Lager, während die Strategie der Realos gegenüber der SPD auf Eigenständigkeit als Mittel zur Bündnisfähigkeit abzielte.
Nur als eigenständige ökologische und soziale Reformkraft machte für uns, die unter nicht geringen politischen Schmerzen zu ökologischen und sozialen Reformern geläuterten Frankfurter Altspontis, die Gründung der grünen Partei und ihr Versuch, sich in den Parlamenten zu etablieren, Sinn. Sonst wäre es besser, in die SPD einzutreten oder einfach nur zu privatisieren und sich definitiv aus der Politik zu verabschieden. Nur wenn die sozialen und ökologischen Positionen der Neuen Linken in dieser neuen Partei zu einem eigenen reformerischen Machtfaktor werden konnten, ließ sich das grüne Parteiprojekt in unseren Augen rechtfertigen. Nach der Überwindung jenes illusionären bis verantwortungslosen Radikalismus, der die Neue Linke in den späten sechziger und siebziger Jahren bestimmt hatte, durfte das machtpolitische Ergebnis nicht lauten, lediglich als programmatisches Integrationsproblem innerhalb der SPD zu enden. Deshalb musste die grüne Politik zu einem eigenständigen parlamentarischen Macht- und Gestaltungsfaktor werden. Aus diesen Überlegungen heraus entstand dann Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre in Frankfurt das »Konzept Realpolitik«.
Nahm man diese Analyse ernst, dann hieß dies aber, die Frage der Mehrheitsfähigkeit und damit den Kampf um eine mögliche Regierungsbeteiligung in den Mittelpunkt der grünen Strategie zu stellen. Gerade für Ökologen und Umweltschützer, die ja nur allzu oft mit dem Bild »Es ist fünf vor zwölf!« alarmistisch argumentierten, war es eigentlich nahezu oberste Pflicht, möglichst schnell an die Schalthebel der Macht eines demokratischen Systems zu gelangen, um den fatalen Gang der Ereignisse noch abwenden zu können.
Über ein Jahrzehnt hinweg ging es jedoch jenseits der Realos keineswegs um solch rationale Argumente in der innergrünen Kontroverse. Vielmehr war der Glaube wichtiger als die Macht, der Glaube an die eigenen radikalen Inhalte. Hinter dem radikalen Glaubensgestus verbargen sich gewiss auch kleinliche persönliche Interessen, Angst vor der Verantwortung und sehr viele Reste und Versatzstücke der radikalen Ideologie der Neuen Linken aus den sechziger und siebziger Jahren. Aber im Kern war die Reinheit der Überzeugung wichtiger als der scheinbare »Schmutz« des parlamentarischen Kompromisses und – durch freie und geheime Wahlen legitimierte – Regierungsmacht. Diese Haltung entsprang dem antiparlamentarischen Erbe der Neuen Linken, ja war genauer besehen eigentlich einer romantisch-vordemokratischen, zutiefst deutschen und alles andere als positiven Tradition verpflichtet. Zugleich aber hatten sich dieselben Grünen mit ihrer Parteigründung auf den Weg in die Parlamente gemacht, und dieser Widerspruch musste dann über ein Jahrzehnt hinweg durchlebt und ausgefochten werden.
Es war also kein Wunder, dass ein anhaltender Realitätsverzicht und das Sichern innerparteilicher Mehrheiten vor dem Erreichen gesellschaftlicher Mehrheiten die Bundespartei über viele Jahre hinweg dominiert hatten. Diese Herrschaft des Wunsches über die Wirklichkeit lag von Anbeginn an in der strukturellen Widersprüchlichkeit des grünen Projekts begründet. Trotz all dieser theoretischen Erkenntnisse waren es gleichwohl qualvolle Jahre für mich gewesen, die mein Verhältnis zu meiner Partei – genauer der Bundespartei – dauerhaft negativ bestimmen sollten. Denn wirklich warm – im Sinne emotionaler Verbundenheit, sodass ich mich in meiner Partei auch persönlich wohl oder gar zu Hause gefühlt hätte – bin ich in all den Jahren mit der grünen Bundespartei niemals geworden. Damit ich richtig verstanden werde, die Grünen waren und sind meine Partei. Ich habe für sie gekämpft, gelitten, verloren und gesiegt. Und ich habe meiner Partei sehr viel zu verdanken und konnte ihr wohl auch einiges davon im Laufe der Zeit zurückgeben. Aber emotional sind mir die Bundesgrünen immer fremd geblieben, bis auf den heutigen Tag. Dies galt und gilt allerdings nicht für die Grünen in Frankfurt und Hessen. Dort hat sich für mich wirkliche politische Heimat entwickelt.
Vielleicht aber, so dachte ich damals in Magdeburg, war ich mit der Bundespartei lediglich zu ungeduldig gewesen. Diese jahrelange Quälerei, dieser ganze Fundi-Radikalismus der vergangenen Jahre lag doch weit hinter uns! Die Fundis waren gegangen, ausgetreten aus der Partei, und selbst die Linken in NRW und Berlin wollten regieren. Aber man konnte doch nicht regieren und opponieren zur gleichen Zeit. Genau das war es aber, was die Mehrheit in Magdeburg wollte. Der Fundamentalismus ist also noch da, seine Ideen sind noch da, obwohl ihre Hauptprotagonisten die Partei seit langem verlassen haben – dies war eine mich tief deprimierende Erkenntnis in diesem Wahljahr. Wascht uns den Pelz, aber macht uns nicht nass – und genau dies würde niemals funktionieren! Dazu hätte es wahrlich nicht der Gründung der grünen Partei bedurft, um die Richtigkeit jener alten Weisheit ein weiteres Mal praktisch zu beweisen.
Nach dem Magdeburger Debakel ging es dann für uns Grüne munter und Schlag auf Schlag weiter. Am 22. März kam es bei den ansonsten bundespolitisch weniger bedeutsamen Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein für uns Grüne zu einem schweren Einbruch mit rund einem Drittel weniger an Stimmen als bei der Wahl zuvor. Und in diesem Jahr war eben alles von Bedeutung, auch eine Kommunalwahl im fernen Norden der Republik! Zudem wurde am 26. März im Deutschen Bundestag über die NATO-Osterweiterung abgestimmt. Dies war eine grundsätzliche, ja historische Frage, denn Deutschland konnte etwa Polen den Beitritt in die NATO nicht verweigern. Ein deutsches Nein hätte die für uns so überaus wichtige europäische Integration in den Grundfesten erschüttert, Deutschland isoliert und das transatlantische Bündnis gefährdet. Die Frak tion war in dieser Frage tief gespalten, sodass ich am Ende mit dreizehn weiteren Abgeordneten der grünen Fraktion der NATO-Ost-erweiterung zustimmte, sechs Abgeordnete stimmten mit Nein, während sich fünfundzwanzig grüne Abgeordnete der Stimme enthielten. »Tiefe Zerrissenheit«, »Spaltung der Grünen«, »Grüne wanken« etc. lauteten am nächsten Tag die Schlagzeilen, und man konnte ihnen nicht einmal widersprechen.
Am 26. April wurde in Sachsen-Anhalt der Landtag gewählt und – erwartungsgemäß – die dort regierende rot-grüne Koalition abgewählt. Schlimmer noch, die Grünen sackten von 5,1 Prozent 1994 auf 3,2 Prozent 1998 ab. Damit waren sie nicht nur aus der Regierung, sondern auch aus dem Landtag herausgewählt worden. Magdeburg schien die Stadt zu sein, in der in diesem für uns entscheidenden Jahr 1998 unser grünes Schicksal besiegelt werden würde. Ein Minus von 1,9 Prozentpunkten, Regierungsverlust und parlamentarischer Exitus für die Grünen – und all das in einem Bundestagswahljahr! Der Montag nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war wieder einmal so ein Tag gewesen, an dem man als grüner Realo aus emotionalen Selbstschutzgründen die Zeitungslektüre besser vergaß. Und um meine Freude endgültig zu komplettieren, legte die SPD (unser präsumtiver Koalitionspartner in Bonn/Berlin) um 1,9 Prozentpunkte zu und verbesserte sich innerhalb von vier rot-grünen Regierungsjahren von 34,0 auf 35,9 Prozent.
Zwar war die Niederlage der sachsen-anhaltinischen Grünen, ganz unabhängig vom Magdeburger Parteitag, innerhalb der Partei allseits erwartet worden, denn ihre Leistungsbilanz in der Regierung war, in milden Worten gesagt, wohl nur als dürftig zu bezeichnen. Aber der desaströse Bundesparteitag hatte den eh schon vorhandenen landespolitischen Abwärtstrend wohl noch um einiges verstärkt.
Ich hatte mich im Landtagswahlkampf intensiv engagiert und war auch am Wahlabend, in Erwartung der fast sicheren Niederlage, nach Magdeburg zu den Grünen in den Landtag gefahren. Denn wir durften den Landesverband auf keinen Fall in der Niederlage allein und in eine absehbare tiefe Depression fallen lassen. Die Bundestagswahlen hatten in diesem Jahr, komme was da wolle, für uns die oberste Priorität zu sein, und dazu brauchten wir auch in Sachsen-Anhalt einen einigermaßen geschlossenen und wenigstens leidlich aktiven Landesverband. Es war aber – was Wunder auch? – alles andere als ein einfacher Abend in der grünen Fraktion im sachsen-anhaltinischen Landtag. Die Stimmung war zu Recht deprimierend, und ich war daher froh, mich bald wieder auf den Heimweg machen zu können. Magdeburg, Magdeburg, immer wieder Magdeburg …
Nach dem Parteitag war für uns Grüne eine lustige Zeit angebrochen, denn die Partei des Pazifismus lag fortan unter publizistischem Trommelfeuer. Die Boulevard-Presse vorneweg, die eher der konservativ-liberalen Regierungsmehrheit nahestand, aber auch die seriöseren Zeitungen und Magazine schossen sich auf uns Grüne ein, aus allen Rohren mit dicken Schlagzeilen, ja ganzen Aufmachern feuernd. »5 Mark für 1 Liter Benzin!«, »Der grüne Wahnsinn!«, »Sind die Grünen noch zu retten?« etc. lauteten damals die Schlagzeilen. Und man konnte es den Medien nicht verübeln, wenn sie die von uns Grünen ohne Not geschlagenen Steilvorlagen mit Genuss ins grüne Gehäuse hämmerten. Genau dazu ist die vierte Gewalt ja da. Den Vorwurf der mangelnden Fairness konnten wir nach Magdeburg kaum erheben, und beschweren konnten wir uns ausschließlich bei uns selbst, meine eigene Wenigkeit eingeschlossen.
Der Bundesparteitag war der Beginn eines langen Leidensweges, denn nunmehr hatten die Medien politisch Blut geleckt und die Spur aufgenommen. Das grüne Wahlprogramm, aber auch grüne Anträge im Parlament und in den Ausschüssen des Bundestages und selbst länger zurückliegende Beschlüsse von Parteitagen wurden nun auf das Sorgfältigste und Genussvollste exhumiert, durchleuchtet und seziert. Und siehe da, die kritischen Forscher wurden sehr schnell fündig. Unsere Vorsitzende des Tourismusausschusses des Deutschen Bundestages hatte einmal vorgeschlagen, dass man die Flugreisen der Deutschen ins Ausland pro Jahr aus ökologischen Gründen limitieren sollte. Diese Idee erneuerte sie in einem Interview. Welch ein Fressen für den Boulevard: Grüne gegen Mallorca-Urlaub! Eine andere Abgeordnete, die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, sprach sich für die bundesweite Einführung von Tempo 100 auf allen bundesdeutschen Autobahnen aus, für eine grüne Verkehrspolitikerin eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber jetzt wurde mit diesen Funden ein publizistisches Schlachtfest sondergleichen (und jedes Wochenende aufs Neue) zulasten der Grünen veranstaltet.
Was Wunder auch, denn wir Grüne selbst hatten ja die für die kommenden Wahlen zentrale »Vertrauensfrage« mit unseren Magdeburger Beschlüssen aufgeworfen und sie dort zugleich mit Wollust negativ beantwortet. Sollen diese Leute tatsächlich Deutschland regieren? Das war die Frage hinter all den berechtigten und zu Teilen auch überzogenen oder gar ungerechten Schlagzeilen. Und die Antwort lautete – mal mehr, mal weniger fein ziseliert – unisono: Nein! Allerdings kippte das von uns selbst losgetretene publizistische Massaker gegen uns Grüne nach qualvoll langen Wochen um, weil es überzogen und damit selbst unglaubwürdig wurde. Die Medien unterlagen dabei einem sattsam bekannten »Herdeneffekt«. Jeder, aber auch jeder musste jetzt noch irgendetwas Skandalöses im grünen Programm finden, und so wurden die Skandalisierungen immer absurder. Ich selbst setzte auf die für uns günstige Wirkung der Maßlosigkeit der Attacken. Auf die Frage nach den möglichen Knackpunkten bei rot-grünen Koalitionsverhandlungen antwortete ich damals: »Die Abschaffung von Weihnachten, das Verbot von Silvester und die Ausbürgerung des Osterhasen«. Jede ökologische Position der Grünen wurde schließlich skandalisiert, und das drehte am Ende die Stimmung zu unseren Gunsten. Allerdings bezahlten wir für Magdeburg einen sehr hohen Preis. Ohne Magdeburg und die Folgen hätten wir wohl schon 1998 ein Ergebnis mit einer 8 vor dem Komma erreichen können.
Aber die Freude der Sieger des Magdeburger Parteitages währte nur ein kurzes Wochenende lang, danach begann der ganz große Katzenjammer auch unter den Linken. Und je heftiger die öffentlichen Angriffe ausfielen, umso mehr und schneller griff in den Landesverbänden und in der Parteiführung die Erkenntnis um sich, dass irgendetwas unternommen werden musste, um den fatalen öffentlichen Eindruck der Magdeburger Beschlüsse zu korrigieren. Ein neuer Parteitag allerdings war materiell und politisch ausgeschlossen. Ein anderes taugliches Instrument musste her, und als das für dieses programmatische Wendemanöver taugliche Instrument wählte der Bundesvorstand einen kleinen Parteitag, einen »Länderrat«, wie er bei uns Grünen hieß.
Fritz Kuhn, Realo der ersten Stunde und Fraktionsvorsitzender der Grünen im baden-württembergischen Landtag, hatte gemeinsam mit Jürgen Trittin einen Resolutionsentwurf ausgearbeitet. Die Annahme dieses grüneninternen »Wendepapiers« geschah dann ohne allzu heftige Kontroversen nahezu einstimmig, bei nur einer Enthaltung. Die Fünf-Mark-Forderung war darin nicht mehr enthalten, zum Flugtourismus wurde keinerlei Aussage gemacht, und am Bosnien-Einsatz der Bundeswehr wurde festgehalten. Damit war es zumindest etwas gelungen, den Eindruck von Magdeburg zu korrigieren, ohne dadurch zugleich eine neue Debatte aufzumachen, nämlich die des programmatischen Umfallens unter öffentlichem Druck.
Das grüne Leiden war mit diesem Länderrat und der programmatischen Korrektur von Magdeburg allerdings mitnichten zu Ende. Den einsamen Höhepunkt dieser grünen Selbstkasteiungen setzte dann am 10. Juni und erneut ohne Not unser damaliger Bundesvorsitzender Jürgen Trittin, der es sich nicht nehmen ließ, auf einer »Gelöbnix« genannten Protestveranstaltung radikal linker und pazifistischer Gruppen in Berlin gegen ein öffentliches Bundeswehrgelöbnis eine lärmend radikale Rede zu halten, in der er die Bundeswehr in einen Zusammenhang mit der Wehrmacht rückte. Das war ein weiterer echter Volltreffer, allerdings erneut im eigenen Gehäuse.
Trittin schien vergessen zu haben, dass wir ein Wahljahr hatten – oder war dieser Auftritt gar als Beitrag der Parteilinken zum grünen Bundestagswahlkampf gemeint gewesen? Schließlich mussten ja auch noch weit links 50 Wählerstimmen gewonnen werden, selbst wenn uns das 50000 Stimmen in der Mitte kosten konnte. (Ich weiß, ich übertreibe jetzt leicht, aber die damalige Stimmung unter uns Realos war eher noch schlimmer und aufgeheizter.) Sollte uns denn in diesem Jahr nichts, aber auch gar nichts erspart bleiben, selbst ein irrwitziger politischer Selbstentleibungsversuch seitens der allerhöchsten Parteiobrigkeit nicht? Es war zum Mäusemelken.
Am 19. Juni 1998, einem Freitag, ging es im Bundestag um die Verlängerung des Bosnienmandates der Bundeswehr. Die Mehrheit der grünen Fraktion wollte diesem Mandat zustimmen, aber die Union ließ sich die Chance nicht nehmen, uns in der Causa Trittin lauthals vorzuführen. Mir war im Parlament nach einer direkten Attacke der Union gar nichts anderes übriggeblieben, als die These einer möglichen Kontinuität zwischen Hitlers Wehrmacht und der Bundeswehr unverzüglich und in klaren Worten zurückzuweisen, ansonsten hätten wir eine der Fünf-Mark-Debatte durchaus ähnlich schädliche Kontroverse um »Die Grünen und die Bundeswehr« bekommen. Und um den absehbaren Angriff der Union abzufangen und zugleich die Geschlossenheit der Fraktion zu erhalten, hatten wir einen eigenen Entschließungsantrag zu diesem Debattenpunkt eingebracht, der – im Ton verbindlich, in der Sache klar – Trittins historischem Vergleich offen widersprach.
Aber weder der Antrag der Fraktion noch gar meine Distanzierung im Parlament hatten auf die wütenden Realos in der Fraktion eine besänftigende Wirkung. Ganz im Gegenteil wurde beides nun als eine Einladung zum großen Halali auf den linken Vorstandssprecher verstanden. Denn Jürgen Trittin, der gemeinsam mit der Reala Gunda Röstel Bundesvorsitzender war und den linken Flügel in der Partei anführte, wirkte nicht erst wegen dieses Auftritts auf manche Realos in der Fraktion wie ein rotes Tuch auf einer sommerlichen Bullenweide. Der frühere DDR-Dissident und grüne Bundestagsabgeordnete Gerd Poppe etwa war durch nichts und niemanden mehr zurückzuhalten. Er forderte in der Lobby des Bonner Bundestages in die laufenden Kameras und Mikrophone hinein empört und vor Wut fast schnaubend den sofortigen Rücktritt von Trittin, und damit bekamen auch meine distanzierenden Worte innerparteilich und in der Öffentlichkeit eine andere Bedeutung, als von mir beabsichtigt. Weitere Abgeordnete aus den Reihen der Realos folgten mit öffentlichen Erklärungen und heizten so die innerparteiliche Konfrontation weiter an.
Damit ging es aber plötzlich nicht mehr nur um eine Schadensbegrenzung gegenüber der Öffentlichkeit für einen missglückten Auftritt unseres Vorstandssprechers – was die Linke wohl verstanden und auch hingenommen hätte –, die öffentlichen Rücktrittsforderungen gegenüber Trittin wurden jetzt als offene Kriegserklärung der Realos an die Parteilinke verstanden! Die Realos wollen Trittin stürzen und noch vor den Wahlen in der Partei die Macht übernehmen, hieß die Parole unter den Linken. Diese schlossen daraufhin ihre Reihen, und so tauchte zu allem Überfluss auch noch die Gefahr von einzelnen prominenten Parteiaustritten oder gar einer Spaltung der Partei in diesem Wahljahr auf. Dieser ganze »Gelöbnix«-Irrsinn drohte sich zu sehr viel mehr auszuwachsen als nur zu einem weiteren grünen Eigentor. Es tauchte dahinter vielmehr eine echte Bedrohung für die Geschlossenheit der Partei auf. Und all dies ereignete sich drei Monate – drei Monate! – vor der Bundestagswahl!
Die Affäre endete, wie im Parteienbetrieb üblich, in den »Gremien«, und d. h. in einer gemeinsamen stundenlangen Sitzung der beiden geschäftsführenden Vorstände von Partei und Bundestagsfraktion. Es war eine zähe Sitzung, und Trittin machte – wie schon öfter in ähnlichen Situationen – auf trotzig und unnachgiebig. Selbstverständlich war Jürgen Trittins Vergleich historisch falsch und politisch daneben, was er wohl mittlerweile selbst begriffen hatte. Aber eine Fortführung der Konfrontation hätte uns zerrissen und aller Wahlchancen beraubt. Also mussten die Scherben zusammengekehrt und »die Einheit von Fraktion und Partei«, wie es in solchen Situationen immer so schön heißt, wiederhergestellt werden. Und wie wird dies in der Regel bewerkstelligt? Richtig, mit einer »gemeinsamen Erklärung«, in der Jürgen Trittin das Vertrauen ausgesprochen und zugleich versprochen wurde, sich über öffentliche Auftritte in Zukunft gegenseitig besser zu informieren.
»Herr, lass endlich den eigentlichen Wahlkampf beginnen«, seufzte ich in dieser Zeit mehr als einmal, denn dann wäre das Ende dieser selbstverfertigten Qual endlich absehbar, ganz egal, wie die Wahl schlussendlich ausgehen würde. Und vielleicht würde der Wahlkampf ja tatsächlich disziplinierend wirken. Hatte ich allerdings im Sommer 1997 noch geglaubt, wir Grüne könnten den Wahlkampf aufgrund unserer überzeugenden Oppositionspolitik und unseres dadurch veränderten Bildes in der Öffentlichkeit offensiv führen und vielleicht sogar auf ein zweistelliges Ergebnis mit einer 10 vor dem Komma zielen, so war ich nach dem doppelten Magdeburg und all den anderen Rückschlägen wieder hart auf dem Boden grüner Realitäten aufgeschlagen. Ein schweres Defensivspiel lag da vor uns, und wenn wir unser Ergebnis von 1994 halten könnten, so durften wir mehr als froh sein. Sicher war das jedoch keineswegs.
Ganz anders hatte sich hingegen die Entwicklung bei den Sozialdemokraten, unseren Konkurrenten und zugleich möglichen Koalitionspartnern, gestaltet. Seitdem Oskar Lafontaine am 16. November 1995 auf dem Mannheimer Parteitag der SPD überraschend Rudolf Scharping an der Spitze der Partei abgelöst hatte, war die Sozialdemokratie wieder auf Erfolgskurs. Und mit der absoluten Mehrheit für Gerhard Schröder bei den niedersächsischen Landtagswahlen am 1. März 1998 war auch die Frage des Kanzlerkandidaten zwischen ihm und Lafontaine zugunsten von Schröder entschieden worden. Fortan konnte die Partei geschlossen und entschlossen auf Sieg spielen. Genau das taten die Sozialdemokraten auch.
Die niedersächsischen Landtagswahlen hatten bereits 1994 das Aus für Rot-Grün in Hannover gebracht, denn durch das Wegbrechen der FDP unter die Fünfprozenthürde (4,4 Prozent) reichten der SPD unter Schröder sehr gute 47,9 Prozent (+ 3,6 Prozentpunkte) zur absoluten Mehrheit. Und Schröder hatte die absolute Mehrheit für die SPD auch dadurch erreicht, dass er die niedersächsischen Grünen in der Koalition kleingehalten und in industriepolitisch-ökologischen Fragen bisweilen sogar gedemütigt hatte. Jürgen Trittin war 1990 lediglich Bundesratsminister geworden, wohingegen Monika Griefahn, eine bundesweit bekannte Aktivistin von Greenpeace, das Umweltressort in der Landesregierung für die SPD erhielt. Schröders Absicht, mittels einer rot-grünen Koalition den Grünen das Leben schwerzumachen, war damit recht unverhüllt klargeworden. Zudem mutete er den Grünen mit dem Bau einer Gasleitung durch das Wattenmeer, der Emsvertiefung und der Genehmigung einer Teststrecke für einen großen Automobilkonzern fast Unmögliches zu. Lediglich in der Atomenergie und in Fragen der inneren Liberalität fuhr er einen für die Grünen akzeptableren Kurs.
In Niedersachsen dominierten die Linken in der grünen Partei, und die öffentliche Einschätzung nach vier Jahren lautete 1994: »Aufmüpfig, aber pflegeleicht«. Auch bei der niedersächsischen Landtagswahl 1998 hatten die Grünen mächtig Angst um ihr Ergebnis wegen ihrer mäßigen Oppositionspolitik und der Strahlkraft des niedersächsischen Ministerpräsidenten. Aber ihre Befürchtungen bewahrheiteten sich Gott sei Dank nicht. Es gab mit 7 Prozent lediglich ein leichtes Minus von 0,4 Prozentpunkten zu verzeichnen. Dennoch war die Botschaft dieser Wahlnacht von Hannover sehr eindeutig: The winner takes it all! Und der hieß nun mal Gerhard Schröder, war ein Sozialdemokrat und hatte nach vier Jahren seine absolute Mehrheit verteidigt. Rot-Grün war in Niedersachsen durch Schröders Umarmungspolitik offensichtlich dauerhaft erledigt worden. Es war für uns eben auch schon vor Magdeburg nicht gut in diesem vermaledeiten Wahljahr 98 gelaufen.