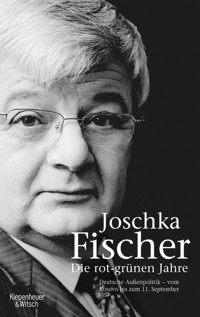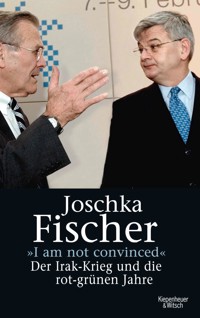
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zeitgeschichte von innen: Joschka Fischers Erinnerungen an dramatische Wendepunkte der Zeitgeschichte. Der 11. September 2001 leitete eine Zeitwende ein, die die deutsche Regierung und den damaligen Außenminister Joschka Fischer vor dramatische Herausforderungen stellte. Die erste Antwort auf die New Yorker Anschläge war der Krieg in Afghanistan, der bis in die Gegenwart die deutsche Politik in Atem hält. Das Gleiche gilt für den Krieg der USA gegen den Irak, dem sich die rot-grüne Koalition entgegenstellte und der zu heftigen Konflikten zwischen den USA und Deutschland führte. Joschka Fischer berichtet von innen über die dramatischen Hintergründe dieses Zerwürfnisses und die schwierige Gratwanderung zwischen seinem Nein zum Krieg und der Rolle Deutschlands als wichtigstem Bündnispartner der USA in Europa. Aber auch viele andere politische Groß-Themen von Heute haben in den Jahren der rot-grünen Regierung ihren Ursprung, seien es die Debatten über Laufzeiten von Atomkraftwerken, die Agenda 2010 und die Hartz IV-Gesetze, die drohende atomare Bewaffnung des Iran, die Krisen der Europäischen Union und nicht zuletzt die Auseinandersetzungen um die NS-Geschichte des Auswärtigen Amtes, deren kritische Erforschung durch Joschka Fischer angestoßen wurde und zu erschreckenden Ergebnissen geführt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Joschka Fischer
»I am not convinced«
Der Irak-Krieg und die rot-grünen Jahre
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joschka Fischer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joschka Fischer
Joschka Fischer, geboren in Gerabronn. Von 1994 bis 2006 Mitglied des Bundestages, von November 1998 bis Oktober 2005 Außenminister der Bundesrepublik Deutschland.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Zeitgeschichte von innen: Joschka Fischers Erinnerungen an dramatische Wendepunkte der Zeitgeschichte.
Der 11. September 2001 leitete eine Zeitwende ein, die die deutsche Regierung und den damaligen Außenminister Joschka Fischer vor dramatische Herausforderungen stellte. Die erste Antwort auf die New Yorker Anschläge war der Krieg in Afghanistan, der bis in die Gegenwart die deutsche Politik in Atem hält. Das Gleiche gilt für den Krieg der USA gegen den Irak, dem sich die rot-grüne Koalition entgegenstellte und der zu heftigen Konflikten zwischen den USA und Deutschland führte.
Joschka Fischer berichtet von innen über die dramatischen Hintergründe dieses Zerwürfnisses und die schwierige Gratwanderung zwischen seinem Nein zum Krieg und der Rolle Deutschlands als wichtigstem Bündnispartner der USA in Europa.
Aber auch viele andere politische Groß-Themen von Heute haben in den Jahren der rot-grünen Regierung ihren Ursprung, seien es die Debatten über Laufzeiten von Atomkraftwerken, die Agenda 2010 und die Hartz IV-Gesetze, die drohende atomare Bewaffnung des Iran, die Krisen der Europäischen Union und nicht zuletzt die Auseinandersetzungen um die NS-Geschichte des Auswärtigen Amtes, deren kritische Erforschung durch Joschka Fischer angestoßen wurde und zu erschreckenden Ergebnissen geführt hat.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Übersetzungen: Ingo Herzke
Wissenschaftliche Mitarbeit: Lars Nebelung
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © picture-alliance/dpa
ISBN978-3-462-30018-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Von New York nach Afghanistan
Irak und die Hybris einer Weltmacht
Wiederwahl und der Beginn des deutsch-amerikanischen Zerwürfnisses
»The Axis of Weasels« und der Kampf um Krieg und Frieden
Außenpolitik zwischen Irak, Israel und Palästina
Die letzten Jahre
Das Finale
Fünf jahre später – ein aktuelles Nachwort
Abkürzungen
Von New York nach Afghanistan
Der Terroranschlag vom 11. September 2001 veränderte binnen weniger Minuten die Politik in den Hauptstädten der Welt. Dieser weltweit live im Fernsehen übertragene Angriff auf die politischen und wirtschaftlichen Zentren der Vereinigten Staaten von Amerika war zu schockierend und dessen absehbare Konsequenzen waren zu gravierend, als dass man mit dem üblichen Tagesgeschäft hätte einfach fortfahren können. Selbstverständlich galt dies auch für Berlin.
Die innen- und außenpolitischen Tagespläne von Regierung und Parlament wurden binnen Minuten vom Tisch gefegt, bereits feststehende Termine und Reiseplanungen wurden zu Makulatur, und die gesamte politische Agenda der Bundeshauptstadt richtete sich auf die neue terroristische Bedrohung aus.
Innerhalb der Bundesregierung lief nach dem ersten Schock der Krisenreaktionsmechanismus in den Ministerien an. An erster Stelle war der für die innere Sicherheit zuständige Innenminister gefordert, aber auch im Auswärtigen Amt galt es, Maßnahmen zum verstärkten Schutz der deutschen Auslandsvertretungen und anderer deutscher Einrichtungen außerhalb unserer Grenzen einzuleiten sowie unverzüglich telefonisch mit der internationalen Abstimmung im Rahmen von EU und NATO und mit unseren wichtigsten Partnern außerhalb von Europa zu beginnen.
Meinen amerikanischen Kollegen Colin Powell konnte ich an diesem schicksalhaften Tag allerdings telefonisch nicht erreichen, da er sich zu einem Besuch in Lima, der Hauptstadt von Peru, aufhielt und sofort nach Erhalt der schrecklichen Nachricht zurück nach Washington aufgebrochen war. Erst am nächsten Abend war es mir möglich, mit ihm zu sprechen und ihm meine Erschütterung und tiefe Anteilnahme angesichts des schrecklichen Verbrechens und der großen Zahl unschuldiger Opfer zu übermitteln. Colin Powell sprach dabei von sich aus den Nahostkonflikt an, da er an diesem Tag kurz vor unserem Gespräch mit Arafat telefoniert hatte. Die Konfrontation zwischen den Palästinensern und Israel verschärfte sich seit einiger Zeit erneut und forderte immer mehr Opfer auf beiden Seiten. Der amerikanische Außenminister versicherte mir, dass die USA weiterhin im Nahen Osten engagiert bleiben würden, und teilte mir mit, dass er Arafat gesagt habe, dass jetzt der Moment gekommen wäre, an dem sich die Palästinenser bewegen müssten. Ich konnte ihm nur zustimmen.
Während dieses Telefonats erläuterte mir Colin Powell auch zum ersten Mal und in wenigen Worten die ersten Konsequenzen, welche die US-Regierung aus dem Terroranschlag vom 11. September zu ziehen gedächte: Die Vereinigten Staaten würden keineswegs nur gegen die Attentäter dieses Anschlags, sondern gezielt gegen den Terrorismus insgesamt vorgehen. An jenem Abend waren mir die Folgen dieser neuen amerikanischen Strategie noch nicht völlig klar, aber dies sollte sich wenige Tage danach während meines Besuches in Washington und nach einem Gespräch mit Paul Wolfowitz, dem stellvertretenden US-Verteidigungsminister, im Pentagon sehr schnell ändern.
Der Bundeskanzler hatte für den späten Nachmittag des 11. September eine Krisensitzung des Bundessicherheitsrates (der BSR ist ein Kabinettsausschuss der Bundesregierung, in dem alle sicherheitsrelevanten Fragen erörtert und die deutschen Rüstungsexporte beschlossen werden) ins Kanzleramt einberufen, in der die ersten Maßnahmen und auch die weitergehenden Schritte beraten und beschlossen werden sollten.
In der Sitzung des BSR wurden von allen betroffenen Ressorts die Sofortmaßnahmen vorgetragen und auch formell gebilligt. Diese bezogen sich vor allem auf die Flugsicherheit und den Schutz der Flughäfen in Deutschland. Zudem wurde aufgrund des Berichts des Innenministers und der Dienste die Gefährdungslage für Deutschland erörtert – es konnte nur eine allgemeine oder »abstrakte« Gefährdung festgestellt werden – und die nächsten politischen Schritte beraten und beschlossen.
Eigentlich sollte an diesem Abend auch das seit Längerem geplante Sommerfest der Grünen stattfinden, bei dem ich vorbeischauen wollte. Aber diese Festivität war nach dem Eintreffen der Schreckensnachrichten aus den USA sofort abgesagt worden. Es war an diesem Tag niemandem mehr zum Feiern zumute. Stattdessen hatte der Bundeskanzler für den Abend die Partei- und Fraktionsvorsitzenden des Deutschen Bundestages zur Unterrichtung und Abstimmung ins Bundeskanzleramt eingeladen, denn angesichts der Tatsache, dass Deutschlands wichtigster Bündnispartner außerhalb Europas faktisch durch eine kriegsähnliche Handlung in seinen Entscheidungszentren angegriffen worden war und sehr viele Opfer zu befürchten waren, bedurfte es einer gemeinsamen Haltung der demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag.
Zudem war bereits zu diesem frühen Zeitpunkt abzusehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Deutschland schwere Entscheidungen bis hin zur militärischen Solidarität mit den USA zukommen würden, selbst wenn in diesem Moment noch völlig unklar war, ob es sich bei den Terrorattacken in New York und Washington um einen Angriff von außen gehandelt hatte und, wenn ja, von wem.
Das gesamte Muster dieser Terroranschläge sprach mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Urheberschaft Osama bin Ladens und seiner islamistischen Terrorgruppe al-Qaida, aber es sollte noch einige Zeit dauern, bis die Täter und ihr Hintergrund zweifelsfrei festgestellt werden konnten. Auch unter diesem Gesichtspunkt war daher eine im Parlament möglichst breit getragene Antwort der Bundesregierung auf diese neue terroristische Bedrohung von erheblicher Bedeutung.
Das Treffen mit dem Bundestagspräsidenten und den Spitzen der im Bundestag vertretenen Fraktionen und Parteien fand um 20.00 Uhr im Kanzleramt statt. Zuvor war um 19.00 Uhr noch die grüne Bundestagsfraktion im Reichstagsgebäude zu einer Sondersitzung zusammengetreten.
Allen Teilnehmern der interfraktionellen Runde, wie auch zuvor den Mitgliedern der grünen Bundestagsfraktion, standen der Schock und die Erschütterung über die Terroranschläge in den USA ins Gesicht geschrieben. Jedem und jeder war bewusst, dass etwas Ungeheuerliches geschehen war und dass dieser Tag den Gang der Geschichte verändern würde. Die Live-Bilder im Fernsehen vom Einschlag der Flugzeuge, von den Menschen, die in den Tod sprangen, um nicht ein Opfer der sich ausbreitenden Flammenhölle in den Hochhäusern des World Trade Centers zu werden, und schließlich vom Einsturz der Zwillingstürme und dem brennenden Gebäude des Pentagons hatten allen eine unmittelbare Nähe zu den Ereignissen vermittelt, die emotional tief berührte.
Hier saßen nicht nur gewählte Funktionsträger, die politischen Spitzen der Republik, zusammen, um erste politische Konsequenzen dieses Angriffs auf unseren Verbündeten zu beraten, sondern es waren alles Menschen aus Fleisch und Blut, die das Grauen dieses Tages auch emotional und jeder für sich zu verarbeiten hatten. Entsprechend gedrückt war die Stimmung im Saal.
Vor Beginn des Treffens im Kanzleramt zeigte mir Gerhard Schröder seinen Sprechzettel. Darin stand die Formulierung von der »uneingeschränkten Solidarität« mit den Vereinigten Staaten, und ich verstand sofort, was der Kanzler damit auszudrücken beabsichtigte: Es war ein Ja Deutschlands zu einer möglichen militärischen Beteiligung an einem Krieg in Afghanistan, wenn dieser absehbare Fall nach der Feststellung der Fakten tatsächlich eintreten würde.
Ich unterstützte die Haltung des Bundeskanzlers vorbehaltlos, denn sollten die USA tatsächlich von außen angegriffen worden sein (was bereits zu diesem frühen Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuten war), dann würde zumindest politisch der Bündnisfall in der NATO eintreten, und darauf war durch die Bundesregierung nur mit »uneingeschränkter Solidarität« zu antworten, wenn man unsere Beziehungen zu den USA nicht ernsthaft gefährden wollte. Jedes Zaudern, jedes Wackeln, ja auch nur eine Undeutlichkeit bei der Beantwortung der sich stellenden Bündnisfrage hätte für Deutschland fatale Folgen haben können. Gerade für uns Deutsche zählte aber auch noch ein sich aus unserer jüngeren Geschichte ergebender emotionaler Faktor, nämlich Dankbarkeit gegenüber den USA, auch wenn es sich dabei nicht gerade um einen politischen Begriff handelt. In diesem Fall und an diesem Tag verband sich aber zu Recht ein vitales außenpolitisches Interesse unseres Landes mit dem Begriff der historischen Dankbarkeit.
Die Vereinigten Staaten hatten, gemeinsam mit der Sowjetunion und Großbritannien, den Nationalsozialismus niedergekämpft und dadurch Europa und auch Deutschland von dem Grauen der Nazidiktatur befreit. Sie hatten im Kalten Krieg Stalin Einhalt geboten und über vier Jahrzehnte lang die Freiheit Westberlins und Westdeutschlands garantiert und verteidigt. Sie hatten auch ganz wesentlich zum Aufbau der deutschen Nachkriegsdemokratie beigetragen. Und sie hatten die deutsche Einheit, anders als etwa Frankreich und Großbritannien, sofort und nachdrücklich unterstützt, als sich im Jahr 1989 diese nicht für möglich gehaltene Chance völlig unverhofft auftat.
Nach dem 11. September ging es für uns also nicht nur allein um realpolitische Bündnisfragen und deren Konsequenzen, sondern gerade wir Deutsche hatten gegenüber den angegriffenen Vereinigten Staaten eine historische Dankesschuld abzutragen. Der Augenblick dafür war jetzt gekommen.
Gerhard Schröder benutzte diese in den folgenden Monaten noch sehr oft von ihm wiederholte Formulierung von der »uneingeschränkten Solidarität« öffentlich zum ersten Mal während des Treffens im Kanzleramt mit den Spitzen von Parlament, Parteien und Fraktionen. Auch die Tagesordnung des Plenums für den nächsten Tag wurde dort umgeworfen, und man vereinbarte in dieser Sitzung, am nächsten Tag die Plenarsitzung des Parlaments mit einer Regierungserklärung des Bundeskanzlers und einer sich daran anschließenden kurzen Aussprache des Hauses zu den Terrorattacken vom 11. September zu beginnen.
Spätnachts telefonierte ich noch mit dem israelischen Außenminister Schimon Peres und mit dem palästinensischen Präsidenten Jassir Arafat, denn dieser Tag würde ohne jeden Zweifel auch massive Auswirkungen auf die gesamte Region des Nahen Ostens haben, sollten die Terroranschläge auf die USA tatsächlich von al-Qaida oder einer anderen islamistischen Terrororganisation ausgeführt worden sein.
Für mich bestand vom ersten Augenblick an ein enger politischer Zusammenhang zwischen dem Nahostkonflikt und den absehbaren Auswirkungen des 11. September. Ich unterstellte in meiner Analyse zwar keinen direkten Zusammenhang in der Sache oder durch die möglichen Akteure, da uns keinerlei Informationen darüber vorlagen, dass der palästinensische Terror (israelische Sicht) oder der legitime bewaffnete Widerstand gegen die Okkupation durch Israel (palästinensische Sicht) über Kontakte zu Bin Laden verfügte. Umgekehrt hatte sich dieser bis dato auch nicht sonderlich für die Palästinenser interessiert. Die politischen Auswirkungen auf den israelisch-palästinensischen Konflikt würden dennoch ganz erheblich sein, denn jegliche Form von Terrorismus würde fortan von der mit weitem Abstand größten und mächtigsten Militärmacht der Gegenwart als eine existenzielle Bedrohung ihrer eigenen Sicherheit begriffen werden. Und dieser durch den 11. September völlig veränderte Blick der USA auf den Terrorismus würde die Grundparameter des Nahostkonflikts, in dem die Vereinigten Staaten einer der ganz entscheidenden Spieler waren und sind, radikal verändern.
Die Palästinenser hatten in ihrem Krieg gegen Israel und die anhaltende israelische Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens vor allem auf die Waffe des Terrors gegen die israelische Zivilbevölkerung gesetzt, da sie militärisch gegen die israelische Armee nicht die geringste Chance hatten. Was immer auch die Ursachenforschung der nächsten Stunden und Tage an Tätern und Verantwortlichkeiten für den 11. September zutage fördern würde, so war zumindest völlig klar, dass der Einsatz von Terror gegen die Zivilbevölkerung von den USA und ihren internationalen Partnern fortan politisch und moralisch geächtet und mit allen Mitteln bekämpft werden würde.
Und »alle Mittel« würde im Fall der USA tatsächlich alle militärischen Mittel meinen. Allerdings konnte ich mir zum damaligen Zeitpunkt Folter und andere Menschenrechtsverletzungen – Guantanamo, Abu Ghraib – nicht vorstellen, auch nicht das Ausmaß der Bürgerrechtseinschränkungen in den USA und jene »Politik der Angst« der Regierung Bush, die das Land über Jahre hinweg im Griff halten sollte. Dazu reichte meine Fantasie an jenem 11. September 2001 schlicht nicht aus.
Für die Palästinenser hieß die Botschaft jenes Tages, dass sie sich würden entscheiden müssen, auf welcher Seite sie in der sich abzeichnenden globalen Konfrontation stehen wollten. Schon einmal hatte Jassir Arafat in einer vergleichbaren historischen Situation eine fatal falsche Entscheidung für sein Volk getroffen – als er sich nach dem Überfall des Irak auf Kuwait für Saddam Hussein entschied. Eine solche historische Fehlentscheidung durfte sich aber jetzt nicht wiederholen, wenn der bereits vor dem 11. September stark gefährdete Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern nicht endgültig kollabieren sollte. Und wer weiß, so waren an jenem Abend dieses historischen Tages meine Überlegungen, vielleicht könnte die Tragödie von New York und Washington – die Einsicht beider Konfliktparteien und vor allem Jassir Arafats vorausgesetzt – sogar die Chance für einen Ausgleich im Nahostkonflikt eröffnen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass im Nahen Osten aus einer großen Tragödie ein neuer Schritt nach vorn in Richtung Ausgleich und Frieden unternommen worden wäre.
Die Formel von der »uneingeschränkten Solidarität« wiederholte der Bundeskanzler auch am nächsten Morgen in seiner Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag. Die entscheidenden Sätze des Kanzlers lauteten:
»Meine Damen und Herren, ich habe dem amerikanischen Präsidenten das tief empfundene Beileid des gesamten deutschen Volkes ausgesprochen. Ich habe ihm auch die uneingeschränkte – ich betone: die uneingeschränkte – Solidarität Deutschlands zugesichert. Ich bin sicher, unser aller Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ihnen gilt unser Mitgefühl, unsere ganze Anteilnahme. Ich möchte hier in Anwesenheit des neuen amerikanischen Botschafters Dan Coats noch einmal ausdrücklich versichern: Die Menschen in Deutschland stehen in dieser schweren Stunde fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. (Beifall im ganzen Hause).«
Mit diesen Worten hatte der Bundeskanzler die Bundesregierung und die Koalition für den wahrscheinlichen Fall der Fälle politisch definitiv festgelegt, wenn es zu einem Militäreinsatz der USA und ihrer Verbündeten als Antwort auf die Terrorattacke vom 11. September kommen sollte: Deutschland würde mit dabei sein. Und alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages verstanden diese Festlegung nur zu gut.
Am Mittag machte ich mich dann auf den Weg nach Brüssel, um an der von der belgischen EU-Präsidentschaft einberufenen Sondersitzung der Außenminister der Europäischen Union teilzunehmen. Auch der Generalsekretär der NATO, George Robertson, war eingeladen worden und nahm an der Sitzung teil. George Robertson war ein knorriger Schotte, ein ehemaliger Gewerkschaftsführer, zudem ein überzeugter Transatlantiker, der im ersten Kabinett von Tony Blair Verteidigungsminister gewesen war. Bei seinem Ausscheiden aus der britischen Regierung war er von der Königin zum Lord Robertson of Port Ellen geadelt worden. Robin Cook, der britische Außenminister, pflegte in feinsinniger Ironie George Robertson als »Eure Lordschaft« (your lordship) anzusprechen, was angesichts dessen harten schottischen Akzents und seiner eher handfesten Erscheinung stets zu einiger Heiterkeit im NATO-Rat führte. Ich übernahm die Anrede »your lordship« nur allzu gerne, was der NATO-Generalsekretär, wissend um meine linksradikale Vergangenheit, mit einem »comrade Fischer« (Genosse Fischer) zu kontern pflegte. George Robertson war selten um einen Scherz oder um ein heiteres Wort verlegen, wir beide hatten im Laufe der Zeit ein politisch enges Verhältnis zueinander aufgebaut. Aber an diesem 12. September 2001 war kein Platz für Ironie oder gar heitere Worte.
Während der Sitzung erreichte mich ein Anruf meines Büroleiters Martin Kobler, der mir mitteilte, dass die Gebäude des Auswärtigen Amtes im Augenblick wegen einer anonymen Bombendrohung vollständig geräumt würden. Falls ich jemanden erreichen wolle, müsse ich mich in der nächsten Stunde über ihn und sein Mobiltelefon vermitteln lassen. Im Hintergrund hörte ich die Alarmsirene heulen. In anderen Zeiten hätte ich ein solches Ereignis als einen mutmaßlichen Fehlalarm abgetan, aber jetzt, einen Tag nach dem 11. September 2001, beschlich mich doch ein sorgenvolles Gefühl. Gott sei Dank erwies sich diese Bombendrohung als falscher Alarm.
Zurück in der Sitzung unterrichtete der NATO-Generalsekretär die versammelte EU-Ministerrunde, dass er daran dächte, am Abend dem NATO-Rat vorzuschlagen, förmlich den Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags zu erklären. Dadurch sollte die Solidarität des Bündnisses mit den angegriffenen Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht und die uneingeschränkte Solidarität der Europäer mit den USA demonstriert werden. Robertson bat die anwesenden EU-Außenminister um Unterstützung, und dies galt ganz besonders für jene Staaten, die zugleich auch Mitglied der NATO waren.
Robertsons Vorschlag war zwar grundsätzlich richtig, allein zur Stunde stand noch nicht einmal fest, von wo dieser Terroranschlag gekommen war und wer für ihn die Verantwortung trug. Ich sagte mir, dass es vielleicht besser wäre, die Klärung dieser beiden Fragen abzuwarten, aber andererseits musste der Vorschlag, nachdem ihn der NATO-Generalsekretär jetzt gemacht hatte, voll unterstützt und im NATO-Rat angenommen werden. Alles andere wäre als eine Verweigerung der Solidarität mit den USA angesehen worden.
Allerdings konnte ich unmöglich allein über den Eintritt des Bündnisfalles entscheiden – zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der NATO! –, ohne nicht zumindest versucht zu haben, den Bundeskanzler zu unterrichten und mich mit ihm abzustimmen. Zwar hatten die EU-Außenminister in dieser Frage formal nichts zu sagen, aber wenn ich hier und jetzt für die Bundesregierung unsere Zustimmung signalisierte, dann wäre die Sache entschieden.
Und ausgerechnet jetzt, angesichts einer solch herausragend wichtigen Entscheidung, war das Amt in Berlin geräumt worden und nur eingeschränkt handlungsfähig! Ich nutzte daher die noch anhaltende Debatte im Rat, um Martin Kobler zurückzurufen, der dann sehr schnell eine Verbindung mit dem Bundeskanzler herstellte. Der Kanzler war mit der Sache bereits vertraut, denn er war zuvor schon von Präsident Bush angerufen worden. Nachdem ich ihn über die Lage im Rat unterrichtet hatte, waren wir uns einig, dass es nur ein klares Ja der Bundesregierung zu dem Vorschlag des NATO-Generalsekretärs geben konnte.
Der Vorschlag von George Robertson, formell den Eintritt des NATO-Bündnisfalles zu erklären, wurde von den Außenministern, die in Brüssel versammelt waren, einhellig unterstützt, und am Abend beschloss dann der NATO-Rat, in dem die Mitgliedsstaaten durch ihre Botschafter vertreten sind, auf einer außerordentlichen Sitzung einstimmig die Erklärung des Bündnisfalles nach Artikel 5 des NATO-Vertrags für den Fall eines Angriffs von außen:
»Der Rat stimmte überein, dass – falls festgestellt wird, dass dieser Angriff aus dem Ausland gegen die Vereinigten Staaten gerichtet wurde – er als eine Aktion angesehen wird, die unter Artikel 5 des Washingtoner Vertrages fällt, welcher festlegt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere der Bündnispartner in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen alle angesehen wird […] Artikel 5 des Washingtoner Vertrags legt fest, dass im Falle eines solchen Angriffs jeder Bündnispartner der Partei Beistand leistet, die angegriffen wurde, indem er die Maßnahmen ergreift, die für erforderlich erachtet werden. Dementsprechend stehen die NATO-Verbündeten der Vereinigten Staaten bereit, die Unterstützung zur Verfügung zu stellen, die als Konsequenz dieser barbarischen Akte erforderlich sein wird.«
Am nächsten Tag fand nachmittags im Reichstagsgebäude eine Fraktionssitzung der Grünen statt, in der ich über diesen Beschluss der NATO berichtete und seine möglichen Konsequenzen erläuterte. Die Fraktion stimmte der Erklärung des Bündnisfalles bei drei Gegenstimmen zu, unsere Vizepräsidentin Antje Vollmer enthielt sich der Stimme. Sie argumentierte vehement und massiv gegen eine militärische Teilnahme Deutschlands an einem möglichen Gegenschlag der USA in Afghanistan.
Der grün-protestantische Nationalpazifismus erhob also auch diesmal wieder sein Haupt, und damit wurde zu einem recht frühen Zeitpunkt in diesem sich abzeichnenden Konflikt um Afghanistan erneut jene Bruchlinie in Fraktion und Partei sichtbar, die bereits in der Kosovo-Krise nur mit allergrößten Anstrengungen überbrückt werden konnte. Mir war allerdings seit dem 11. September bewusst, dass jetzt ein weltpolitischer Orkan zu toben begonnen hatte und wir dadurch in Entscheidungszwänge hineingeraten würden, gegenüber denen der Kosovo-Krieg lediglich eine kleinere Herausforderung gewesen war.
Sofort nach dem ersten Schock hatte in den USA die fieberhafte Suche nach den Tätern und deren Auftraggebern begonnen, und anhand der Passagierlisten der entführten Flugzeuge wurden die amerikanischen Ermittlungsbehörden auch sehr schnell fündig. Binnen weniger Tage gelang es, den Hintergrund der Täter festzustellen, die Erkenntnisse führten eindeutig zu Osama bin Laden. Einen vernünftigen Zweifel, dass die Terrorattacke des 11. September von al-Qaida verübt worden war, konnte es danach nicht mehr geben.
Bei den Attentätern handelte es sich um junge Männer, die fast alle aus Saudi-Arabien, Ägypten und den Golf-Staaten stammten. Als ihr Anführer kristallisierte sich ein ägyptischer Staatsangehöriger namens Mohammed Atta heraus. Im Zuge der Ermittlungen stießen die amerikanischen Sicherheitsbehörden ebenfalls sehr schnell darauf, dass sich Atta und einige der anderen Terroristen des 11. September zuvor jahrelang in Deutschland aufgehalten hatten. Schlimmer noch, ganz offensichtlich hatten wesentliche Teile der Planung der Terroroffensive gegen die USA in Hamburg-Harburg stattgefunden, ohne dass die deutschen Sicherheitsbehörden davon irgendetwas mitbekommen hatten.
Es drängten sich für die Bundesregierung hochnotpeinliche Fragen auf, deren Beantwortung unsere Beziehungen zu den USA tief gehend erschüttern konnten. Hätte Deutschland die Terroranschläge vom 11. September verhindern können, ja verhindern müssen? Traf am Ende gar die deutschen Sicherheitsbehörden die Schuld oder wenigstens Mitschuld daran, dass der Angriff auf die Vereinigten Staaten nicht rechtzeitig unterbunden werden konnte? Diese Fragen stellten sich leider und zu Recht ganz unmittelbar an die Adresse der Bundesregierung. Und auch die US-Regierung, die angesichts der schrecklichen Ereignisse und des Versagens der amerikanischen Sicherheitsnetze unter einem erheblichen öffentlichen Druck stand, stellte diese Fragen in unsere Richtung sehr aggressiv.
Der Bundesregierung war die außenpolitische Dimension der Enttarnung der sogenannten »Hamburger Zelle« sofort bewusst, und auch gerade angesichts dieser schockierenden Erkenntnisse erwies sich die Position der »uneingeschränkten Solidarität« mit den USA, wie sie Gerhard Schröder für die Bundesregierung festgelegt hatte, bereits zu diesem sehr frühen Zeitpunkt als überaus weitsichtig.
Denn die Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit, in Parlament und Regierung war nach dem Schock und dem Grauen des 11. September nicht gerade auf eine differenzierte Analyse der Ereignisse ausgerichtet, sondern die Reaktionen würden dominiert von Entsetzen, Schmerz und Wut. Wenn Deutschland in den USA als Schuldiger oder auch nur Mitschuldiger für den 11. September angesehen werden würde, dann würden wir ein sehr großes außenpolitisches Problem bekommen. Eine tiefe Krise bis hin zu einem emotionalen Bruch in den deutsch-amerikanischen Beziehungen mit kaum absehbaren Folgen wäre dann nicht mehr auszuschließen.
Colin Powell hatte mir gegenüber zwar niemals irgendwelche Vorhaltungen gemacht, aber Innenminister Otto Schily hatte einige sehr unangenehme Gespräche hinter sich zu bringen. Allein die Tatsache, dass die Terroristen ihre Flugausbildung in den USA erhalten hatten, die für die Durchführung der Terrorattacke von entscheidender Bedeutung gewesen war, nahm etwas den Druck von Deutschland weg. Dennoch sollte der mehr oder weniger offen formulierte Vorwurf der amerikanischen Seite, dass Deutschland den 11. September hätte verhindern können, noch für lange Zeit in zahlreichen internen Gesprächen zwischen den Regierungen und auf den verschiedensten Ebenen eine Rolle spielen. Umso wichtiger war es daher, dass es an der »uneingeschränkten Solidarität« Deutschlands mit den USA nicht den geringsten Zweifel geben durfte.
Aber auch für die Bundesregierung und die deutschen Sicherheitsbehörden waren die Erkenntnisse über die »Hamburger Zelle« ein gewaltiger Schock. Wie hatte es passieren können, dass eine Gruppe der gefährlichsten internationalen Terrororganisation über längere Zeit hinweg Deutschland als Rückzugsraum nutzen konnte, ohne dass die deutschen Sicherheitsapparate davon etwas mitbekamen? Und noch wichtiger war damals die Antwort auf die Frage: Gab es am Ende noch weitere al-Qaida-Zellen in Deutschland, die hier als sogenannte »Schläfer« auf ihre Aktivierung warteten? Man wird die spätere Haltung der rot-grünen Bundesregierung und der deutschen Sicherheitsbehörden in zahlreichen Fragen der Terrorbekämpfung nicht verstehen können, wenn man diese überaus kritische Ausgangslage in der Zeit unmittelbar nach dem 11. September vergisst.
Die Krise des 11. September erforderte ein schnelles und abgestimmtes Handeln innerhalb der Bundesregierung, nicht nur auf der Ebene der hohen Beamten. Es galt täglich, ja bisweilen sogar stündlich, auf neue Erkenntnisse und Lagen politisch auf der höchsten Ebene zu reagieren. Das bis dahin in der Organisation der Bundesregierung vorgesehene Instrument des Bundessicherheitsrates erwies sich dabei als zu groß, zu unflexibel und zu durchlässig. Aus diesem Grund entschied der Bundeskanzler, informell ein sogenanntes »Sicherheitskabinett« einzurichten, das sich aus dem Bundeskanzler, dem Außen-, Innen- und Verteidigungsminister und dem Chef des Bundeskanzleramtes zusammensetzte. Hinzu kamen noch – je nach Bedarf – weitere Ressorts (etwa Finanzen) und die Präsidenten der Dienste, des BKA und die Spitze der Bundeswehr. Das Sicherheitskabinett hat sich in dieser Krise als entscheidendes politisches und operatives Steuerungsinstrument bewährt.
Am Nachmittag des 14. September fanden sich ca. 200000 Menschen vor dem Brandenburger Tor zu einer riesigen Solidaritätskundgebung mit den Vereinigten Staaten von Amerika ein. Sie standen schweigend dicht gedrängt auf dem Platz auf der Westseite des Brandenburger Tores und bis weit in die Straße des 17. Juni hinein. Ich befand mich mit den Spitzen von Parlament, Regierung und Parteien auf der Rednertribüne, ebenso war der neue amerikanische Botschafter Daniel Coats anwesend. Er war erst vor Kurzem in Berlin angekommen.
Bundespräsident Johannes Rau sprach auf dieser Solidaritätskundgebung für die Bundesrepublik Deutschland und drückte den USA und den betroffenen Familien die tief empfundene Anteilnahme und Solidarität aller Deutschen aus. An diesem Tag, so war mein Eindruck, trafen diese Sätze des Bundespräsidenten die wirkliche Stimmungslage in unserem Land und waren alles andere als leere Formeln. Allerdings schien der Bundespräsident in seiner Definition der Solidarität mit den USA weniger klar zu sein, als dies zuvor für den Bundeskanzler mit seiner Formel von der »uneingeschränkten Solidarität« gegolten hatte, denn der Bundespräsident äußerte sich verhalten kritisch zu einer sehr wahrscheinlichen militärischen Reaktion der USA.
Dies führte bei Gerhard Schröder zu einigem Stirnrunzeln und zu der öffentlichen Klarstellung in einem Interview, dass die Richtlinien der Politik vom Bundeskanzler bestimmt würden. Der Bundeskanzler befürchtete, dass in Washington der Eindruck entstehen könnte, so ernst wäre die »uneingeschränkte Solidarität« durch Deutschland nicht gemeint, und dass sich daraus möglicherweise negative außenpolitische Konsequenzen für unsere Allianz mit den USA ergeben würden. Zugleich wäre aber in diesen Tagen ein offensichtlicher Dissens zwischen Kanzler und Bundespräsident so ziemlich das Letzte gewesen, was sich Deutschland hätte erlauben dürfen, und insofern war ich erleichtert, dass sich dieser kurz aufflackernde Gegensatz in der Folgezeit als belanglos erweisen sollte.
Eine der zentralen Fragen auf dieser Seite des Atlantiks lautete: Wie würde Europa auf diesen Angriff auf seinen wichtigsten Partner reagieren? Es sollte sich sehr schnell erweisen, dass die EU auf eine solche Herausforderung weder politisch noch institutionell vorbereitet war. Vor allem die Führer der beiden »glorious nations« in der EU, Jacques Chirac und Tony Blair, reagierten sofort auf der nationalen Ebene. Die Instinkte dieser beiden europäischen Großmächte funktionierten in dieser fast schon existenziellen Krise der transatlantischen Beziehungen ausschließlich national.
Bundeskanzler Gerhard Schröder versuchte über den belgischen Ratspräsidenten Guy Verhofstadt, eine sofortige Sondersitzung des Europäischen Rates zustande zu bringen, aber diese dringende und richtige Initiative von Gerhard Schröder scheiterte zunächst am Unwillen Frankreichs und Großbritanniens – für Blair und Chirac war die Reaktion auf den 11. September zuerst und vor allem eine nationale und keine EU-Angelegenheit. Es kam am 14. September lediglich zu einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, der Präsidentin des Europäischen Parlaments und des Präsidenten der Kommission sowie des Hohen Vertreters für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU.
Wenn man im Rückblick nach den Gründen der späteren Spaltung Europas in der Irak-Krise sucht, so sehe ich eine der wichtigsten Ursachen im damaligen Unvermögen des Europäischen Rates, auf die historische Herausforderung des 11. September 2001 eine gemeinsame europäische Antwort zu finden. Denn eine solche gemeinsame Antwort der Staats- und Regierungschefs der EU hätte die Union in der Folgezeit zu einer strategischen Diskussion und mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch zu gemeinsamen Beschlüssen und einem gemeinsamen Vorgehen gezwungen. Genau dazu sollte es aber in den folgenden Monaten und Jahren nicht mehr kommen, stattdessen kam es in der heißen Vorbereitungsphase des Irak-Krieges zu einer von der Bush-Regierung betriebenen Spaltung Europas.
Ob eine einheitliche europäische Position im Jahr 2002 angesichts der sich verschärfenden Krise um den Irak überhaupt möglich gewesen wäre (etwa mehr Zeit für die VN-Inspektoren im Irak und die Bindung der Entscheidung über ein militärisches Vorgehen an die Ergebnisse dieser Inspektionen) und ob eine solche EU-Position die Politik der Regierung Bush gegenüber dem Irak positiv verändert hätte, werden wir niemals erfahren. Was wir allerdings heute wissen, ist, dass der Einfluss eines gespaltenen Europas in Washington gegen null ging.
Es bedarf dazu jedoch einer Präzisierung, um einem nahe liegenden Missverständnis vorzubeugen: Wären Schröder und Chirac in der Irak-Krise der Haltung Blairs, Aznars, Berlusconis und Barrosos gefolgt, nämlich den Weg der USA in diesen mutwillig vom Zaun gebrochenen Krieg politisch und militärisch zu unterstützen, so wäre der europäische Einfluss in Washington ebenfalls fast gleich null geblieben, wie die spätere Tragödie von Tony Blair demonstriert. Nur wenn Blair und die anderen europäischen Kriegsbefürworter sich Richtung Schröder und Chirac bewegt hätten, hätte sich vielleicht eine Möglichkeit jenseits des Krieges eröffnet. Realistischerweise muss man allerdings davon ausgehen, dass auch eine solche Entwicklung die Regierung Bush von ihrer Entschlossenheit zum Krieg gegen Saddam Hussein nicht abgebracht hätte, da sie auf Europa militärisch definitiv nicht und politisch fast nicht angewiesen war.
Nachdem die Initiative des Kanzleramts zu einem europäischen Sonderrat vorerst kein Ergebnis gebracht hatte, entschied der Bundeskanzler, dass ich für die Bundesregierung nach Washington und New York reisen und so unsere Verbundenheit mit den Vereinigten Staaten zeigen sollte. Der Kanzler selbst beabsichtigte, erst etwas später zu reisen. Und so flog ich am 18. September abends mit einer Regierungsmaschine von Berlin nach Washington, nachdem ich zuvor noch an einer Sitzung des Sicherheitskabinetts teilgenommen hatte. Im Reisegepäck hatte ich einen Brief des Kanzlers an den amerikanischen Präsidenten, den ich ihm bei einem Treffen im Weißen Haus persönlich überreichen würde.
Den ganzen Tag über hatte ich neben den Terminen in Berlin immer wieder Telefonate zu führen, um sowohl die innenpolitischen Entwicklungen zu beeinflussen als auch die internationale Abstimmung in dieser Krise voranzutreiben. Die Liste meiner Telefonate vom 18. September wird hier aufgeführt, weil sie beispielhaft ist für die Anspannung und Hektik der damaligen Tage und Wochen:
Kardinalstaatssekretär Sodano (der »Regierungschef« des Vatikan)
12.20 Uhr –Javier Solana (außenpolitischer Beauftragter der EU)
12.30 Uhr –Hubert Védrine (französischer Außenminister)
12.40 Uhr –Jossi Sarid (Vorsitzender der israelischen Meretz-Partei)
12.55 Uhr –Bundeskanzler
13.00 Uhr –Michael Steiner (Leiter der außenpolitischen Abteilung im Kanzleramt)
13.15 Uhr –Nabil Schaath (palästinensischer Minister für internationale Zusammenarbeit)
13.25 Uhr –Jossi Beilin (ehemaliger israelischer Chefunterhändler für die Regierung Rabin in Oslo)
14.00 Uhr –Rudolf Scharping (Verteidigungsminister)
14.05 Uhr –Kerstin Müller (Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag)
14.10 Uhr –Louis Michel (belgischer Außenminister)
14.15 Uhr –Achmed Maher (ägyptischer Außenminister)
14.17 Uhr –Ariel Scharon (israelischer Premierminister)
14.40 Uhr –Saeb Erekat (palästinensischer Chefunterhändler für den Friedensprozess und Vertrauter Arafats)
14.45 Uhr –Miguel Moratinos (Nahostbeauftragter der EU)
15.00 Uhr –Terje Rød-Larsen (Sondergesandter der VN für die palästinensischen Autonomiegebiete)
15.05 Uhr –Javier Solana (außenpolitischer Beauftragter der EU)
15.15 Uhr –Colin Powell (amerikanischer Außenminister)
16.20 Uhr –Jassir Arafat (Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde)
18.50 Uhr –Colin Powell (amerikanischer Außenminister)
Gegen 22.00 Uhr Ostküstenzeit landete ich auf dem militärischen Teil des Dulles International Airport in der Nähe der amerikanischen Hauptstadt, den die deutsche Luftwaffe regelmäßig benutzt.
Am Mittwoch, den 19. September 2001, begann für mich der Tag mit einem Zusammentreffen mit meinem Kollegen Colin Powell im State Department. Mittlerweile wusste man ja, dass der Terrorangriff von Osama bin Laden und seiner Gruppe ausgeführt worden war und dass der amerikanische Gegenschlag demnach in Afghanistan erfolgen würde. Im Zentrum des Delegationsgesprächs standen keineswegs die sich abzeichnenden militärischen Konsequenzen des 11. September, sondern vielmehr dessen politische Auswirkungen auf den Nahen und Mittleren Osten.
Daher konzentrierte sich das Gespräch erstens darauf, wie man Palästinenser und Israelis zu einem wirklichen Waffenstillstand bewegen könnte. Beide Delegationen waren der Meinung, dass die tragischen Ereignisse des 11. September neue Gestaltungschancen im Nahen Osten eröffnet hätten, die es unbedingt zu nutzen galt. Ob man dabei erfolgreich sein würde oder nicht, würde die Zukunft zeigen. Wichtig wäre es jetzt, so bald wie möglich ein Treffen zwischen Jassir Arafat und Außenminister Schimon Peres zustande zu bringen. Dazu bedurfte es aber der Zustimmung von Premierminister Scharon, die ohne Verbesserung der Sicherheitslage Israels nicht zu erreichen war.
Die Gespräche am Telefon mit Arafat und Scharon waren sehr zäh verlaufen, und es tat sich nichts wirklich Entscheidendes vor Ort, was die Lage verbessert und zu Optimismus Anlass gegeben hätte. Vor allem Arafat war mit freundlichen Versprechungen gegenüber den westlichen Mächten schnell bei der Hand, tatsächlich aber verringerte sich die militärische Konfrontation zwischen Palästinensern und Israelis kaum. Zudem zeigte sich Premierminister Scharon auch weiterhin völlig unbeweglich in seiner Grundposition, mit den Palästinensern unter Terror nicht zu verhandeln. In jener Zeit fiel mir immer wieder Heinrich Heine ein, der dazu Passendes gereimt hatte: »Worte, Worte, keine Taten …«.
Zweitens ging es um weitere regionale Akteure, wie den Iran, der mit den Taliban und al-Qaida verfeindet war und mit beiden noch mehr als eine Rechnung offen hatte. Wir waren der Auffassung, dass alles versucht werden sollte, um den Iran als direkten Nachbarn Afghanistans in die kommenden Ereignisse konstruktiv einzubinden und dafür alle bestehenden Kontakte zu nutzen. Die amerikanische Seite hatte dagegen keine Bedenken, verwies jedoch darauf, dass damit die anderen Konfliktpunkte zwischen dem Iran und den USA mitnichten erledigt wären.
Drittens behandelte das Gespräch die strategischen Konsequenzen des 11. September. Ich erläuterte meinem amerikanischen Kollegen die Haltung Deutschlands – dass Bundeskanzler Gerhard Schröder es mit seiner Formel von der »uneingeschränkten Solidarität« ernst meine und ausdrücklich auch die militärische Option für Deutschland in unsere Solidarität mit den USA einbezöge. Dieser Angriff habe zwar die USA getroffen, zugleich aber uns allen gegolten.
Colin Powell dankte für die deutsche Haltung und erläuterte, dass die USA die Notwendigkeit sähen, eine langfristige Strategie gegen den internationalen Terrorismus zu entwickeln. Man habe es nicht mit einem einfach zu erkennenden und zu treffenden Gegner zu tun. Die wichtigsten Elemente dieser Strategie müssten deshalb eine breite internationale Koalition sowie die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste, von Polizei und Justiz sein. Selbstverständlich werde auch der Einsatz militärischer Mittel notwendig sein (und das hieß konkret, dass die USA den Krieg gegen die Taliban in Afghanistan angehen würden). Darüber hinaus solle man sich nicht noch neue große Probleme schaffen. Deshalb wäre der Umgang mit Pakistan äußerst delikat, denn niemandem wäre damit gedient, wenn am Ende die Anforderungen an Pakistan das Land selbst destabilisieren würden.
Das Treffen mit Colin Powell endete mit einer kurzen Pressekonferenz vor dem State Department. Am frühen Nachmittag war ich im Pentagon mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister der USA, Paul Wolfowitz, zu einem Gespräch verabredet. Das riesige fünfeckige Gebäude des amerikanischen Verteidigungsministeriums war an einer Seite von einem der Flugzeuge am 11. September schwer beschädigt worden. Dabei waren viele Mitarbeiter des Ministeriums ums Leben gekommen, und insofern hatte gerade im US-Verteidigungsministerium die Frage der Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September auch eine sehr persönliche Dimension.
Diese persönliche Betroffenheit fand man aus verständlichen Gründen überall in Washington und New York, sie wurde in Europa nur allzu leicht vergessen. Die Reaktion auf den Terrorangriff vom 11. September war bei den amerikanischen Entscheidungsträgern, ihren Mitarbeitern und in der Bevölkerung nicht nur eine politische Frage. Die Bush-Regierung sollte später dann diese Stimmung in der Bevölkerung, die nach Bestrafung der Täter und Rache für die Toten von New York und Washington rief, für ihre innen- wie außenpolitischen Zwecke ausnutzen, um einen permanenten psychologischen Belagerungszustand im Innern und eine Legitimation für den Krieg gegen den Irak zu schaffen. Das alles war aber bei meinem damaligen Besuch in Washington nicht wirklich abzusehen.
Die Begegnung mit Paul Wolfowitz fand in Gestalt eines Delegationstreffens statt. Der stellvertretende US-Verteidigungsminister erläuterte uns dabei die strategischen Konsequenzen, welche die USA aus dem 11. September zu ziehen gedächten. Es gäbe weltweit über sechzig Staaten, die Terrorismus entweder direkt einsetzten, Terroristen Unterschlupf gewährten oder zu ihrer Finanzierung beitrügen. Die USA würden dies zukünftig alles als Terrorismus betrachten, gegen den man plane, entschlossen vorzugehen. Es werde dabei keine Rücksichtnahme und keine falschen Differenzierungen mehr in diesem weltweiten Kampf geben. Die USA würden sich alle diese Staaten vornehmen, einen nach dem anderen.
Dabei werde die Frage der einzusetzenden Mittel ausschließlich entlang ihrer Zweckmäßigkeit entschieden. Es müsste dabei keineswegs immer um militärische Mittel gehen. Der Zerstörung der finanziellen Netze des internationalen Terrorismus käme dabei eine große Bedeutung zu.
Ich erläuterte unsere Haltung, vor allem unsere Solidarität mit den USA. Der 11. September sei aus unserer Sicht ein historischer Wendepunkt, der eine langfristige Strategie notwendig machen würde. Dazu gehöre auch, eine Lösung existierender Regionalkonflikte energisch anzugehen, vorneweg den Nahostkonflikt. Dort müsse man jetzt unbedingt den Friedensprozess voranbringen. Zudem hielten wir es für geboten, mit den gemäßigten Kräften im Iran zusammenzuarbeiten und diese einzubinden.
Auf die Frage nach dem Irak und welche Rolle er in der amerikanischen Anti-Terror-Strategie spiele, reagierte Wolfowitz abwehrend. In den Medien hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob Osama bin Laden vom Irak unterstützt worden sei, aber ich nahm diese nicht allzu ernst. Ich wusste aber um die ganz besondere Bedeutung des Irak (»unfinished business«) für die Regierung in Washington, und daher stellte ich diese Frage. Wolfowitz’ Antwort gab keinen direkten Anlass zur Sorge.
Unter der direkten Nennung von Iran und Syrien wies Paul Wolfowitz allerdings darauf hin, dass man viel zu lange hingenommen habe, dass diese Staaten diversen Terrorgruppen das Agieren erleichtert hätten. Es sei auch ein Fehler gewesen, den palästinensischen Terrorismus zu dulden. Hier müsse in Zukunft härter vorgegangen werden. Zur allgemeinen Strategie gegenüber dem Terrorismus merkte Wolfowitz noch an, dass es bei der Frage der Täterschaft nicht um eine juristische Beweislage gehen werde, sondern dazu Hinweise, Informationen und Indizien ausreichen würden.
Im Anschluss an dieses Treffen begleitete uns der stellvertretende Verteidigungsminister noch zu dem zerstörten Teil des Gebäudes. Die Aufräumarbeiten waren in vollem Gange, und dennoch war der Eindruck für den Betrachter entsetzlich. Dort begegnete ich auch dem ehemaligen und späteren Vorsitzenden des Streitkräfteausschusses des US-Senats, dem Republikaner John Warner (Virginia), den ich von einer früheren Begegnung her kannte, und der New Yorker Senatorin Hillary Clinton. Hier, an diesem Ort, wo so viele unschuldige Menschen am 11. September durch Terroristen ihr Leben verloren hatten, verstand ich noch sehr viel besser die tiefe Verletzung, den Schmerz, die Wut und auch die grimmige Entschlossenheit unserer amerikanischen Partner und Freunde. Der 11. September hatte für sie alle auch eine sehr persönliche Dimension. Wäre Vergleichbares in Deutschland passiert, so wäre es mir wohl ebenso ergangen.
Nach dem Gespräch mit Paul Wolfowitz versuchte ich, auf der Fahrt zurück nach Washington meine Gedanken und Eindrücke aus dem letzten Gespräch zu ordnen. Irgendwie hatte es mich innerlich aufgewühlt und in Unruhe versetzt. Wenn die von Wolfowitz dargelegte Strategie von den USA tatsächlich umgesetzt würde, dann würden die Welt und auch die USA innerhalb weniger Jahre sehr anders aussehen als zuvor. Mir war nach diesem Gespräch klar geworden, dass sich meine schlimmsten Befürchtungen durchaus bewahrheiten könnten. Was da an amerikanischer Reaktion auf die Welt – und damit auch auf Deutschland als einem engen Alliierten der USA – zukommen würde, bedeutete nach den Erläuterungen des stellvertretenden Verteidigungsministers der USA nichts Geringeres, als dass die Reaktion auf den 11. September mitnichten mit Afghanistan, der Entmachtung der Taliban und der Zerstörung von al-Qaida beendet sein würde. Vielmehr hatte er soeben uns gegenüber die Konturen eines Weltkriegs neuen Typs gegen den internationalen Terror und seine staatlichen und nichtstaatlichen Helfershelfer und Unterstützer skizziert. Denn was sonst konnte es heißen, wenn die USA weltweit gegen mehr als sechzig Staaten vorzugehen beabsichtigten? All dies war zwar schon bei meinen Gesprächen und Telefonaten mit Colin Powell angeklungen, aber Paul Wolfowitz hatte Klartext gesprochen. Seine Strategie war sehr viel radikaler und weitgehender und wohl auch mit dem gängigen Völkerrecht schwer in Übereinstimmung zu bringen.
Ein solch globaler Anti-Terror-Krieg würde zudem keine Sache von einigen Monaten oder wenigen Jahren sein, sondern würde sehr viel mehr Zeit verlangen. Nach dem absehbaren Krieg gegen die Terrorbasis Afghanistan würden aber der Schock und auch die Wut in den USA und in der Weltöffentlichkeit über die Anschläge mit Sicherheit abnehmen. Um eine solche globale und langfristige Strategie durchzusetzen, würde die US-Regierung daher aus politischen Mobilisierungsgründen gegenüber der einheimischen und internationalen Öffentlichkeit eine allseits bekannte und zwingende Bedrohung nebst personifizierter Feindbilder brauchen. Ein flüchtiger oder gar toter Osama bin Laden und eine kaum zu greifende, medial nicht darzustellende Terrororganisation würden dazu niemals ausreichen. Wer also dann?
Die Antwort war nicht besonders schwer zu finden, sondern lag auf der Hand. Es konnte meiner Meinung nach nur einen ernsthaften Kandidaten für diese Rolle des Schurken geben, und der hieß Saddam Hussein. Wenn die USA allerdings ohne zwingende Beweise für dessen Verstrickung in den 11. September militärisch angreifen würden, so würde die gesamte Anti-Terror-Strategie eine völlig andere Dimension bekommen, nämlich zu einer Strategie des militärisch erzwungenen Regimewechsels (»Regime Change«) im Nahen Osten und weltweit werden. Und der Feind würde dann binnen Kurzem nicht mehr der religiös fundierte Terrorismus im Nahen und Mittleren Osten sein, sondern eine gefährliche Verbindung von religiösem Fundamentalismus und revolutionärem Nationalismus.
»Nein«, versuchte ich mich auf der Fahrt zurück nach Washington in meinem inneren Monolog zu beruhigen, »so dumm kann die US-Regierung nicht sein.« Gewiss, Saddam Hussein war ein übler Diktator, um den es nicht schade wäre, wenn er schon gestern verschwunden wäre. Aber er und seine irakische Baath-Partei waren überzeugte Laizisten und arabische Nationalisten und deshalb Todfeinde der religiösen Fundamentalisten. Die Priorität musste jetzt al-Qaida und Osama bin Laden heißen und nichts anderes! Dass Saddam Hussein Terroristen unterstützt hatte, war seit Langem bekannt. Aber das waren die nach dem 11. September altmodisch wirkenden palästinensischen Terrorgruppen eines Abu Nidal und ähnliche aus den siebziger und achtziger Jahren. Mir war aus der Vergangenheit nicht der geringste Hinweis unserer Dienste bekannt, dass es auch nur einen Kooperationsversuch zwischen dem Irak und Bin Laden gegeben oder die USA dies behauptet hätten.
Welchen anderen Schurken könnte Wolfowitz aber ansonsten aus der Tasche ziehen, um seine Strategie durchsetzen zu können? Es gab keinen anderen, und das erfüllte mich mit großer Unruhe. Und hatte nicht Colin Powell von Anfang an davon gesprochen, dass er in der Sache Irak dringend etwas vorweisen müsse und er deshalb mit Hochdruck an verbesserten und intelligenteren Sanktionen arbeiten würde? Ich konnte mir selbst meine Sorgen nicht ausreden.
Der nächste Termin war die Begegnung mit Präsident Bush im Weißen Haus. Der Präsident befand sich dabei in Begleitung seiner Sicherheitsberaterin Condoleezza (Condi) Rice und einiger anderer Mitarbeiter. George Bush machte einen angegriffenen Eindruck, was angesichts der Ereignisse und der persönlichen Belastung der letzten Tage nicht erstaunen konnte. Und auch im Weißen Haus wog die persönliche Dimension des 11. September sehr schwer. War das in Pennsylvania von mutigen Passagieren vorzeitig zum Absturz gebrachte Flugzeug UA 93 für einen Angriff auf das Weiße Haus bestimmt gewesen? Wenn ja, so der Präsident, dann würden seine Frau Laura Bush, Condi Rice und die meisten der hier versammelten Mitarbeiter wohl nicht mehr am Leben sein.
Ich übergab dem amerikanischen Präsidenten den Brief des Bundeskanzlers. Ich erläuterte ihm unsere Haltung der »uneingeschränkten Solidarität« unter Hinweis auf die Erklärung des Bundeskanzlers und den Beschluss des Deutschen Bundestages. Dies hieße für uns, dass keine Option ausgeschlossen wäre, auch nicht die militärische. Ich wies auch hier auf die Notwendigkeit hin, jetzt im Nahen und Mittleren Osten die vorhandenen Konflikte einer Lösung zuzuführen und zu versuchen, den Iran einzubinden, um so einer weiteren Radikalisierung und Unterstützung des Terrorismus die Grundlage zu entziehen. Zudem machte ich deutlich, wie wichtig es sei, die Menschen in Europa, die heute so voller Sympathie für die USA wären, bei den vor uns liegenden schwierigen Entscheidungen mitzunehmen. Eine baldige Reise des Präsidenten nach Europa, etwa zu einem NATO-Gipfel oder zu einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der EU, und eine Rede an die Europäer wären dafür sicherlich sehr hilfreich.
Der Präsident bedankte sich für den Brief und die deutsche Solidarität. Diesen Dank an Deutschland werde er auch in einer Rede vor dem Kongress am folgenden Tag wiederholen. Anschließend erläuterte der Präsident die strategischen Konsequenzen, welche die USA aus dem Terrorangriff vom 11. September zu ziehen gedächten. Dabei kam er auf eine neue Doktrin zu sprechen, die er auch als eine solche bezeichnete: Wer Terroristen beherberge, werde zukünftig wie ein Terrorist behandelt. Ansonsten bewegten sich seine strategischen Erläuterungen entlang derselben Linien, die wir bereits zuvor im State Department von Colin Powell und im Pentagon von Paul Wolfowitz gehört hatten, ohne aber die Deutlichkeit und Radikalität des Letzteren zu erreichen.
Am nächsten Morgen, Donnerstag, 20. September 2001, flogen wir dann von Washington nach New York. Regenwolken hingen tief über der Stadt. Das Wetter passte sehr gut zu meiner Stimmungslage. Die Stadt wirkte verändert, verletzt, verstört. Ich spürte, dass der Terroranschlag vom 11. September mein Bild von dieser großartigen Stadt, die ich so sehr liebe, grundsätzlich verändert hatte.
Es hatte für mich immer zwei New York gegeben: Einerseits das reale New York, zwar in den USA gelegen, aber alles andere als eine typische nordamerikanische Metropole. New York City ist vielmehr die einzige wirkliche Weltstadt, die ich kenne. Zuwanderer aus allen Nationen leben in dieser Stadt, leben in einem faszinierenden Schmelztiegel der Kulturen zusammen – und es funktioniert. Für den Sitz der Vereinten Nationen könnte es gerade aus diesem Grund weltweit keinen besseren Standort geben.
Und andererseits gab es mein geträumtes New York, das Tor zur Freiheit, zur Neuen Welt. Millionen europäischer Auswanderer haben hier zum ersten Mal den amerikanischen Kontinent betreten. In dieser Stadt begann für sie der Traum von Freiheit und Wohlstand, von einem neuen Leben jenseits von Krieg, Diktatur, Unterdrückung und Elend in jener Alten Welt namens Europa. Die Freiheitsstatue am Hafeneingang von New York symbolisiert bis heute diesen Traum.
Jahre später, als ich mit meiner Familie in den USA lebte, machten wir einen touristischen Ausflug nach Liberty Island und Ellis Island im Hafen von New York. Und als wir dort in der langen Schlange vor den Ausflugsschiffen warteten, gemeinsam mit Menschen aus aller Herren Länder, da bekamen wir eine leise Ahnung davon, wie sich wohl die Einwanderer in früheren Zeiten in den Schlangen auf Ellis Island gefühlt haben mochten, als sie dort auf die Abfertigung durch die US-Einwanderungsbehörde warteten. Die damals allerdings alles entscheidende Frage, ob man von den Beamten akzeptiert oder aber nach Europa zurückgeschickt werden würde, stellte sich für uns nicht. Und genauso wenig machten wir die Erfahrung von Furcht und Elend, welche die meisten Einwanderer damals über den Atlantik getrieben hatte.
Bei der Fahrt vom Flughafen nach Manhattan fiel mir die veränderte Kulisse Manhattans gar nicht sofort auf. Die Stadt sah wie immer aus – fast. Aber das Empire State Building in Midtown Manhattan stand plötzlich so alleine da und wirkte viel größer als sonst. Und erst dann bemerkte ich, dass etwas fehlte – die hoch aufragenden Zwillingstürme des World Trade Centers weiter unten, fast an der Spitze Manhattans. New York war jetzt also, wie all die großen europäischen Städte in der Vergangenheit, auch zu einer Stadt »unter Feuer« geworden. Der 11. September hatte nicht nur mehrere Tausend Menschenleben in den beiden Hochhäusern zerstört, er schien der Stadt auch etwas von ihrem Traum genommen zu haben.
In New York, am Sitz der Vereinten Nationen, warteten Gespräche mit dem VN-Generalsekretär Kofi Annan und mit dem russischen Außenminister Igor Iwanow auf mich. Zudem würde ich noch ein Betreuungszentrum für Angehörige der Opfer und der zahlreichen Vermissten sowie eine Wache der New Yorker Feuerwehr besuchen, die am 11. September in den einstürzenden Türmen die Mitglieder einer ganzen Schicht verloren hatte, und dort eine Geldspende der Bundesregierung für die Hinterbliebenen überreichen.
Die beiden Treffen mit dem russischen Außenminister und mit Generalsekretär Kofi Annan fanden im VN-Gebäude an der First Avenue statt. In beiden Gesprächen ging es vor allem um die Konsequenzen, die aus dem 11. September zu ziehen waren. Ich war mir mit beiden Gesprächspartnern einig, dass alles getan werden musste, um jetzt nicht in den USA das Gefühl entstehen zu lassen, dass die Menschen in ihrem Schmerz und in ihrem Zorn alleine wären. Die Konsequenzen aus dem Terrorangriff vom 11. September mussten deshalb unbedingt durch die internationale Gemeinschaft gemeinsam gezogen werden. Und dabei würden auch auf die Vereinten Nationen weitreichende Beschlüsse zukommen, die es im Kampf gegen den Terrorismus im Sicherheitsrat zu treffen galt.
So gab es noch immer keine völkerrechtlich verbindliche Terrorismusdefinition oder gar eine Konvention gegen den Terrorismus. Denn was für den einen Staat Terror war, galt in dem anderen Staat als legitimer Freiheitskampf. So lag zwar eine Initiative des von Terroranschlägen geplagten Indien für ein Übereinkommen gegen den internationalen Terrorismus vor, aber genau an diesem Beispiel wurde zugleich die große Schwierigkeit sichtbar, eine Einigung zu erzielen. Denn was für Indien in der seit der Gründung der beiden Staaten in mehreren Kriegen mit Pakistan umkämpften und geteilten Region Kaschmir nichts als brutaler Terrorismus ist, der rücksichtslos und auch unter Inkaufnahme schwerster Menschenrechtsverletzungen bekämpft werden muss, ist für Pakistan der legitime Widerstand der Bevölkerung Kaschmirs, die mehrheitlich dem muslimischen Glauben angehört, gegen die indische Besatzung, der jede Unterstützung Pakistans verdiene.
Kofi Annan hielt jetzt allerdings den Moment für gekommen, um eine solche Anti-Terrorismus-Konvention zu erarbeiten. Die USA würden zukünftig auf einer generellen Ächtung des Terrorismus bestehen, und darauf müssten die Vereinten Nationen reagieren, wenn diese Definition nicht unilateral und den jeweiligen nationalen Interessen und Konfliktlagen folgend ausfallen sollte. Die Aufgabe der Weltgemeinschaft müsse es jetzt sein, einen völkerrechtlichen Rahmen für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu schaffen, um so ein einseitiges Vorgehen mit möglicherweise gefährlichen Folgen für die regionale und internationale Stabilität unnötig zu machen.
Insgesamt wurde in den Gesprächen das bisherige Vorgehen der amerikanischen Regierung als überlegt und besonnen bewertet, auch wenn ich mir nicht wirklich klar darüber war, wieweit hier, auch bei mir selbst, der Wunsch der Vater des Gedankens war. Ansonsten ging es in dem Treffen mit dem Generalsekretär noch um die Bewertung der aktuellen Lage im Nahen Osten und auf dem Balkan.
Bei dem kurzen Treffen mit dem russischen Außenminister wurde nahezu die identische Agenda erörtert. Russland war offensichtlich entschlossen, die USA in ihrem Kampf gegen den Terrorismus vorbehaltlos zu unterstützen und dabei auch ein neues Kapitel in den amerikanisch-russischen Beziehungen aufzuschlagen, das endgültig die Jahrzehnte der Rivalität der beiden Supermächte hinter sich lassen sollte. Der Kalte Krieg wäre jetzt tatsächlich zu Ende, erklärte mein russischer Kollege. Auch für Russland war es von entscheidender Bedeutung, das Vorgehen gegen den internationalen Terrorismus in einem multilateralen Rahmen zu halten.
Für Moskau war klar, dass die USA militärisch in Afghanistan zuschlagen würden, und auch in der russischen Regierung schien man sich große Sorgen um einen möglichen Alleingang der USA und dessen Folgen für die regionalen Gleichgewichte und die international gültigen Regeln zu machen. Zudem war mit den Händen zu greifen, dass sich der russische Präsident Putin, der einen schmutzigen Anti-Terror-Krieg in Tschetschenien führte, für den er im Westen heftig kritisiert wurde, durch eine internationale Koalition gegen den Terror zumindest ein Nachlassen des internationalen Drucks und mehr Verständnis des Westens für seine Lage im Kaukasus erhoffte.
Nach diesen Gesprächen fuhren wir auf die andere Seite Manhattans hinüber, an das Ufer des Hudson, und besuchten dort ein von der Stadt New York eingerichtetes Betreuungszentrum für die Angehörigen der Opfer. Dies war auch die Anlaufstelle für viele Menschen, die nach ihren vermissten Angehörigen suchten. Die Wände waren über und über bedeckt mit Vermisstenanzeigen und verzweifelten Bitten um Nachrichten und Informationen zum Verbleib der geliebten Person. Die Welt der Diplomatie mit ihren Gesprächen und Abwägungen lag plötzlich weit hinter mir, und stattdessen wurden der ganze Schmerz, das Entsetzen und die fassungslose Trauer der Angehörigen und die menschlichen Tragödien, die sich am 11. September in den beiden Türmen abgespielt haben mussten, plötzlich konkrete Wirklichkeit. Auf der Etage in dem großen Gebäude der New Yorker Hafenverwaltung, auf der wir uns aufhielten, sammelte sich spontan eine Gruppe von Menschen und fing an, die amerikanische Nationalhymne zu singen, als wenn sie sagen wollten, wir lassen uns nicht unterkriegen, nicht durch den Terror und nicht durch all den Schmerz und das Leid, das uns zugefügt wurde. Ich hörte schweigend zu und war tief gerührt.
Anschließend besuchten wir eine Feuerwache, die am 11. September im einstürzenden Südturm fünfzehn Feuerwehrmänner verloren hatte. Nur einen von ihnen hatte man bisher tot bergen können. Die anderen blieben unauffindbar unter den Trümmerbergen begraben. Als an jenem schrecklichen Dienstag der Alarm in der Feuerwache ausgelöst wurde, waren sie auf ihren Löschfahrzeugen losgerast, um zu helfen, und hatten alle nicht überlebt. Der Bürgersteig vor der Wache war über und über mit Blumen, Kerzen, selbst gemalten Bildern von Kindern und Briefen der Anteilnahme von Bürgern übersät.
Es war für mich ein weiterer sehr ergreifender Augenblick, der mir die Tränen in die Augen trieb, und als ich dem Captain der Feuerwache unsere Spende für den Solidaritätsfonds für die Familien der umgekommenen Feuerwehrmänner überreichte, drückten wir uns stumm und bewegt die Hand. Beiden standen uns die Tränen in den Augen.
Mein Besuch in dem grauen, verregneten und schwer verwundeten New York, die unmittelbare Begegnung mit dem Leid, der Trauer, aber auch der Wut und Entschlossenheit der betroffenen Menschen hatte mich tief berührt und auch emotional nachvollziehen lassen, wie viele einzelne Tragödien sich am 11. September in dieser Stadt ereignet hatten. Tragödien, die einen konkreten Menschen mit einem Namen, einem Gesicht, einer Familie aus dem Leben gerissen hatten. Wut kam dabei in mir auf über die Terroristen und ihre Hintermänner, die dieses barbarische Verbrechen zu verantworten hatten. Amerika würde zurückschlagen, dessen war ich mir nach diesem Tag in New York mehr denn je gewiss. Und wir Deutsche würden dabei sein müssen. Das Wort des Kanzlers von der »uneingeschränkten Solidarität« hatte für mich an diesem Nachmittag in Manhattan eine nicht nur politische, sondern auch sehr menschliche Bedeutung erhalten.
Am Abend flogen wir dann von New York aus zurück nach Berlin. Die beiden letzten Tage hatten mich innerlich aufgewühlt. Was würde die Zukunft bringen? 1948 geboren, war ich ein Kind des Kalten Krieges, aufgewachsen im Schatten der Ruinen des Zweiten Weltkriegs. Kriegsangst war für mich als Kind durchaus noch eine reale Erfahrung gewesen. Die sich immer wiederholenden Erzählungen der Erwachsenen, die Ruinen, die Bilder der gefallenen oder vermissten jungen Soldaten in den Wohnzimmern, Kriegsgräber an den Straßen, alte Waffen und Munition – all das gehörte zu meiner Kindheit. Und auch die großen Krisen im Europa der fünfziger und sechziger Jahre machten uns Angst: der Aufstand in Ungarn, der Bau der Mauer in Berlin und schließlich die Kuba-Krise. Bis zu den Balkankriegen in den neunziger Jahren war meiner Generation jedoch die Erfahrung eines heißen Krieges in Europa erspart geblieben.
Sollte sich das jetzt ändern? Würde der Terrorismus auch in Europa, in Deutschland zuschlagen? Hatte der Kalte Krieg lediglich über fünf Jahrzehnte hinweg eine atypische Situation geschaffen, die uns in dem Glauben ließ, dass Krieg und Zerstörung auf unserem Kontinent für immer der Vergangenheit angehören würden? Zwar hatten bereits die Balkankriege diesen Glauben nachhaltig erschüttert, aber würde jetzt, mit dem 11. September, erneut eine Epoche von Kriegen auch für Europa beginnen? Würde sich aus dem Angriff der al-Qaida auf New York und Washington tatsächlich ein neuer Typus von Weltkrieg entwickeln, wie ihn Paul Wolfowitz im Pentagon unserer Delegation gegenüber analysiert hatte? Welchen menschlichen, moralischen und politischen Preis würde die Zukunft von uns verlangen? Und was war zu tun?
An Schlaf war mit all diesen Fragen, die mir ununterbrochen durch den Kopf gingen, nicht zu denken, und so setzte ich mich in düsterer Stimmung während des nächtlichen Flugs über den Atlantik in den hinteren Teil der Kabine zu den mitreisenden Journalisten. Dort wurde ich dann auch danach gefragt, wie ernst ich das Risiko einschätzte, dass die USA Saddam Hussein angreifen würden.
Ich sähe zwar keine unmittelbare Gefahr, gab ich zur Antwort, denn Saddam Hussein wäre zwar ein übler Diktator und Schurke, aber nichts spräche aus meiner Kenntnis für eine Verbindung von Islamisten vom Schlage Osama bin Ladens mit dem Irak Saddam Husseins. Ganz im Gegenteil wären diese beiden Strömungen des arabischen Radikalismus ideologische Todfeinde, die sich im wahrsten Sinne des Wortes bis aufs Messer bekämpften. Bei der Baath-Partei Saddam Husseins handelte es sich eindeutig um eine nichtreligiöse, nationalistische Partei, die von den Islamisten als Verräter am Islam angesehen wurde, während die regierenden Baathisten in Syrien und im Irak die religiösen Radikalen einsperren, foltern und hinrichten ließen.
Sehr viel später dann, in der unmittelbaren Vorbereitungsphase des Krieges der USA gegen den Irak, sollte eine islamistische Gruppierung im Irak seitens der US-Kriegspropaganda benutzt werden, um einen Zusammenhang zwischen dem 11. September und Saddam Hussein zu konstruieren, aber auch dieser Versuch scheiterte, denn jene Gruppe, die es tatsächlich gab, agierte eben nicht in Saddams Herrschaftsbereich, sondern vielmehr im kurdischen Norden des Irak, wo das Regime in Bagdad keinerlei Kontrolle mehr ausübte.
Gleichwohl war ich bereits damals der Überzeugung, dass die konkrete Gefahr bestand, dass die USA eher früher als später den Irak angreifen würden. Denn sollten sie tatsächlich den globalen Krieg gegen den Terror ernsthaft angehen, dann bräuchten sie einen wohlvertrauten und in den Medien vorzeigbaren Schurken. Osama bin Laden und ein kaum sichtbares terroristisches Netzwerk würden für eine solche Mobilmachung der amerikanischen Öffentlichkeit nur sehr eingeschränkt taugen.
Ich war auch schon damals der Meinung, dass ein Krieg gegen den Irak ein fataler Fehler, ja eine große politische Dummheit wäre, da Amerika aus dem legitimen und nahezu von der ganzen Weltöffentlichkeit und Staatengemeinschaft unterstützten Kampf gegen den islamistischen Terrorismus eine Konfrontation mit dem arabischen Nationalismus machen würde. Und diesen Kampf konnte Amerika mit seinen überlegenen militärischen Machtmitteln gewiss kurzfristig militärisch für sich entscheiden, politisch aber niemals gewinnen. Zudem würde mit einem solchen falschen Krieg dem islamistischen Terrorismus nur eine neue Legitimation geliefert werden, die ihn stärken und nicht schwächen oder gar besiegen helfen würde. Leider sollte ich mit meinen damaligen nächtlichen Befürchtungen ziemlich richtigliegen.
Am Freitagmorgen war ich zurück in Deutschland. In meinem Büro warteten bereits die Vorsitzenden der Grünen, die Fraktionsvorstände sowie die grünen Kabinettsmitglieder auf mich, die ich über meinen Besuch in Washington und New York und meine Eindrücke unterrichtete. Wir waren alle sehr besorgt, was uns die nächste Zukunft wohl an Herausforderungen für die rot-grüne Koalition bringen würde, denn es war nunmehr Gewissheit, dass die USA in Afghanistan zurückschlagen würden. Wie würde sich Deutschland daran militärisch beteiligen, und was würde das für die Stabilität der Koalition heißen? Entscheidungen waren keine zu treffen, aber ich betonte erneut, dass wir uns im Falle des höchst wahrscheinlichen Falles nicht heraushalten dürften und könnten.
Anschließend unterrichtete ich den Bundeskanzler im Kanzleramt unter vier Augen über meine Reise, und daran schloss sich eine Sitzung des Sicherheitskabinetts an. Am späten Nachmittag flog ich dann gemeinsam mit dem Bundeskanzler nach Brüssel zu einer Sondersitzung des Europäischen Rates. Auf dieser Sitzung beschloss die EU einen weitreichenden »Aktionsplan zur Bekämpfung des Terrorismus«, der die Felder der Innen- und Rechtspolitik, der Überwachung der Finanzströme und der Außen- und Sicherheitspolitik umfasste. Gegen 23.00 Uhr flogen wir von Brüssel zurück nach Berlin mit einem Zwischenstopp in Hannover, wo Gerhard Schröder ausstieg. Um 2.30 Uhr war ich endlich wieder in meiner Wohnung in Berlin und wollte nur noch schlafen.
Am Sonntag grüßte mich dann erneut das wochenendliche rot-grüne Murmeltier, denn beide Regierungsparteien hatten einen weiteren herben Rückschlag auf Länderebene zu verdauen. In Hamburg fanden an diesem Tag Bürgerschaftswahlen statt, und ein weiteres rot-grün regiertes Bundesland versank politisch, diesmal in der Elbe. Vor allem meine Partei erlitt eine krachende Wahlniederlage mit einem Minus von über 5 Prozentpunkten, während die SPD sogar ganz leicht zulegte. Die CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Ole von Beust hatte zwar ebenfalls ordentlich an Prozenten verloren, eroberte aber dennoch gemeinsam mit der FDP und der neu gegründeten rechtspopulistischen »Partei Rechtsstaatlicher Offensive« unter dem Richter Ronald Barnabas Schill die Mehrheit in der Hamburgischen Bürgerschaft. Schill war eine bizarre Figur, der in der Boulevardpresse wegen einiger seiner Urteile auch »Richter Gnadenlos« genannt wurde und mit einer populistischen Kampagne gegen Straftäter und Drogenhändler einen erdrutschartigen Wahlsieg (19,4 Prozent!) für seine zum ersten Mal antretende Partei erzielte. Die Schill-Partei war damit der eigentliche Wahlsieger und verhalf der CDU im Hamburger Rathaus an die Macht.