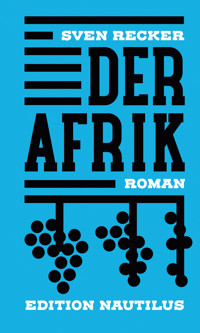
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Afrik – so rufen sie ihn, der zurückgezogen in einer Hütte oberhalb von Pfaffenweiler lebt. Das badische Weindorf hatte in Zeiten von Missernten und Hungerkrisen gehofft, seine Armen ein für allemal los zu sein, als es ihnen 1853 die Ausreise nach Algerien finanzierte und ihnen dort ein Paradies versprach – Rückkehr ausgeschlossen. Um das Geld für die Überfahrt aufzubringen, hatte die Gemeinde einen Wald abholzen lassen und die Fläche an Winzer verkauft. Den Weinberg nannten sie Afrika. Doch in Algerien erwartete die Aussiedler Hunger, Krankheit und Krieg. Unter ihnen war auch Franz Xaver Luhr mit seiner Mutter. Er ist als Einziger zurückgekehrt und bereitet nun seine Rache vor: Seit Jahrzehnten treibt er einen Stollen in den Weinberg, um ihn eines Tages zu sprengen. Er ist fast fertig. Doch eines Wintertags sitzt ein Junge auf der Bank vor seiner Hütte, bei sich nur einen Zettel mit den Worten: Je m'appelle Jacob. Tu es famille. Behutsam und berührend erzählt Sven Recker, auf wahren Begebenheiten basierend, von der Annäherung zweier Sprachloser und setzt den Ausgestoßenen von Pfaffenweiler ein literarisches Denkmal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SVEN RECKER wurde 1973 in Bühl/Baden geboren und lebt in Berlin. Der Afrik ist sein dritter Roman. Seine Bücher Krume Knock Out und Fake Metal Jacket wurden als Hörspiele und als Theaterstück inszeniert. 2015 las er mit einem Auszug aus seinem Debütroman Krume Knock Out bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.
Bildnachweise
S. 6/7 (Karte): © Martina Leykamm
S. 57 (Hafen von Algier) und S. 155 (Gruppenbild):
aus: Beiträge zur Volkskunde in Baden-Württemberg,hg. v. Landesstelle für Volkskunde Freiburg,Badisches Landesmuseum Karlsruhe u. Landesstellefür Volkskunde Stuttgart, WürttembergischesLandesmuseum Stuttgart, 1985S. 71 (Buffalo-Bill-Anzeige): aus: Karlsruher Zeitung,© Karlsruhe, Badische LandesbibliothekS. 157 (Denkmal): © Sven Recker
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus 2021
Deutsche Erstausgabe September 2023
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert
www.majabechert.de
Porträt des Autors Seite 2:
© Philipp Spalek
1. Auflage
ISBN 978-3-96054-325-1
Inhalt
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
Quellennachweis und Anmerkungen
Mehrere Missernten, verbunden mit einem starken Bevölkerungswachstum und politischen Unruhen, führen in Deutschland im 19. Jahrhundert zu Not und Armut. Viele Menschen wandern aus oder müssen aus ihrer Heimat fliehen. So auch aus Pfaffenweiler, einem Weindorf in der Nähe von Freiburg. Insgesamt 23 Familien wird in der französischen Kolonie Algerien ein besseres Leben versprochen.
Im Dezember 1853 brechen sie in Richtung Nordafrika auf. Die Reise der Dorfarmen finanziert der Gemeinderat. Dafür wird ein Waldstück abgeholzt und das Land als Rebfläche ausgewiesen. Der neu entstandene Weinberg wird Afrika genannt.
In Algerien wartet auf fast alle Ausgewanderten nichts als Armut und Leid. Ihre Bitten auf eine Rückkehr nach Pfaffenweiler werden vom Gemeinderat abgelehnt.
Einer der insgesamt 132 Menschen schafft es dennoch zurück. Sein Name ist Franz Xaver Luhr. Nach seiner Rückkehr nennen sie ihn im Dorf nur noch: den Afrik!
Dies ist vielleicht seine Geschichte.
EINS
Wie jeden Abend, wenn es dunkel wird, kommt er auch in der Nacht, bevor du Afrika mit einem lauten Knall in die Luft jagen willst, mit einem kalten Luftzug vorbei.
Du schließt die Augen und siehst schwarze Kugeln auf dich zurollen, erst klein, dann groß und größer, und wenn sie von innen an deine Lider knallen, beginnt alles von vorne.
Es ist sein Spiel, nicht deines. Du bist müde von der Arbeit und du schläfst ein. Es wird kalt werden, der Winter zieht allmählich über das Land.
Sie erzählen sich, er hole nur Kinder. Aber das stimmt nicht. Du bist schon sehr alt. Er war da, als du geboren wurdest, er wird da sein, wenn du bald stirbst. Die Leute denken, wenn sie Bilder von ihm malen, wenn sie an Fasching in sein Kostüm schlüpfen, könnten sie ihn beherrschen, die Angst vor ihm verscheuchen. Du hast die Furcht vor ihm schon lange verloren.
Du spürst ihn in deinen Fingerspitzen, er hängt dir beim Atmen in den Nasenflügeln, und wenn du mit deinen Füßen den Boden berührst, dann tritt auch er auf. Manchmal glaubst du, er säße auf deiner Schulter, mal links, mal rechts, wie ein Vogel, der bei dir bleibt, wohin du auch gehst. An kalten Wintertagen spürst du ihn in deiner Brust, wenn du im Sommer schwitzt, ist er der kühle Saum auf der Haut.
Er fliegt auch nicht, er kann nicht gehen, er kann nicht sprechen, er ist einfach nur da. Du würdest ihn gerne fragen, was er macht, wenn du stirbst. Du wirst es niemals erfahren.
Der Nachtkrapp ist auf der anderen Seite daheim.
Du träumst davon, dass er die Zündschnur mit seinem Atem entflammt. Dann pustet er sie sofort wieder aus. Du erschreckst dich und bist sofort wach. Es ist früh am Morgen. Die schwarzen Kugeln verschwinden. Der Nachtkrapp bleibt da.
Ein letztes Mal willst du sehen, wie die Sonne hinter dem Weinberg hochkriecht. Du schiebst die Vorhänge zur Seite. Der Himmel über Afrika ist grau und bedeckt.
Du würdest gerne einen Kaffee trinken, aber die Dose aus weißem Blech ist bis auf den Boden geleert.
Waschen!
Wie so viele Menschen, die lange allein sind, hast du dir angewöhnt, mit dir selbst zu sprechen. Manchmal lachst du grundlos und laut, dabei kennst du keinen einzigen Witz. Du nennst die Dinge beim Namen. Alles muss gesagt werden. Nur so bleibt es echt.
Kaffee!
Anziehen!
Arbeiten!
Graben!
Schaufel!
Mittag!
Essen!
Käse!
Speck!
Zündschnur!
Schlafen!
Oft schimpfst du mit dir, dafür brauchst du nur ein einziges Wort:
Depp!
Oft sagst du auch:
Du!
Oder:
Du!
Du!
Oder:
Du!
Du!
Depp!
Du weißt, was die Leute sagen. Sie glauben, die Sonne Afrikas hätte dein Hirn vollkommen verbrannt. Wenn du ins Dorf gehst, kommen die Kinder und rufen dir nach:
Du!
Du!
Depp!
Du!
Wenn sie dich verhöhnen, beißt du dir in die Hand, aber der Drang, das zu antworten, was du auf keinen Fall sagen willst, geht nicht weg und du brüllst:
Depp!
Du!
Depp!
Die Kinder lachen, dann rennen sie weg. Du würdest gerne eines von ihnen schnappen und am Ohrläppchen ziehen. Du traust dich nicht, stattdessen denkst du an deinen Stollen und den Sprengstoff, den du ihren Vätern seit Jahren schon bei deiner Lohnarbeit in ihren Steinbrüchen stiehlst. Bei dem Gedanken lachst du laut auf. Es klingt, als würdest du bellen und sie denken erst recht, du wärst verrückt.
Als du zurückgekommen bist, haben sie dir eine verfallene Hütte gegeben, oben am Hang, Afrika liegt gleich nebenan. Du hast das Dach mit Rinde gedeckt, du hast aus Stein einen Brunnen gehauen, du hast die Wände mit Lehm verputzt, du hast den Steinboden geschrubbt, dir eine Tür gezimmert und dir ein Bett, einen Stuhl, eine Truhe und einen Tisch selbst gebaut. Jetzt hast du ein richtiges Haus.
Waschen!
Wasser!
Noch immer im Nachthemd öffnest du die Tür, es fröstelt dich, fast schon riecht es nach Schnee. Mit deinem Eimer schöpfst du Wasser aus dem Brunnen, er ist voller Eichenblätter, mit deiner Hand holst du sie raus. Sie sind eisig kalt. Du entscheidest dich, gleich in deiner Küche den Ofen zu heizen. Wenn es schon keinen Kaffee gibt, dann hättest du zumindest gerne warmes Wasser, wenn du dich wäschst.
Feuer!
Der Henkel deines Eimers ist rostig, du hast Angst, dass er bricht. Du bückst dich, die Zipfel deines Nachthemds baden im Dreck. Du gräbst deine Hände unter den Eimer und willst ihn vorsichtig hochheben, da siehst du in Augenhöhe zwei kleine Füße auf der Bank, gleich neben dem Haus.
Du erschrickst. Der Eimer fällt um. Das Wasser läuft in Richtung der kleinen Füße, die in schmutzigen Stiefeln stecken, dein Blick wandert rasch an ihnen hinauf.
Du siehst einen Jungen, wie alt mag er sein? Seine Hose ist braun, die Kniestrümpfe sind aus grauer Wolle, seine abgewetzte Jacke ist rechts blau, links grün, die mit Filz ummantelten Knöpfe sind gelb. Auf dem Kopf baumelt eine rote Mütze, sein schmales Gesicht und die hagere Nase sind vor Kälte ganz blau.
Du!
Du!
Du!
Der Junge sagt nichts, sitzt einfach nur da und schaut geradeaus, als blicke er direkt in ein Nichts. Du stehst vor ihm. Er benimmt sich, als wärst du nicht da.
Du!
Du!
Neben dem Jungen liegt ein Beutel, sein Hab und Gut ist in ein kariertes Leintuch eingewickelt, wie bei einem Zimmermann auf der Walz.
Du!
Du!
Junge!
Langsam gehst du auf ihn zu, so als wäre er ein scheues Reh oben im Wald. Du streckst ihm eine offene Handfläche hin, du zeigst auf seinen Beutel, du deutest mit einem Kopfnicken runter ins Tal. Nichts. Du willst nachschauen, ob er erfroren ist, du näherst dich ihm langsam, deine Hand berührt ihn, ganz vorsichtig, an der Schulter, er kreischt sofort los:
Iiiiieeeeeeehhhhh!
Der spitze Schrei des Jungen durchschneidet das Tal. Der Junge schüttelt sich, als wäre deine Hand die des Teufels und kauert sich zusammen, ganz am Ende der Bank. Jetzt siehst du, da, wo der Junge gerade noch gesessen hat, bevor er mit seinem Schrei aufgesprungen ist, liegt ein Brief. Mit unsicherer Schrift ist auf das Couvert dein Name gekritzelt. Du schaust den Jungen an, der den Kopf von dir wegdreht, sein Oberkörper wippt hektisch wie ein Grashalm in stürmischem Wind. Seinen Kopf bewegt er dabei pfeilschnell von vorne nach hinten, als haue er ihn gegen eine Wand, die außer ihm keiner sieht.
Schhhhtttt.
Junge!
Ruhig!
So langsam und behutsam du kannst, nimmst du den Brief. Kaum hast du ihn in der Hand, weichst du fünf Schritte von dem Jungen zurück. Es fällt dir schwer, das Couvert zu öffnen, deine Hände sind klamm. Mit deinen Zähnen reißt du die Ecke rechts oben so weit auf, dass ein Finger reinpasst.
Lesen!
Du hast schon lange keine Buchstaben mehr aneinandergereiht, aber was dort steht, verstehst du sofort.
Je m’appelle Jacob.
Tu es famille.
Du drehst das Blatt Papier um. Die andere Seite ist leer. Du schaust den Jungen an, du schaust das Blatt Papier an. Jetzt würdest auch du gerne brüllen, aber du hast Angst, dass der Junge schon wieder erschrickt. Sein schreckliches Wippen lässt gerade erst nach.
Dir wird heiß, du willst weglaufen, dich oben im Wald verstecken, du hältst nach dem Nachtkrapp Ausschau, du willst ihn stellen und ihn schelten für diesen ganz üblen Streich. Du wünschst dir seine schwarzen Kugeln zurück, du schließt die Augen, du öffnest sie wieder, du siehst vor dir die Reben, unter dir die sanften Hügel im Tal, du merkst, das ist kein Traum, deine nackten Füße schmatzen im Matsch.
Junge!
Er wimmert leise, seine Hände umklammern die Knie.
Junge!
Keine Angst!
Du würdest ihm gerne etwas anbieten, aber du hast ja nichts mehr im Haus, nicht mal Kaffee, du gehst nachschauen, vielleicht findet sich in der Küche noch Milch. Du kommst zurück, in der Hand ein Glas halbvoll mit Most, auch einen Kanten Brot hast du gefunden. Der Junge ist weg.
Bub?
Es hat angefangen zu regnen, du müsstest an die Zündschnüre im Stollen denken, aber zum ersten Mal seit dreißig Jahren ist dir der Stollen egal. Du findest den Jungen hinter deinem Turm aus Eichendauben, die du für die Fässer brauchst, die du ab und an für die Winzer im Dorf unten baust. Er steht vor dem Turm aus Dauben, als zähle er die Bretter, und wippt schon wieder mit dem Kopf vor und zurück, seine Hände spreizt er zur Seite, seine Finger vibrieren wie die Flügel eines Rüttelfalken auf Jagd.
Most!
Brot!
Der Junge hält inne. Du siehst, wie er zum ersten Mal in deine Richtung schaut, sein Blick fixiert Becher und Brot. Langsam gehst du rückwärts, lockst ihn, wie eine Katze mit Milch, in dein Haus.
Er folgt dir, du stellst sein Essen und Trinken neben das Bett, seitlich, wie eine Krabbe, gehst du ins Eck zu dem dreibeinigen Schemel, den du vor Jahren aus Eichenresten gebaut hast, und setzt dich hin. Du siehst zu, wie der Junge das Brot mit einem Bissen verschlingt, auch den Most leert er mit einem Zug, kein einziger Tropfen verfehlt seinen Mund.
Kaum, dass der Junge gegessen hat, legt er sich hin. Du würdest ihn gerne zudecken, ihm zumindest die schmutzigen Schuhe ausziehen, du hast Angst ihn zu wecken. Der Junge schläft sofort ein. Der Junge schläft tief.
Denk!
Nach!
Aber da kommt nichts, kein Geistesblitz, keine Idee, überhaupt nichts. Nur das Gleiche wie immer, alles andere ist dir schon seit Ewigkeiten egal.
Afrika!
Fast siebzig Jahre bist du schon alt und so kurz vor deinem Ziel wie noch nie. Du kannst keine Familie haben. Du hattest Zeit deines Lebens nicht einmal eine Frau.
Du suchst den Nachtkrapp.
Wie immer, wenn du ihn brauchen könntest, ist er nicht da. Du stehst auf und schaust in den kleinen Taschenspiegel, den du neben das Fenster gehängt hast. Draußen ist Afrika. Drinnen siehst du das Spiegelbild eines alten Mannes. Spindeldürr bist du geworden, eine Glatze hast du und einen weißen Bart, der so lang gewachsen ist, dass du schon lange nicht mehr weißt, ob du ein Kinn hast oder auch nicht. Du siehst, dass du noch dein Nachthemd anhast, und auf dem Feuer kocht das Wasser, das du aufgesetzt hast.
Seife.
Du wäschst dich so gründlich wie schon lange nicht mehr. Dann ziehst du dich an. Nicht die Arbeitskleidung. Sondern die, mit der du jeden Sonntag die Kirche besuchst. Du setzt dich auf die Bank vor deinem Haus. Es ist noch ein wenig Most da, alles andere hat der Junge vertilgt.
Hunger!
Auf einem der Rebstöcke vor deiner Hütte sitzt der Nachtkrapp und grinst. Er reckt den Kopf nach hinten und tut so, als würde er von einem Rappen Trauben abbeißen, aber selbst die Lese für den Eiswein ist schon seit Wochen vorbei. Der Frost kam früh dieses Jahr. Du willst nicht an den Jungen denken und murmelst doch unablässig seinen Namen laut vor dich hin.
Jacob.
Jacob.
Jacob.
Jacob.
Du gehst rein in die Stube und schaust ihm zu, wie er schläft. Du bist alt, dein Gang ist noch immer aufrecht und stramm. Du blickst in den Spiegel. Sieht er dir ähnlich? Ein kleines bisschen zumindest? Wie kann es sein, dass in dem Brief steht, er wäre famille? Du hast dein Spiegelbild schon lange nicht mehr betrachtet. Zum ersten Mal seit langer Zeit sagst du:
Ich!
Du musst ins Tal runter. Du hoffst, dass jemand was weiß oder gehört hat. So ein Junge, denkst du, der fällt doch auf. Du kennst dich und weißt jetzt schon, dass du niemanden fragst. Du willst den Jungen nicht wecken, du willst ihn nicht allein lassen. Bis es Mittag wird, sitzt du einfach nur da. Dann stehst du auf und stupst den Jungen sanft an.
Junge!
Du!
Wach auf!
Der Junge dreht sich um. Er lässt sich nicht wecken. Er schläft noch immer tief und sehr fest. Schon seit Jahren hast du kaum noch Appetit. Aber ein Glas Most ist auch für einen wie dich nicht genug. Du hattest einmal eine Katze. Sobald sie aufwachte, strich sie dir um die Füße und forderte Milch. Du schaust den Jungen an. Er wird bald Hunger bekommen. Du weißt, wie wichtig Verpflegung ist, dafür warst du lange genug bei der Armee.
Nachschub!
Du nimmst zwei Teller, einen zum Füllen, den anderen zum Abdecken, und wickelst sie in ein Tuch. Wenn du jetzt losgehst, bist du in einer knappen Stunde zurück. Du nimmst deine Taschenuhr, von der du dachtest, dass du sie nie wieder brauchst. Du schätzt die Zeit und stellst die Uhr. Du sagst:
Zwölf!
Es hat aufgehört zu regnen. Nun fällt der Schnee. Du ziehst den Mantel an. Irgendwann war er mal schwarz. Jetzt ist er grau. Ein paar Meter nur, dann ist er vollkommen weiß. Es ist rutschig und du kommst nur langsam voran. Du erreichst das Dorf. Der Gasthof Engel, wo du dir Fleisch und Kartoffeln in die Teller hast füllen wollen, hat zu. Die Kirchturmuhr schlägt vier Mal. Du hast dich in der Zeit gehörig verschätzt. Der Engel schließt mittags um zwei. Du gehst ein paar Häuser weiter und klopfst an der Tür der Krämerin.
Da!
Du hältst ihr die Teller hin und gibst ihr dein Portemonnaie. Sie nimmt sich ein paar Münzen raus und verschwindet im Laden. Die Tür macht sie zu. Es wird schon wieder dunkel. Der Schnee leuchtet hell. Durch die Scheiben in der Tür siehst du die Krämerin, ihre breiten Hüften, ihren gemächlichen Gang. Vom Mehl geht sie zu den Eiern, von den Eiern zum Speck, vom Speck zu den Fässern voll Kraut. Als sie dir die gefüllten Teller reicht, sagst du:
Milch!
Als sie reingeht, um die Milch zu holen, rufst du:
Most!
Nein!
Wein!
Sie packt dir alles, worum du gebeten hast, in eine Kiste aus Holz. Die dünnen Bretter riechen nach Apfel. Viel lauter als du willst, sagst du:
Apfel!
Äpfel!





























