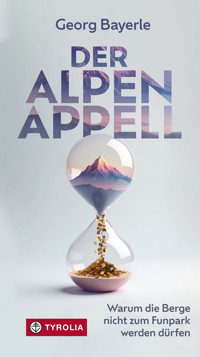
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tyrolia
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Berge in Gefahr – Wie Profitgier und Massentourismus die Alpen zerstören Ein Aufruf zur Rettung eines bedrohten Natur- und Kulturraums Die Alpen sind nicht nur ein riesiger Naturraum, Wasserschloss und beliebte Freizeitstätte in der Mitte Europas. Sie sind auch mehr denn je im Wandel begriffen – und so gefährdet wie nie zuvor. Grund dafür ist auch die vom Menschen initiierte und noch immer anhaltende Erschließung. Sie wird selbst in den entlegensten Regionen des Hochgebirges mit heute fragwürdigen Methoden durchgezogen. Der renommierte Alpenkenner, Fil-memacher und Journalist Georg Bayerle beobachtet diese Entwicklung seit mehreren Jahrzehnten, und das privat wie beruflich. In seiner Streitschrift "Alpen-Appell" analysiert Bayerle schonungslos den Zustand eines immer fragiler werdendes Ökosystem, hinter-fragt die auf reiner Ausbeutung basierende Alpenökonomie – und er zeigt Wege für die Zukunft auf, wie wir das großartige Gebirge inmitten des Kontinents doch noch vor uns retten können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Bayerle
Der Alpen-Appell
Wo Natur verbaut ist, wird keine Naturwildnis mehr entstehen. Jede neue Investition zieht stattdessen den Zwang zu weiterem Wachstum nach sich. Verbaute Natur wird zukünftigen Generationen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Georg Bayerle
DerAlpenAppell
Warum die Berge nicht zum Funpark werden dürfen
Inhalt
Vorwort zur zweiten Auflage
Daten, Fakten, Beobachtungen: Wie der Wandel der Natur abläuft
Im T-Shirt auf dem Mont Blanc
Schreie aus Steinen
Neue Gefahren, neues Risiko
Was uns die Wanderwege lehren
Seufzer einer erschöpften Natur?
Blatten
Höher, schneller, weiter: Wie wir auf den Wandel reagieren
Was vom Gletscher übrigblieb
Das Dilemma der Energiewende
Der Kampf ums Wasser
Mals nach dem Wunder
Neue Blechlawinen
Hundesnacks aus China und Gletscherwasser aus dem Himalaya
Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd’
Der „Katastrophenwinter“ 2006/2007
Epochenwende im Sommertourismus
Das Narrativ der „Schwabenkinder“
Frau Holle und die Schneekanone
The New Normal
Wenn’s zu viel wird: Bettenstopp gegen Touristenmassen
Baustelle eröffnet: Olympia
Der Berg der Berge …
Wie unsozial wird die Landschaft?
Rufer in der Wüste I
Rufer in der Wüste II
Rufer in der Wüste III
Der Schatz der Alpen: Wie es auch gehen könnte
Was alles in Hausschlappen steckt
Lehren einer Tour aufs Hintere Eis
Ein Besuch in gallischen Dörfern
Zwei Wochen auf der Rauhekopfhütte
Die Alpen als Zukunftslabor
Bergsteigerdörfer und Alpine Pearls
Die Kraft der guten Beispiele
Die eigentlich so geniale Alpenkonvention
Die Idee der Tabuzone C
Die wertvollen Richtlinien für mehr wildes Wasser
Der Modellcharakter von Biosphärenreservaten
Der Alpen-Appell: Wie wir unsere Berge noch retten können
So viele Naturräume wie möglich bewahren
Keine falschen Wahrheiten
Es müssen länderübergreifend klare Ausbaugrenzen bestimmt werden
Erlebnistiefe braucht Hindernisse und Zeit
By fair means
Die Alpen gehören allen
Natur und Ressourcen schützen
Der Schutz von Biodiversität und Ökosystemen
Wir brauchen realistische Bilder
Es liegt an uns
Der Atem der Berge
Warum die Alpen auch als Sinnesräume unersetzlich sind
Was wir den Bergen schuldig sind
Ein heiliger Berg für den Gran Paradiso?
Wie wir mit kleinen Kniffen etwas erreichen
Dürfen wir jetzt noch Ski fahren?
Der Weg in die Zukunft
Wo ich den Atem der Berge spüre
Vorwort zur zweiten Auflage
„Ich hab’ Ihr Buch gelesen und ich finde es einfach super; schöne Grüße und Sie brauchen nicht zurückrufen.“ Diese Sprachnachricht hinterlässt ein mir unbekannter Anrufer aus Tirol wenige Tage nach dem Erscheinen des „Alpen-Appell“ auf dem Anrufbeantworter. So oder ähnlich sagen und schreiben es in den darauffolgenden Wochen und Monaten viele. Die Resonanz ist auch in den Medien groß und nachhaltig. Vielen Menschen spricht der „Alpen-Appell“ aus der Seele. Und viele – gerade jene, die sich als Natur- und Alpenschützer vor Ort oft allein und wie Außenseiter vorkommen – fühlen sich bestärkt. „Machen Sie bitte weiter so“, sagen oder schreiben mir Menschen, die ich gar nicht persönlich kenne. Der „Alpen-Appell“ verbindet Menschen und zeigt, wie viele dieses Anliegen teilen.
Es ist aber auch kein Wunder, dass die Alpen die Herzen der Leser berühren. Denn sie sind Europas Hauptgebirge und der größte zusammenhängende Naturraum im Herzen des Kontinents und Quellgebiet der europäischen Flüsse. Sie erstrecken sich auf engem Raum über unterschiedlichste Klimazonen und beherbergen ein Mosaik von Lebensräumen, sind eine Arche Noah vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten. In ihnen haben Kulturformen und Lebensweisen überlebt, die uns in frühere Zeiten zurückversetzen. In all diesen Dimensionen sind die Alpen der Gegenpol unserer schnelllebigen Zeit. Und sie sind einer der beliebtesten Freizeiträume des Kontinents.
Seit 50 Jahren beobachte und erlebe ich die Alpen im Wandel. Zuerst und vordergründig sind es die vom Menschen bewirkten Veränderungen, die sich in der Landschaft ausprägen: der Wandel von einer einfachen, bodenständigen Lebensart, die noch aus der alten Welt von Mangel an Konsumgütern und Sorge um die Existenz herrührte, dabei aber von einer tiefen Verbindung mit der Natur geprägt war, bis zur heutigen Ausbaustufe von Tourismus, Verkehr und Komfort – Shrimps und Kunstschnee auf 3000 Metern, um es plakativ zu sagen. Seit der Jahrtausendwende hat sich der Landschaftswandel noch einmal beschleunigt. Er geht sowohl vom Menschen als auch von der Natur aus und gefährdet die Zukunft der Kulturlandschaft Alpen.
Nach dem halben Jahr, das seit dem Erscheinen der ersten Auflage des „Alpen-Appell“ vergangen ist und in dem dieses Buch öffentlich besprochen wurde, lassen sich auch ein paar der Fragen aus der ersten Auflage des Buchs beantworten: Nein, wir schauen nicht genau genug hin. Und: Ja, wir stellen unser Handeln zu wenig infrage. Immerhin haben Beate Rubatscher-Larcher, die Geschäftsführerin der Gletscherbahnen im Pitztal und Kaunertal, und Reinhard Klier, Sprecher der Tiroler Seilbahnen, den Impuls zur Debatte aufgenommen. Das zweite Gespräch gibt es in der Folge 50 des Podcasts alpenverein basecamp zu hören. Insgesamt hält sich die Diskursfreude jedoch in Grenzen. Gerade die Vertreter der Tourismuswirtschaft und der alpinen Tourismusorte weichen – so zumindest mein Eindruck – der Auseinandersetzung aus. Womöglich tun sie das, um ihr Tourismusmodell nicht hinterfragen zu müssen. Das touristische Hochglanz- und Komfortversprechen soll nicht durch unbequeme Themen Flecken bekommen. Viele Orte pflegen offenbar nach wie vor lieber die schönen Werbekulissen als die Natur und die Ressourcen, die doch die Grundlage für ein langfristiges Weiterbestehen des Tourismus in den Alpen darstellen.
Moderner Panoramablick am Reschenpass
Ausgerechnet in Tirol, wo sich die Konkurrenzspirale im anlagengebundenen Tourismus immer schneller dreht, und in Südtirol, wo die Debatten um die richtige Ausgewogenheit der touristischen Nutzung längst viele Menschen in den Orten umtreibt, will man sich offenbar von außen nicht gern kritische Fragen stellen lassen. Diese Haltung verkennt die Tatsache, dass die Alpen als Naturerbe (die Dolomiten sind sogar als offizielles „Weltnaturerbe“ anerkannt) allen gehören; insbesondere auch den nach uns folgenden Generationen. Sie sind im guten Sinne ein europäisches Projekt: Landwirtschaftsförderungen subventionieren die extensive Bewirtschaftung der Almen, ebenso wie andere EU-Programme lokaltypische Kultur- und Wirtschaftsformen, Sprachen und Traditionen unterstützen. Sie sind aber auch ein europäisches Projekt im Hinblick auf die schädlichen Konsequenzen. Als sensibler Naturraum bekommen die Alpen die Folgen einer exzessiven Wirtschaftsweise, des zunehmenden Verkehrs und insbesondere des Klimawandels besonders heftig ab.
Was das Ganze noch verschärft: Wir haben den Wissensschatz der Alten vergessen, den Sinn für die Raffinesse verloren, mit der sie auf die Veränderungen der Natur reagierten und ihr Leben zu gestalten wussten. Unser heutiger Zugang ist vom Konsum und der beliebigen Verfügbarkeit aller Dinge geprägt und basiert auf der Ausnutzung der Ressourcen. Wir begegnen der Natur in den Alpen viel zu unbedacht und respektlos. Wir müssen Wege für die Zukunft finden, die sich grundsätzlich von denen der Gegenwart unterscheiden. Dafür will dieses Buch Impulse geben. Um das Bild deutlich zu machen, braucht es klare Konturen und eindringliche Beispiele. Die Berge und die Bergkultur sind in der Tat gute Lehrmeister dafür – wenn wir sie verstehen wollen.
Daten, Fakten, Beobachtungen: Wie der Wandel der Natur abläuft
Im T-Shirt auf dem Mont Blanc
Mit 4,0 Grad Celsius über dem Mittel des Zeitraums 1961 bis 1990 belegt der Sommer 2024 den zweiten Platz seit Beginn der Temperaturmessungen. Oder im Wortlaut des Wetterdienstes Geosphere Austria: „Damit brachte 2024 einen außergewöhnlich warmen Sommer, vergleichbar mit 2003 und 2019.“ Das gesamte Jahr 2024 war sogar das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zum ersten Mal lag die gemittelte Temperatur mehr als jene 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau, die als Schwellenwert im Pariser Klimaabkommen bestimmt wurden.
Die Durchschnittstemperatur auf der Wetterwarte auf dem Hohen Sonnblick pendelt in den Tagen vor dem 26. Oktober 2024 auf 3100 Metern Höhe immer noch um null Grad. An diesem Tag geht in Sölden im Ötztal trotzdem das erste Weltcup-Rennen der neuen Saison über die Bühne. Das weiße Band der Kunstschneepiste zieht sich auf 3000 Metern an jener Stelle durchs Gelände, wo sich einst der Rettenbachferner befunden hat. Die offiziellen Kameras zeigen Athletinnen in glänzenden Rennanzügen in 4K-Auflösung, glitzernde Eiskristalle, die durch messerscharfe Skikanten aufspritzen. Scheinbar nur aus Versehen verirrt sich die Fernsehkamera dann einmal ins Gelände und zeigt die ansonsten weitgehend schneefreie dunkelbraune Felslandschaft der Ötztaler Alpen, in der von Winter nicht der leiseste Hauch zu spüren ist.
Nicht zum ersten Mal vollzieht sich dieses absonderliche Schauspiel in einer Höhenlage mit großen Feldern des vermeintlich „ewigen Eises“. Die Gegend wirkt nun wie das Revier für sonnige Herbstwanderungen oder Mountainbiketouren. Der Wetterbericht des Deutschen Alpenvereins kündigt für Anfang November die Nullgradgrenze auf rund 4000 Metern an, zehn Grad plus werden für Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze, am 1. November 2024 gemeldet. In der Jahresbilanz 2024 verzeichnet der Deutsche Wetterdienst den Rekord von 66 aufeinanderfolgenden frostfreien Tagen am Hohen Sonnblick und auf der Zugspitze von Juli bis September. Die Folgen werden an beiden Bergen direkt vor Augen geführt: Die einstigen Gletscher sind insbesondere auf der Zugspitze auf einen minimalen Rest zusammengeschmolzen; das Bild von weitgehend eisfreien Alpen lässt sich heute schon im Spätsommer aus dem Flugzeugfenster aufnehmen. Das arktische Klima verschwindet aus den Alpen. Die Staffelung der Klimazonen mit ihrem Lebensraummosaik löst sich auf.
Schon im August 2023 hat MeteoSchweiz die Nullgradgrenze erstmals auf 5300 Metern gemessen. Das ist höher, als jeder Berg der Alpen hinaufreicht. Und so setzen sich diese Rekorde fort. Sie werden regelmäßig vom Echo einer teils ungläubigen, teils erschreckten Öffentlichkeit begleitet, das dann wieder verhallt und keine tiefere Wirkung in den Gesellschaften der Alpenländer und darüber hinaus auslöst. Im Gegenteil: Die Wintersportverbände diskutieren Winterspiele in Saudi-Arabien und Skisprungwettbewerbe in Dubai. Wenn winterliche Verhältnisse eh künstlich hergestellt werden müssen …?
Etwa seit der Jahrtausendwende hat die Entwicklung noch einmal an Fahrt zugelegt, wie es Datenreihen des Deutschen Wetterdienstes beispielhaft für die Zugspitze, zeigen. Als Joseph Enzensberger, der junge bayerische Alpinist und Meteorologe, im Jahr 1900 auf dem Zugspitzgipfel im windigen Wetterturm eine der heute längsten Zahlenreihen der Wetterbeobachtung startete, konnte er nicht ahnen, welchen Verlauf diese Kurve einmal nehmen würde. Jahrzehntelang pendelten die Werte in moderatem Auf und Ab mit leicht ansteigender Tendenz, bis sie seit 25 Jahren nur noch eine eindeutige Richtung kennen: steil bergauf mit Ausschlägen um mehrere Grad. In den Alpen liegen die Durchschnittstemperaturen bereits um zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Mittelwert. Das globale Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erwärmung, bei der Wissenschaftler gerade noch von einigermaßen kontrollierbaren Veränderungen des globalen Klimas ausgehen, ist hier in den Alpen bereits außer Reichweite. Das bedeutet, dass sich die Auswirkungen des Klimawandels mit steigenden Temperaturen und immer häufigeren extremen Wetterereignissen weiter verstärken werden.
Das nicht mehr „ewige“ Eis der Alpen
Wissenschaftliche Studien haben diese Entwicklung schon im 20. Jahrhundert prognostiziert. Wie sich heute herausstellt, waren die damaligen Zukunftsszenarien eher zurückhaltend gezeichnet. Vom Verschwinden der meisten Gletscher in Österreich bis zum Ende des 21. Jahrhunderts war die Rede; inzwischen gehen die meisten Schätzungen davon aus, dass die Ostalpen bis zum Jahr 2050 weitgehend eisfrei sein werden – also nicht mehr in einer abstrakten Ferne. Die weitgehend schneefreien Alpen im Sommer sind uns direkt vor Augen gerückt. Sölden feiert vor diesem Hintergrund trotzdem den Skiweltcup-Auftakt vor vollem Haus, als wäre nichts geschehen. Und die große Sonderausstellung „Zukunft Alpen“, die der Deutsche Alpenverein im Oktober 2024 in München eröffnete, wiederholt inhaltlich die seinerzeit erste große Ausstellung „Gletscher im Treibhaus“ genau 20 Jahre zuvor an gleicher Stelle.
Damals hieß es: „Allein im Rekordsommer 2003 verlor das ‚ewige Eis‘ der Westalpen fünf bis zehn Prozent seines Volumens.“ 20 Jahre später werden Requien gehalten, um die Verluste von einst landschaftsprägenden Eisfeldern zu betrauern. So gibt es ein letztes Amen für den verschwundenen Zugspitzferner oder die Pasterze, den einst als Naturwunder betrachteten vormals größten Gletscher Österreichs. Die Klage rauscht durch die Medien wie das Schmelzwasser der Ötztaler Gletscher schon morgens um sieben durch die Ötztaler Ache. Dann dreht sich der Alltag wieder weiter – bis zum nächsten „Gletscher-Todesfall“. Schleichend, aber unaufhaltsam haben sich die weitgehend eisfreien Alpen unterdessen zu einer neuen Normalität entwickelt.
Es geht dabei nicht nur um den tiefgreifenden Wandel der Landschaft, sondern auch darum, dass gerade die Gletscher wie ein Fieberthermometer anzeigen, was auf der Erde passiert. Über eine punktuelle Aufgeregtheit hinaus aber sind die Gesellschaften der Alpenländer in diesen 20 Jahren keinen Schritt weitergekommen. Stattdessen feiern sie ihre von zahlreichen Sponsoren gepolsterten Events im medialen Hochglanz – einfach weiter so.
Schreie aus Steinen
Wenn der Münchner Geologe Michael Krautblatter im Stollendunkel auf der Zugspitze die Signale seiner elektrischen Sensoren ausliest, dann kann er es vernehmen: das Seufzen und Knirschen im Gestein. Hier wurde ein einst für den Gipfeltourismus in den Felsen gesprengter Tunnel zum modernen Labor für die Vorgänge im Inneren des Hochgebirges. Der Permafrost der in den Alpen je nach Exposition ab circa 2500 Metern Höhe beginnt, schmilzt. Was wir an den Gletschern sehen, passiert genauso auch im Inneren der Berge: Eis, das den Felsen wie natürlicher Kitt zusammenhält, verschwindet. Frost und Tauvorgänge wirken immer tiefer ins Gestein und wechseln in kürzeren Abständen.
Die Zugspitze dient als Forschungsstätte, um die Veränderungen besser zu verstehen, die noch vor 20 Jahren kaum beachtet wurden. „Wir brauchen eine steile Lernkurve, um mit den Vorgängen in der Natur Schritt zu halten“, betont der Professor, während er in der Hocke an diesem Novembertag 2024 die letzten Meter in einen Seitenarm des Kammstollens kriecht. Dieser wurde einst für die Touristen als Verbindungsgang zwischen dem Schneefernerhaus und dem Kammhotel am Gipfel der Zugspitze gebaut. Es ist stockfinster, nur die Stirnlampen geben Licht. Hier befinden wir uns auf 2800 Metern, mitten im Epizentrum des vergehenden Permafrosts. Wasser tropft von den Wänden, denn mit einiger Verspätung kommt jetzt im November die Sommerhitze im Inneren des Berges an. Seit Michael Krautblatter im Jahr 2007 mit seinen Messungen begonnen hat, ist der Dauerfrost kontinuierlich zurückgegangen. Um ganze fünf Meter dringt die Schmelze heute tiefer ins Felsinnere vor. Die Durchschnittstemperatur hat sich seitdem von minus 1,2 Grad auf minus 0,7 Grad erhöht. Und die Grenze des Permafrosts ist um ungefähr 100 Höhenmeter nach oben gewandert. Bei minus 0,5 Grad wird in wenigen Jahren der Taupunkt erreicht sein. Dann öffnen sich Klüfte und Risse im Gestein.
Der Felssturz am eleganten Granitberg Piz Cengalo im schweizerischen Bergell, der 2017 mit seiner vier Kilometer langen Schlammlawine Teile des Bergdorfs Bondo zerstört und acht Menschen das Leben gekostet hat, war ein Symptom dieser Veränderungen im Gestein. Vom Fluchthorn in der Silvretta sind im Juni 2023 mit dem höchsten der drei Gipfel rund eine Million Kubikmeter Gestein ins Tal abgebrochen, das glücklicherweise an diesem Tag menschenleer war. Ein Jahr später, im Bergsommer 2024, liegt ein tonnenschwerer Granitfindling, groß wie ein Geländewagen, wochenlang auf der Straße im Südtiroler Schnalstal. Der Felsbrocken hat sich ebenfalls bei einem Unwetter vom Untergrund gelöst und ist über Almwiesen und durch den Bergwald ins Tal gerollt, bis er auf der Straße liegenblieb, auf der zufälligerweise gerade kein Auto vorbeikam. Der Verkehr wurde einspurig vorbeigeleitet, Ampeln wurden mit Kameras und Sensoren gekoppelt und schalteten im Notfall sofort auf Rot. Früher waren das singuläre Ereignisse, heute wird die Gefahr zum Dauerzustand in den Alpen.
Wochen später gehen Unwetter über dem Aostatal nieder, in deren Folge das 1300-Einwohner-Bergdorf Cogne vier Wochen lang von der Außenwelt abgeschnitten ist. Muren und Schlammströme haben die Straße und die Trinkwasserversorgung des Ortes zerstört. Mit dem Slogan „Cogne non si ferma“ (Cogne macht nicht dicht) kämpft der Ort im Nationalpark Gran Paradiso um seine Existenz und sein Image. Die italienische Tourismusministerin Daniela Santanché fällt nach der Evakuierung mit dem Vorschlag auf, Gäste per Hubschrauber ein- und auszufliegen, um die touristische Hochsaison nicht ausfallen zu lassen. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie mit immer noch irrwitzigeren Ideen versucht wird, den Normalbetrieb gegen die Natur durchzudrücken.
Wolkenbruchartige Niederschläge bringen in kurzer Zeit Wassermassen, die von keinem Bach- oder Flussbett mehr kanalisiert werden können. In Cogne wälzen sich Schuttströme durch vormals idyllische Bachtäler und es ist nur der zurückhaltenden Bautätigkeit am Rand des Nationalparks zu verdanken, dass es nicht zu noch größeren Schäden kommt. Auch bei diesen Wetterphänomenen spielt die Erwärmung eine entscheidende Rolle: Aus wärmeren Meeren verdunstet mehr Feuchtigkeit in die warme Luft und steigert das Niederschlagspotenzial, das sich oft unwetterartig auf kleinem Raum entlädt.
Felssturz im Schnalstal
Seit in Cogne die Straße provisorisch wieder hergestellt ist, kommen die Urlauber zurück. Die einen, um ihre liegengebliebenen Fahrzeuge abzuholen, die anderen, um hier im Nationalpark Gran Paradiso die einzigartige Naturlandschaft zu genießen. Die Anteilnahme ist groß, berichten Einwohnerinnen wie die Hotelchefin Natalie Fattore, die ein aus den traditionellen Steingebäuden bestehendes Hotel im Weiler Valnontey betreibt. Den Almabtrieb Ende September, der zu den großen und lebensfrohen Berglerfesten des Aostatals gehört, feiern sie dieses Mal mit besonderer Inbrunst. Die Bergkultur lebt und will sich behaupten.
Neue Gefahren, neues Risiko
Die Folgekosten, die durch die Naturereignisse entstehen, aber steigen und immer deutlicher stellt sich die Frage, wer diesen Preis bezahlt. Dabei geht es nicht nur um entstandene Schäden, sondern auch darum, Schutzbauten für etwaige zukünftige Ereignisse zu errichten – Lawinengatter, Steinschlagzäune, Murenwälle, Hochwasserbefestigungen oder Treibholzrechen. Selbst für im Normalfall kleine Bergbäche wird der Aufwand immer größer. Festungsartige Bauwerke werden in die Landschaft geklotzt, oft müssen erst aufwändig gesicherte Zufahrtswege zu den Oberläufen von Gewässern angelegt werden, um dort mit eigens errichteten Befestigungen ein Unwetterereignis gleich oben abfangen zu können. Und obwohl immer mehr Geld investiert wird, bleibt offen, ob es den vollständigen Schutz im extremen Profil der Alpen überhaupt geben kann – oder ob wir als Gesellschaft lernen müssen, mit neuen Risiken zu leben und möglicherweise auch Orte aufzugeben.
In der Schweiz ist dieser Weg zu einer neuen Risikokultur längst eröffnet: Im Davoser Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF etwa werden Aufwand und Nutzen nüchtern ökonomisch verglichen, um dann eine wirtschaftlich sinnvolle Strategie für den Schutz von Häusern und Straßen zu finden. Regelmäßig kommt dabei heraus, dass anstelle eines Vollschutzes gegen ein mögliches Schadensereignis doch „nur“ ein Überwachungs- und Warnsystem installiert werden kann. Im Alarmierungsfall müssen die Menschen ihre Häuser verlassen oder können tagelang nicht aus dem Tal, wenn ein Bergsturz oder eine Lawine droht. Im November 2024 räumen die Einwohner ihr kleines Dorf Brienz in Graubünden in der Schweiz schon zum zweiten Mal auf unbestimmte Zeit, weil sich ein Schuttstrom mit mehr als einer Million Kubikmeter vom Berg auf das Dorf zubewegt. „Der Berg kommt, wann er will“, heißt es lapidar zu dieser Situation, die in Erinnerung ruft, wie sehr sich die Zivilisation in ihrer alpinen Ausgesetztheit den Naturgefahren unterordnen muss.
Zu der in Deutschland gewohnten Vollkasko-Mentalität passt dieses neue Denken einer naturangepassten Risikokultur gar nicht. Früher oder später aber – die Flutereignisse nicht nur im Alpenvorland machen es deutlich – stellen sich solche neuen Fragen immer drängender; und es ist höchste Zeit, sie zu debattieren. Politikerinnen und Politiker, die entstandene Schäden mit „unbürokratischen Soforthilfen“ in landesväterlichem Gestus umgehend verpflastern, geben nur eine unzureichende und bestenfalls ruhigstellende Antwort auf immer drängendere Fragen.





























