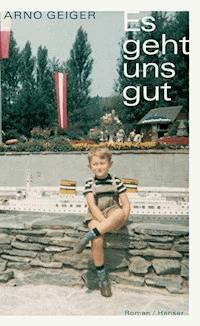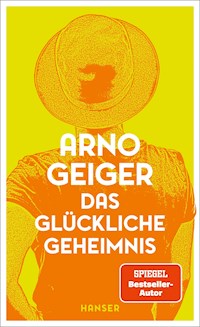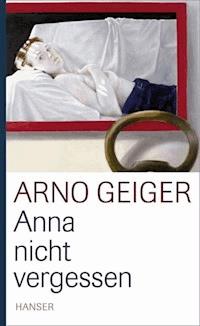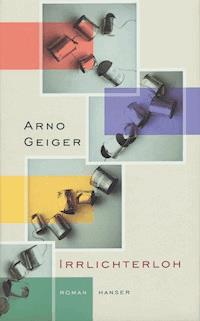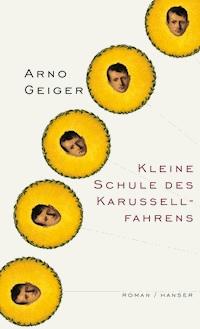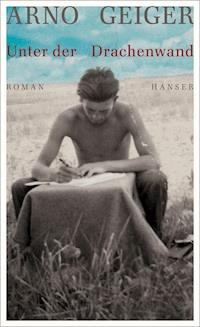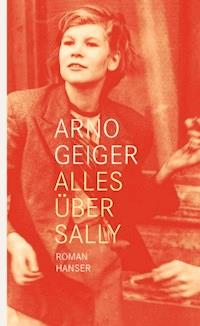Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Arno Geiger hat ein tief berührendes Buch über seinen Vater geschrieben, der trotz seiner Alzheimerkrankheit mit Vitalität, Witz und Klugheit beeindruckt. Die Krankheit löst langsam seine Erinnerung und seine Orientierung in der Gegenwart auf, lässt sein Leben abhandenkommen. Arno Geiger erzählt, wie er nochmals Freundschaft mit seinem Vater schließt und ihn viele Jahre begleitet. In nur scheinbar sinnlosen und oft so wunderbar poetischen Sätzen entdeckt er, dass es auch im Alter in der Person des Vaters noch alles gibt: Charme, Witz, Selbstbewusstsein und Würde. Arno Geigers Buch ist lebendig, oft komisch. In seiner tief berührenden Geschichte erzählt er von einem Leben, das es immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Arno Geiger
Der alte Königin seinem Exil
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23690-5
© 2011 Carl Hanser Verlag München
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
www.arno-geiger.de
Man muss auch das Allgemeinste
persönlich darstellen.
Hokusai
Als ich sechs Jahre alt war, hörte mein Großvater auf, mich zu erkennen. Er wohnte im Nachbarhaus unterhalb unseres Hauses, und weil ich seinen Obstgarten als Abkürzung auf dem Weg zur Schule benutzte, warf er mir gelegentlich ein Scheit Holz hinterher, ich hätte in seinen Feldern nichts verloren. Manchmal jedoch freute ihn mein Anblick, er kam auf mich zu und nannte mich Helmut. Das war ebenfalls nichts, womit ich etwas anfangen konnte. Der Großvater starb. Ich vergaß diese Erlebnisse – bis die Krankheit bei meinem Vater losging.
In Russland gibt es ein Sprichwort, dass nichts im Leben wiederkehrt außer unseren Fehlern. Und im Alter verstärken sie sich. Da der Vater schon immer einen Hang zum Eigenbrötlerischen hatte, erklärten wir uns seine bald nach der Pensionierung auftretenden Aussetzer damit, dass er jetzt Anstalten machte, jegliches Interesse an seiner Umwelt zu verlieren. Sein Verhalten erschien typisch für ihn. Also gingen wir ihm etliche Jahre mit Beschwörungen auf die Nerven, er solle sich zusammenreißen.
Heute befällt mich ein stiller Zorn über diese Vergeudung von Kräften; denn wir schimpften mit der Person und meinten die Krankheit. »Lass dich bitte nicht so gehen!«, sagten wir hundertmal, und der Vater nahm es hin, geduldig und nach dem Motto, dass man es am leichtesten hat, wenn man rechtzeitig resigniert. Er wollte dem Vergessen nicht trotzen, verwendete nie auch nur die geringsten Gedächtnisstützen und lief daher auch nicht Gefahr, sich zu beklagen, jemand mache Knoten in seine Taschentücher. Er leistete sich keinen hartnäckigen Stellungskrieg gegen seinen geistigen Verfall, und er suchte nicht ein einziges Mal das Gespräch darüber, obwohl er – aus heutiger Sicht – spätestens Mitte der neunziger Jahre um den Ernst der Sache gewusst haben muss. Wenn er zu einem seiner Kinder gesagt hätte, tut mir leid, mein Gehirn lässt mich im Stich, hätten alle besser mit der Situation umgehen können. So jedoch fand ein jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel statt, mit dem Vater als Maus, mit uns als Mäusen und mit der Krankheit als Katze.
Diese erste, sehr nervenaufreibende, von Unsicherheit und Verunsicherung geprägte Phase liegt hinter uns, und obwohl ich noch immer nicht gerne daran zurückdenke, begreife ich jetzt, dass es einen Unterschied macht, ob man aufgibt, weil man nicht mehr will, oder weil man weiß, dass man geschlagen ist. Der Vater ging davon aus, dass er geschlagen war. Im Abschnitt seines Lebens angelangt, in dem seine geistige Kraft verging, setzte er auf innere Haltung; etwas, das mangels wirkungsvoller Medikamente auch für die Angehörigen eine praktikable Möglichkeit ist, mit der Misere dieser Krankheit umzugehen.
Milan Kundera schreibt: Das einzige, was uns angesichts dieser unausweichlichen Niederlage, die man Leben nennt, bleibt, ist der Versuch, es zu verstehen.
Ich stelle mir Demenz in der mittleren Phase, in der sich mein Vater momentan befindet, ungefähr so vor: Als wäre man aus dem Schlaf gerissen, man weiß nicht, wo man ist, die Dinge kreisen um einen her, Länder, Jahre, Menschen. Man versucht sich zu orientieren, aber es gelingt nicht. Die Dinge kreisen weiter, Tote, Lebende, Erinnerungen, traumartige Halluzinationen, Satzfetzen, die einem nichts sagen – und dieser Zustand ändert sich nicht mehr für den Rest des Tages.
Wenn ich zu Hause bin, was nicht allzu oft vorkommt, da wir die Last der Betreuung auf mehrere Schultern verteilen können, wecke ich den Vater gegen neun. Er liegt ganz verdattert unter seiner Decke, ist aber ausreichend daran gewöhnt, dass Menschen, die er nicht erkennt, in sein Schlafzimmer treten, so dass er sich nicht beklagt.
»Willst du nicht aufstehen?«, frage ich ihn freundlich. Und um ein wenig Optimismus zu verbreiten, füge ich hinzu: »Was für ein schönes Leben wir haben.«
Skeptisch rappelt er sich hoch. »Du vielleicht«, sagt er.
Ich reiche ihm seine Socken, er betrachtet die Socken ein Weilchen mit hochgezogenen Augenbrauen und sagt dann:
»Wo ist der dritte?«
Ich helfe ihm beim Anziehen, damit das Prozedere nicht ewig dauert, er lässt es bereitwillig über sich ergehen. Anschließend schiebe ich ihn hinunter in die Küche, wo er sein Frühstück bekommt. Nach dem Frühstück fordere ich ihn auf, sich rasieren zu gehen. Er sagt augenzwinkernd:
»Ich wäre besser zu Hause geblieben. Dich komme ich nicht so schnell wieder besuchen.«
Ich zeige ihm den Weg ins Badezimmer. Er singt »Oje-oje, oje-oje …« und spielt auf Zeitgewinn.
»Du sollst dich doch nur rasieren, damit du etwas gleichschaust«, sage ich.
Er folgt mir zögernd. »Wenn du dir etwas davon versprichst …«, murmelt er, blickt in den Spiegel, reibt heftig mit beiden Händen die vom Kopf abstehenden Haare, so dass die Haare hinterher tatsächlich anliegen. Er schaut sich erneut an, sagt »Fast wie neu«, lächelt und bedankt sich herzlich.
Neuerdings bedankt er sich sehr oft. Vor einigen Tagen sagte er, ohne dass ich den geringsten Zusammenhang hätte herstellen können: »Ich bedanke mich recht herzlich bei dir schon im Voraus.«
Auf derartige Eröffnungen reagiere ich mittlerweile entgegenkommend: »Gern geschehen«, sage ich, oder: »Keine Ursache« oder: »Das tue ich doch gern.« Denn erfahrungsgemäß sind bestätigende Antworten, die dem Vater das Gefühl geben, alles sei in Ordnung, besser als das Nachfragen von früher, das ihn nur beschämte und verunsicherte; niemand gibt gerne Antworten auf Fragen, die ihn, wenn er sie überhaupt begreift, nur zur Einsicht in seine Unzulänglichkeiten bringen.
Am Anfang waren diese Anpassungsmaßnahmen schmerzhaft und kräftezehrend. Weil man als Kind seine Eltern für stark hält und glaubt, dass sie den Zumutungen des Lebens standhaft entgegentreten, sieht man ihnen die allmählich sichtbar werdenden Schwächen sehr viel schwerer nach als anderen Menschen. Doch mittlerweile habe ich in die neue Rolle einigermaßen gut hineingefunden. Und ich habe auch gelernt, dass man für das Leben eines an Demenz erkrankten Menschen neue Maßstäbe braucht.
Wenn mein Vater sich bedanken möchte, soll er sich bedanken, auch ohne nachvollziehbaren Anlass, und wenn er sich darüber beklagen will, dass ihn alle Welt im Stich lässt, soll er sich beklagen, egal, ob seine Einschätzung in der Welt der Fakten standhalten kann oder nicht. Für ihn gibt es keine Welt außerhalb der Demenz. Als Angehöriger kann ich deshalb nur versuchen, die Bitterkeit des Ganzen ein wenig zu lindern, indem ich die durcheinandergeratene Wirklichkeit des Kranken gelten lasse.
Da mein Vater nicht mehr über die Brücke in meine Welt gelangen kann, muss ich hinüber zu ihm. Dort drüben, innerhalb der Grenzen seiner geistigen Verfassung, jenseits unserer auf Sachlichkeit und Zielstrebigkeit ausgelegten Gesellschaft, ist er noch immer ein beachtlicher Mensch, und wenn auch nach allgemeinen Maßstäben nicht immer ganz vernünftig, so doch irgendwie brillant.
Eine Katze streift durch den Garten. Der Vater sagt:
»Früher hatte ich auch Katzen, nicht gerade für mich allein, aber als Teilhaber.«
Und einmal, als ich ihn frage, wie es ihm gehe, antwortet er:
»Es geschehen keine Wunder, aber Zeichen.«
Und dann ansatzlos Sätze, so unwahrscheinlich und schwebend, wie sie einem manchmal in Träumen kommen:
»Das Leben ist ohne Probleme auch nicht leichter.«
Witz und Weisheit des August Geiger. Schade nur, dass die Sprache langsam aus ihm heraussickert, dass auch die Sätze, bei denen einem vor Staunen die Luft wegbleibt, immer seltener werden. Was da alles verlorengeht, das berührt mich. Es ist, als würde ich dem Vater in Zeitlupe beim Verbluten zusehen. Das Leben sickert Tropfen für Tropfen aus ihm heraus. Die Persönlichkeit sickert Tropfen für Tropfen aus der Person heraus. Noch ist das Gefühl, dass dies mein Vater ist, der Mann, der mitgeholfen hat, mich großzuziehen, intakt. Aber die Momente, in denen ich den Vater aus früheren Tagen nicht wiedererkenne, werden häufiger, vor allem abends.
Die Abende sind es, die einen Vorgeschmack auf das liefern, was bald schon der Morgen zu bieten haben wird. Denn wenn es dunkel wird, kommt die Angst. Da irrt der Vater rat- und rastlos umher wie ein alter König in seinem Exil. Dann ist alles, was er sieht, beängstigend, alles schwankend, instabil, davon bedroht, sich im nächsten Moment aufzulösen. Und nichts fühlt sich an wie zu Hause.
Ich sitze seit einiger Zeit in der Küche und tippe Notizen in meinen Laptop. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher, und der Vater, der von dort Stimmen hört, schleicht auf Zehenspitzen durch die Diele, lauscht und murmelt mehrmals bei sich:
»Das sagt mir nichts.«
Dann kommt er zu mir in die Küche, tut so, als schaue er mir beim Schreiben zu. Aber ich merke mit einem Seitenblick, dass er Unterstützung braucht.
»Willst du nicht ein bisschen fernsehen?«, frage ich.
»Was habe ich davon?«
»Na ja, Unterhaltung.«
»Ich möchte lieber heimgehen.«
»Du bist zu Hause.«
»Wo sind wir?«
Ich nenne Straße und Hausnummer.
»Na ja, aber viel bin ich hier nie gewesen.«
»Du hast das Haus Ende der fünfziger Jahre gebaut, und seither wohnst du hier.«
Er verzieht das Gesicht. Die Informationen, die er gerade erhalten hat, scheinen ihn nicht zu befriedigen. Er kratzt sich im Nacken:
»Ich glaube es dir, aber mit Vorbehalt. Und jetzt will ich nach Hause.«
Ich schaue ihn an. Obwohl er seine Verstörung zu verbergen versucht, ist ihm anzumerken, wie sehr ihm der Moment zu schaffen macht. Er ist voller Unruhe, Schweiß steht auf seiner Stirn. Der Anblick dieses kurz vor der Panik stehenden Menschen geht mir durch Mark und Bein.
Der quälende Eindruck, nicht zu Hause zu sein, gehört zum Krankheitsbild. Ich erkläre es mir so, dass ein an Demenz erkrankter Mensch aufgrund seiner inneren Zerrüttung das Gefühl der Geborgenheit verloren hat und sich an einen Platz sehnt, an dem er diese Geborgenheit wieder erfährt. Da jedoch das Gefühl der Irritation auch an den vertrautesten Orten nicht vergeht, scheidet selbst das eigene Bett als mögliches Zuhause aus.
Um es mit Marcel Proust zu sagen, die wahren Paradiese sind die, die man verloren hat. Ortswechsel bewirken in so einem Fall keine Besserung, es sei denn durch die bloße Ablenkung, die man genauso gut, wenn nicht besser, durch Singen erreicht. Singen ist lustiger, demente Menschen singen gern. Singen ist etwas Emotionales, ein Zuhause außerhalb der greifbaren Welt.
Apropos Singen: Oft heißt es, an Demenz erkrankte Menschen seien wie kleine Kinder – kaum ein Text zum Thema, der auf diese Metapher verzichtet; und das ist ärgerlich. Denn ein erwachsener Mensch kann sich unmöglich zu einem Kind zurückentwickeln, da es zum Wesen des Kindes gehört, dass es sich nach vorne entwickelt. Kinder erwerben Fähigkeiten, Demenzkranke verlieren Fähigkeiten. Der Umgang mit Kindern schärft den Blick für Fortschritte, der Umgang mit Demenzkranken den Blick für Verlust. Die Wahrheit ist, das Alter gibt nichts zurück, es ist eine Rutschbahn, und eine der größeren Sorgen, die einem das Alter machen kann, ist die, dass es gar zu lange dauert.
Ich schalte den CD-Player ein. Helga, meine Schwester, hat für solche Zwecke eine Sammlung mit Volksliedern gekauft. Hoch auf dem gelben Wagen. – Zogen einst fünf wilde Schwäne. Oft funktioniert der Trick. Wir trällern eine halbe Stunde lang, der alte Mann legt sich zwischendurch so sehr ins Zeug, dass ich lachen muss. Der Vater lässt sich anstecken, und da es ohnehin an der Zeit ist, nutze ich den Moment und dirigiere ihn nach oben in sein Schlafzimmer. Er ist jetzt guter Stimmung, obwohl es mit dem Überblick über Zeit, Raum und Ereignisse noch immer schlecht steht; aber das bereitet ihm im Moment kein Kopfzerbrechen.
Nicht siegen, überstehen ist alles, denke ich und bin von diesem Tag mittlerweile mindestens ebenso erschöpft wie der Vater. Ich sage ihm, was er zu tun hat, bis er in seinem Pyjama steckt. Er schlüpft von selbst unter die Decke und sagt:
»Hauptsache, ich habe einen Platz zum Schlafen.«
Er blickt um sich, hebt die Hand und grüßt jemanden, der nur für ihn vorhanden ist. Dann sagt er:
»Man kann es hier schon aushalten. Es ist eigentlich ganz nett hier.«
Wie geht es dir, Papa?
Also, ich muss sagen, es geht mir gut. Allerdings unter Anführungszeichen, denn ich bin nicht imstande, es zu beurteilen.
Was denkst du über das Vergehen der Zeit?
Das Vergehen der Zeit? Ob sie schnell vergeht oder langsam, ist mir eigentlich egal. Ich bin in diesen Dingen nicht anspruchsvoll.
Die Schatten der Anfänge verfolgen mich noch immer, obwohl die Jahre einen gewissen Abstand hergestellt haben. Wenn ich aus dem Fenster hinunter auf den winterstarren Obstgarten schaue und daran zurückdenke, was mit uns passiert ist, überkommt mich das Gefühl eines vor langer Zeit begangenen Fehltritts.
Die Krankheit des Vaters fing auf so verwirrende Weise langsam an, dass es schwierig war, den Veränderungen die richtige Bedeutung beizumessen. Die Dinge schlichen sich ein wie in der Bauernsage der Tod, wenn er draußen auf dem Gang mit seinen Knochen klappert, ohne sich zu zeigen. Wir hörten das Geräusch und dachten, es sei der Wind im langsam verfallenden Haus.
Die frühesten Anzeichen der Krankheit zeigten sich Mitte der neunziger Jahre, doch gelang es uns nicht, die Ursache richtig zu deuten. Mit bitterem Kopfschütteln erinnere ich mich an die Renovierung der Terrassenwohnung, als der Vater die Betondeckel der ehemaligen Klärkammern zerschlug, weil er die Deckel alleine nicht hochheben und zurück in die Öffnung legen konnte. Das war nicht die erste Situation, in der ich den Eindruck hatte, er mache mir das Leben mutwillig schwer. Wir schrien einander an. Während der weiteren Arbeiten verließ ich das Haus regelmäßig in der Angst, dass mich beim Nachhausekommen die nächste böse Überraschung erwarten werde.
Dann der Besuch eines Redakteurs vom Schweizer Radio. Auch dies ein Tag, der sich ins Gedächtnis eingeprägt hat. Das war im Herbst 1997, kurz nach Erscheinen meines ersten Romans. Ich sollte ein Kapitel des Buches auf Band lesen und bat den Vater, am Nachmittag keinen Lärm zu machen. Kaum hatte die Aufnahme begonnen, setzte in der Werkstatt ein beständiges Hämmern ein, das andauerte, solange das Mikrophon des Redakteurs offen war. Noch während ich las, empfand ich einen tiefen Zorn auf den Vater, ja geradezu Hass wegen seiner Rücksichtslosigkeit. In den Tagen darauf ging ich ihm aus dem Weg, ich redete tagelang kein Wort mit ihm. Die Parole lautete: Sabotage.
Und wann hat Peter geheiratet, mein älterer Bruder? Das war 1993. Bei der Hochzeitsfeier verdarb sich der Vater den Magen, weil ihm das Maß abhandengekommen war und er nach dem mehrgängigen Essen zehn oder fünfzehn Tortenstücke verschlang. Spätnachts schleppte er sich nach Hause und lag dort zwei Tage mit heftigen Schmerzen im Bett. Er hatte Angst zu sterben, tat aber niemandem leid, denn wir dachten, es geschehe ihm recht. Niemand sah, dass er langsam seine alltagspraktischen Fähigkeiten verlor.
Die Krankheit zog ihr Netz über ihn, bedächtig, unauffällig. Der Vater war schon tief darin verstrickt, ohne dass wir es merkten.
Während wir Kinder die Zeichen missdeuteten, muss das Gefühl, mit dem er selber die Veränderungen an sich wahrnahm, qualvoll gewesen sein, die bohrende Angst, dass etwas Feindliches sich seiner bemächtigte, gegen das er sich nicht wehren konnte. Dazu geäußert hat er sich nie, das verhinderte seine Verschlossenheit, seine Unfähigkeit, Gefühle mitzuteilen. Das lag nicht in seinem Charakter, er hatte es nie getan, und jetzt war es zu spät, damit anzufangen. Zu allem Unglück hatte er diese Unfähigkeit an seine Kinder weitergegeben, weshalb auch von dort kein nennenswerter Vorstoß kam. Niemand fasste sich ein Herz. Wir ließen den Dingen ihren Lauf. Ja, gut, der Vater hatte merkwürdige Momente. Aber hatte er die nicht immer schon gehabt? – Sein Verhalten war eigentlich normal.
Tatsächlich schien alles Merkwürdige zunächst nur ein nachvollziehbares Resultat bestimmter Charaktereigenschaften in Konfrontation mit einer neuen Situation zu sein. Der Vater wurde älter, aber vor allem hatte ihn seine Frau nach dreißig Jahren Ehe verlassen. Die Vermutung, dass es ihm deshalb an Antrieb fehlte, lag nahe.
Die Trennung hatte ihm schwer zu schaffen gemacht, er war strikt gegen eine Scheidung gewesen, einerseits weil er mit meiner Mutter zusammenbleiben wollte, andererseits weil es für ihn Dinge gab, die streng bindend sind. Er hatte nur unzureichend mitbekommen, dass sich die Belastbarkeit gewisser Konventionen abgenutzt hatte. Sehr im Gegensatz zu den heute flexiblen Lebensentwürfen hielt er an einer vor Jahrzehnten getroffenen Entscheidung fest und wollte ein gegebenes Gelübde nicht brechen. Auch hierin gehörte er einer anderen Generation an als seine um fünfzehn Jahre jüngere Frau. Für sie stand nicht der Ruf oder ein Versprechen auf dem Spiel, sondern ein Leben mit der Möglichkeit, anderswo glücklich zu werden. Während die Mutter das Haus verließ, harrte der Vater innerlich bei der toten Beziehung aus, treu der verlorenen Sache.
Das Weggehen der Mutter leitete beim Vater eine Zeit des Brütens und der Tatenlosigkeit ein. Es war, als sei die letzte Feder in ihm gesprungen. Sogar die Gartenarbeit gab er auf, obwohl er wusste, dass seine Kinder beruflich sehr eingespannt waren und unter der zusätzlichen Belastung stöhnten. Der Vater entband sich selbst von praktisch allem, keine Spur mehr vom früheren Eifer, mit dem er jahrzehntelang seine Vorhaben vorangetrieben hatte. Lapidar verkündete er, dass jetzt die Jungen an der Reihe seien, er selber habe in seinem Leben genug gearbeitet.
Diese Ausreden ärgerten uns, und Ausreden waren es, wenn auch für etwas anderes als für das, was wir vermuteten. Wir dachten, seine Defizite kämen vom Nichtstun. Dabei war es umgekehrt, das Nichtstun kam von den Defiziten. Weil ihm auch kleinere Aufgaben über den Kopf wuchsen und er merkte, dass er die Kontrolle verlor, trat er jegliche Verantwortung ab.
Statt täglich die Tomatenstauden zu gießen, verbrachte er seine Zeit mit Patiencenlegen und Fernsehen. Ich erinnere mich, wie übel mir seine monotonen Freuden aufstießen. Für mich, der ich zu dieser Zeit versuchte, beruflich auf die Beine zu kommen, roch sein Leben nach dumpfer Gleichgültigkeit. Patiencenlegen und Fernsehen? Das ist auf Dauer kein Lebensinhalt, dachte ich, und ich machte aus meiner Meinung kein Hehl. Ich beschwor den Vater, ich stichelte und provozierte, redete von Trägheit und fehlendem Mumm. Doch auch die hartnäckigsten Versuche, ihn aus seiner Benommenheit zu reißen, scheiterten kläglich. Mit der Miene eines Pferdes, das reglos im Gewitter steht, ließ er die Angriffe über sich ergehen. Dann setzte er seinen Alltagstrott fort.
Hätte ich damals nicht mehrere Monate im Jahr zu Hause verbringen müssen, damit ich als Ton- und Videotechniker auf der Bregenzer Seebühne das Geld verdiente, das das Schreiben nicht abwarf, hätte ich einen weiten Bogen um das Elternhaus gemacht. Nach wenigen Tagen des Aufenthalts senkte sich dort unendliche Trübsal auf mich herab. Meinen Geschwistern ging es ähnlich. Nach und nach zogen alle aus. Die Kinder stoben auseinander. Die Luft um den Vater wurde dünner.
So etwa stand es um unsere Gemütsverfassungen im Jahr 2000. Die Krankheit fraß sich nicht nur ins Gehirn des Vaters, sondern auch in das Bild, das ich mir als Kind von ihm gemacht hatte. Meine ganze Kindheit lang war ich stolz gewesen, sein Sohn zu sein. Jetzt hielt ich ihn zunehmend für einen Schwachkopf.
Es wird wohl stimmen, was Jacques Derrida gesagt hat: dass man stets um Vergebung bittet, wenn man schreibt.
Tante Hedwig erzählt, einmal hätten Emil – der älteste der sechs Brüder meines Vaters – und sie einen Besuch bei ihm gemacht. Emil hatte die Haarschneidemaschine und das Umhängetuch dabei, Tante Hedwig weiß aber nicht mehr, ob sich mein Vater auf einen Haarschnitt eingelassen hat. Es sei mitten am Nachmittag gewesen. Im Wohnzimmer auf dem Couchtisch sei zu Tante Hedwigs Erstaunen ein Teller mit Sugoresten gestanden. Später sei meinem Vater ein Glas hinuntergefallen, er habe hilflos geschaut, worauf Tante Hedwig ihm das Angebot gemacht habe, die Scherben wegzuräumen. Sie habe ihn gefragt, wo der Kehrwisch sei. Er habe es ihr nicht sagen können, habe sie angeschaut, und plötzlich habe er Tränen in den Augen gehabt. In diesem Moment habe sie Bescheid gewusst.
Darüber geredet hätten sie nicht. Lautlos focht der Vater den Kampf mit sich selber aus. Er machte keine Erklärungsversuche. Er machte keine Ausbruchsversuche – bis auf die Wallfahrt nach Lourdes.
Das war 1998 mit Maria, der ältesten seiner drei Schwestern, die von allen Mile genannt wird, mit Erich, dem jüngsten überlebenden Bruder, und Waltraud, der Schwägerin. Der Vater, der mit seiner Frau und seinen Kindern kein einziges Mal in den Urlaub gefahren war, weil er die Welt angeblich im Krieg gesehen hatte, trat eine vergleichsweise lange Reise an in der schmalen Hoffnung auf Gnade.
Da steht man dann und lächelt leer und betet nachts und – als ob die Nachtgebete keine Macht hatten – morgens gleich wieder.
Mile, die schon damals nicht gut auf den Beinen war, soll zu ihm gesagt haben:
»Du kannst für mich gehen, und ich kann für dich denken.«