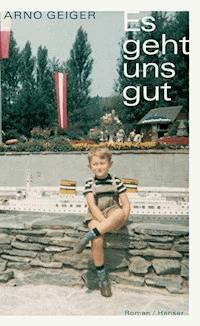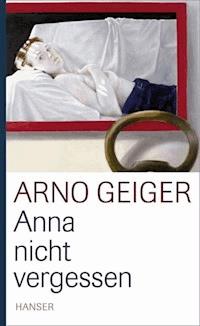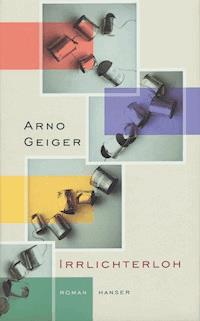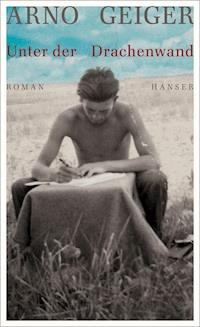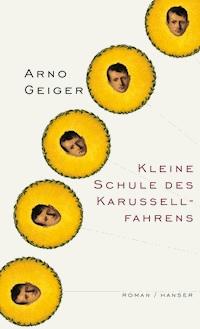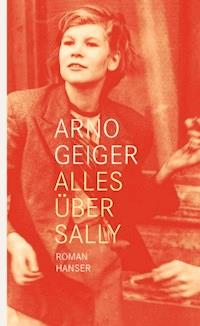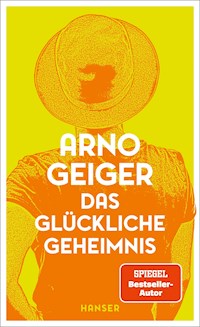
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Anläufen und Enttäuschungen, vom Finden und Wegwerfen. Und vom Glück des Gelingens. Das neue Buch von Arno Geiger Frühmorgens bricht ein junger Mann mit dem Fahrrad in die Straßen der Stadt auf. Was er dort tut, bleibt sein Geheimnis. Zerschunden und müde kehrt er zurück. Und oft ist er glücklich. Jahrzehntelang hat Arno Geiger ein Doppelleben geführt. Jetzt erzählt er davon, pointiert, auch voller Witz und mit großer Offenheit. Wie er Dinge tat, die andere unterlassen. Wie gewunden, schmerzhaft und überraschend Lebenswege sein können, auch der Weg zur großen Liebe. Wie er als Schriftsteller gegen eine Mauer rannte, bevor der Erfolg kam. Und von der wachsenden Sorge um die Eltern. Ein Buch voller Lebens- und Straßenerfahrung, voller Menschenkenntnis, Liebe und Trauer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Von Anläufen und Enttäuschungen, vom Finden und Wegwerfen. Und vom Glück des Gelingens. Das neue Buch von Arno GeigerFrühmorgens bricht ein junger Mann mit dem Fahrrad in die Straßen der Stadt auf. Was er dort tut, bleibt sein Geheimnis. Zerschunden und müde kehrt er zurück. Und oft ist er glücklich. Jahrzehntelang hat Arno Geiger ein Doppelleben geführt. Jetzt erzählt er davon, pointiert, auch voller Witz und mit großer Offenheit. Wie er Dinge tat, die andere unterlassen. Wie gewunden, schmerzhaft und überraschend Lebenswege sein können, auch der Weg zur großen Liebe. Wie er als Schriftsteller gegen eine Mauer rannte, bevor der Erfolg kam. Und von der wachsenden Sorge um die Eltern. Ein Buch voller Lebens- und Straßenerfahrung, voller Menschenkenntnis, Liebe und Trauer.
Arno Geiger
Das glückliche Geheimnis
Hanser
für Katrin
Immer hatte ich ein heimliches Leben,
und immer war das mein wahres Leben.
Imre Kertész, Galeerentagebuch
Es gibt dunkle Geheimnisse, und es gibt glückliche Geheimnisse. Mein glückliches Geheimnis bestand fünfundzwanzig Jahre lang darin, dass ich in Wien ausgedehnte Streifzüge machte und die an den Straßen stehenden, für Altpapier vorgesehenen Behältnisse erkundete auf der Suche nach für mich Interessantem. Mir ist klar, das ist keineswegs alltäglich, obwohl es um Alltägliches geht, um eines der wenigen Dinge, die allen Menschen zugänglich sind: Abfall. Trotzdem muss ein Mensch, damit er sich aus freien Stücken so viele Jahre mit diesem Alltäglichen abgibt, ein wenig wahnsinnig sein. Selbstverständlich halte ich mich nicht für wahnsinnig. Aber der vom Wahnsinn freie Teil meines Verstandes sagt, dass ein Quäntchen Wahnsinn sehr wohl vorhanden sein muss. Ein glücklicher Wahnsinn, gibt der wahnsinnige Teil in mir zur Antwort.
Fünfundzwanzig Jahre. Unsere Gesellschaft ist ein auf Hochtouren laufender Wegwerfbetrieb, er produziert einen nicht abreißenden Strom aus Abfall. Aus diesem Strom, der täglich an uns vorbeiflutet, mächtig wie der Mekong, zog ich zwischendurch ein Stück heraus. Was ich tat, war, als finge ich Wasser in einem Sieb. Angesichts der schieren Masse an Weggeworfenem war das Wenige, das ich nach Hause trug, vergleichbar mit dem Wasser, das dank gewisser Oberflächenspannungen in den Löchern eines Siebes hängenbleibt.
Mittlerweile habe ich diese Tätigkeit aufgegeben. Aber ein Vierteljahrhundert auf der Straße, beschäftigt mit dem, was andere Menschen wegwerfen, fügt einer Person Dinge hinzu, die man nicht einfach wieder entfernen kann. Ein Vierteljahrhundert war Weggeworfenes Teil meines Lebens. Die Persönlichkeit kann nur für kurze Zeit unabhängig bleiben von dem, was sie tut. Wenn einer jahrzehntelang Woche für Woche, sofern die Umstände es zulassen, einer Tätigkeit nachgeht, die üblicherweise Sache der Ausgestoßenen ist, wirkt diese Tätigkeit auf seine Person. Meine Runden haben mich als Mensch so sehr geprägt, wie sie mich als Schriftsteller geprägt haben. Und das ist das Beste, was ich darüber sagen kann.
Müll ist ein gewaltiges Thema, gewaltig nicht nur als Rohstoffressource, sondern auch als kulturelle Ressource, als Unterabteilung des kulturellen Gedächtnisses, als Niederschlag einer Kultur. Müll birgt die Kraft, ganze Stadtviertel mit Energie zu versorgen. Aber er vermag auch, kreative Prozesse anzutreiben. Denn in den Müll kommt, was erledigt ist, und in diesem Erledigten gibt eine Gesellschaft Auskunft über sich selbst. Für Archäologen sind ehemalige Stadtgräben, die mit Abfall aufgefüllt wurden, Goldadern. Die Archäologen wissen: Das Erledigte verkörpert eine Epoche so gut wie das bedeutendste Kunstwerk. Im Müll wohnt die Wahrheit. Und die Wahrheit muss irgendwann heraus: Das Leben besteht aus Unordnung, Verwirrung, Dreck und Tod. Wie ein wüst hingeschütteter Misthaufen ist die schönste, vollkommenste Welt.
So bin ich einer, der sich der schönsten, vollkommensten Welt verschrieben hat. Davon handelt diese Erzählung. Und ich weiß, dass ein solcher Text, wenn er gut geschrieben ist, besser klingt, als er klingen dürfte. In der Stilisierung dessen, was ich erlebt habe, in der subjektiven Darstellung von dem, was früher war und jetzt in Worte gefasst wird, gehört meine Erzählung der Literatur an.
Der Mann der Straße betritt ein Haus, betritt eine Wohnung, setzt sich an den Schreibtisch und macht sich Notizen. Indem ich mir Notizen mache über das, was mir in meinem Leben zugestoßen ist, verwandelt sich der Mann der Straße in einen Mann der Schrift.
Es fehlt nicht viel, dann sind es drei Jahrzehnte, seit es angefangen hat. Ich war vierundzwanzig Jahre alt, strebte keine Anstellung an, weil ich Schriftsteller werden wollte, und lebte in Wien in einem Haus, das dem Aussehen nach kurz vor dem Abriss stand. In diesem heruntergekommenen Haus bewohnte ich eine heruntergekommene Wohnung, dreißig Quadratmeter, bestehend aus einer engen Küche und einem an die Küche anschließenden Zimmer. Dieses Zimmer hatte die Aufgaben von Wohn-, Arbeits-, Ess- und Schlafraum zu erfüllen. Das Klo auf dem Gang teilte ich mit den Nachbarn.
Für das kärgliche Inventar der Wohnung hatten meine Eltern zwei Jahre zuvor eine beträchtliche Summe an illegaler Ablöse bezahlt, eine gängige Praxis im damaligen, von Wohnungsnot geprägten Wien. Diese Investition sollte wieder hereinkommen durch die außerordentlich niedrige Miete und meinen Willen zur Sparsamkeit. Die Wohnung befand sich nicht weit entfernt von der Oper in zentraler Lage. Hier hatte ich einen Platz, der manchmal von Sonnenlicht und manchmal von Liebe beschienen war. Als weiteren Vorzug empfand ich die unmittelbare Nähe zum Naschmarkt mit seinen billigen Lebensmitteln und dem Flohmarkt am Samstag. Dort bekam ich alles, was ich brauchte, Bücher und Stifte ebenso wie Hausrat und Kleidung.
Die Wohnung wirkte nach außen hin deprimierend mit den von meinen Eltern abgelösten, zweieinhalb Meter hohen Schrankwänden und dem alten Bettüberwurf. Aber ich betrachtete sie als mein Zuhause und schätzte mich glücklich, dass ich diesen Ort hatte und eine Tür, die ich hinter mir schließen konnte. Oft lernte ich für Prüfungen, oft schrieb ich an einem Roman. Ich hatte eine Freundin, M., sie gab sich Mühe, das von mir Geschriebene zu lesen, schlief aber meistens darüber ein. Ich merkte es, wenn ich, am Schreibtisch sitzend, in meinem Rücken kein Blättern mehr hörte. M. schlief sehr still. Brauchte ich selbst etwas zum Lesen, ging ich auf den Flohmarkt. Dann kehrte ich nicht mit einem, sondern mit zehn Büchern zurück. Mir erschien die Zukunft so ungeheuer groß und weit, dass ich bedenkenlos auf Vorrat kaufte. Dabei war ich eigensinnig genug, das Ausgefallene dem Gängigen vorzuziehen.
Im Rückblick, in der Sturzflut der Tage, ich muss sagen: M. und ich waren Kinder der Provinz, unsicher und fleißig. Schmusen und Herumhängen fanden wir schön, hielten es aber nicht lange durch. Wir praktizierten auch das Schmusen und Herumhängen mit Konzentration, nicht, wie andere, mit Ausdauer. Wir waren ständig in Bewegung, neugierig, auf unser Weiterkommen bedacht.
Beim Marktamt auf der Kettenbrücke, an dem ich auf dem Weg zum Einkaufen beinahe täglich vorbeiging, befand sich eine große Müllstation mit mehreren Papiercontainern. Dort stieß ich eines Tages auf fünf hier als Abfall hingestellte Bananenkartons mit Büchern. Ein Zufall. Oder scheint es nur so? Vielleicht ist Zufall allein nicht das richtige Wort, denn ich war so begeistert von der großen Stadt, dass ich meine Augen immer offen hatte. Früher oder später musste es so kommen.
Von der U-Bahn-Station winkte ich ein Taxi herüber und ließ mich mit den Kartons zu meiner Wohnung fahren. Zu Hause zog ich die Deckel der Kartons mit Herzklopfen hoch. Dieses spezifisch scheuernde Geräusch des Kartons habe ich noch immer in den Ohren. Ich erinnere mich an Felix Dahn, Ein Kampf um Rom, an Johanna Spyri, Heidi, und an einen noch heute sich in meinem Regal schmal machenden Katalog über Plakate zu Ausstellungen von Joseph Beuys. "Zeige deine Wunde!"
An diesem Tag kam ich mit den Möglichkeiten, die eine öffentliche Müllstation bergen kann, in Fühlung. Und immer, wenn ich fortan an dieser Müllstation vorbeiging, spähte ich in die Papiercontainer. Erstaunlich oft fand ich etwas, nach dem ich mich streckte, Bücher, Fotografien, Zeitschriften und Zeitungen. Eine FAZ war für mich ein Wertgegenstand.
Was der Feuerfunke auf ein geladenes Gewehr, ist die Gelegenheit zur Neigung. Ich dachte, warum nur in den einen Papiercontainer schauen, wenn es in der Stadt abertausende gibt. So kam es, dass ich vom guten Weg abwich und aufs Geratewohl losmarschierte auf ein Terrain, das gekennzeichnet ist von Schmutz und fehlender Schicklichkeit. Ich geriet in etwas hinein, das sich zunächst als Irrsinn erwies und später als eine gute Sache.
Wenn man jung ist, ist alles einfach wie Messer und Gabel, wie das Gras auf der Wiese, wie die Taube auf dem Dach. Ich dachte mir nicht viel dabei, wenn ich, bekleidet mit meiner ältesten Jeans und einer strapazierfähigen Jacke, die Straßen entlangtrottete und zwischendurch drei Bücher in meinen Rucksack schob. Während des Gehens überarbeitete ich meine beiden mit Anfang zwanzig geschriebenen Romane, die ich auswendig kannte. Oder ich ließ eine lethargische Stimme in meinem Kopf über Vergangenheit und Zukunft räsonieren. Oder ich brachte diese Stimme zum Verstummen, indem ich Gedichte aufsagte.
Das Gehen war in meinen Augen eine gesunde Sache, mehrere Stunden an der frischen Luft bei leicht erhöhtem Puls. Das viele Bücken und Tauchen in die Tiefen der Behältnisse und das Umdrehen nach links und rechts, um zu sehen, ob sich von hinten jemand nähert, war gut für den Rücken. Am Schreibtisch wird man steif und einseitig.
Nach etwa vier Stunden kehrte ich erschöpft nach Hause zurück. M., die mittlerweile bei mir eingezogen war und mithalf, die Wohnverhältnisse zu beengen, begrüßte mich mit einem strengen Blick. Sie hatte sehr lange, glamouröse Wimpern und auffallend dunkle Augen. Sie sagte:
»Du siehst aus wie ein Räuberhauptmann.«
»Ja?«
»Man muss sich regelrecht schämen für dich.«
Tatsächlich erhob die Kleidung, die ich trug, keinen Anspruch auf Eleganz. Zum Ende einer Runde präsentierte ich mich meistens in einem beklagenswerten Zustand, dreckig wie ein Schwein. Das war aber nicht der einzige Grund, weshalb M. meine Ausflüge missfielen. Wir waren Mittelschichtkinder aus dem wohlhabenden Westen Österreichs, unweit der Schweizer Grenze, wo nicht nur das Gras fett ist. Immer wieder erstaunlich, wie doch jeder Mensch an seine Vergangenheit gebunden ist. Mit meinem Stöbern in Dingen, die andere weggeworfen hatten, verstieß ich gegen die Konventionen meiner Herkunft. Wo M. und ich herkamen, besaßen die Menschen ein grundsätzliches Bedürfnis, die Form zu wahren. Dort schätzte man die Verfechter von Gepflogenheiten mehr als diejenigen, die sich darüber hinwegsetzen. Und genau genommen waren die Menschen in Wien nur wenig besser. Der manchmal geradezu chinesisch anmutende Hang zur Etikette, dem ich in Wien begegnete, ermunterte ebenfalls nicht zum Sprung über alle Schranken.
Wenn ich zur Ablenkung einen Band mit Gedichten von Sergej Jessenin aus meinem Rucksack zog, war auch M.s Neugier geweckt. Ich las ihr das auf den Einband des Buches gedruckte Gedicht vor, und sie hob ihre glamourösen Wimpern:
»Schon verrückt, dass jemand das wegwirft.«
"Und ich sah durch Nebelhüllen / gestern, als der Busch mir flirrte, / wie der Mond, das rote Füllen, / sich an unsern Schlitten schirrte."
Um nicht weiter diskutieren zu müssen, verdrückte ich mich unter die Dusche, die ganz hinten in die Küche gezwängt war. Anschließend verschlang ich vier oder fünf Brote mit Dauerwurst, von der mir meine Mutter regelmäßig eine Stange schickte. Dann setzte ich mich an den Schreibtisch.
Ich hatte Freude an meinen Streifzügen. Ich mochte das stundenlange Gehen und das Unabsehbare bei dem, was mir begegnete. Jede Runde war etwas zunächst Verschlossenes, ein latentes Geheimnis: Was finde ich diesmal? Etwas Großartiges? Oder nichts? Im Übrigen wusste ich es zu schätzen, dass mir die Runden halfen, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich stand kurz vor dem Abschluss des Studiums und war mir weitgehend darüber im Klaren, dass mein Entschluss, Schriftsteller zu werden, mit Gefahren verbunden war. Schreibend setzte ich auf ein Spiel, dessen Regeln ich nicht kannte. Ich wusste lediglich aus der Lektüre einschlägiger Biografien, dass dieses Spiel für Verlierer eine besondere Strafe bereithält: echtes Scheitern. Deshalb arbeitete ich mit dem guten Willen eines jungen Menschen, der weiß, dass sein Unternehmen schiefgehen wird, wenn er nicht sein Bestes gibt. Aber mulmig war mir bis hin zur Angst. Entsprechend beruhigend fand ich es, dass ich neben meinem Sommerjob als Technikgehilfe bei den Festspielen in Bregenz jetzt auch in Wien einen kleinen Nebenerwerb hatte.
In überraschender Regelmäßigkeit stieß ich auf große Mengen teils wertvoller Bücher, Briefmarkensammlungen, historische Wertpapiere, alte Comics, alte Autoprospekte, Druckgrafiken und Plakate, die ich ins Auktionshaus trug. Zum Verkauf des weniger Wertvollen stellten M. und ich uns dreimal im Jahr auf den Flohmarkt. Dabei blieb ich ohne Verpflichtung, ohne Bindung an einen Dienstgeber, unabhängig und frei für das Schreiben.
Die nie verebbende Versorgung mit Postkarten, Kuverts und kleinen Büroartikeln war mir von angenehmem Nutzen. Zum Ausdrucken meiner Texte verwendete ich nicht mehr gekauftes, sondern gefundenes Papier, Geschäftspapier der Firma Strohbach & Pötscher. Davon besaß ich große Mengen. Herr Klimsza, der unmittelbare Nachbar, ein Bäcker, sah das Papier in Stapeln bei mir liegen und sagte:
»Arno, damit kannst du schreiben bis zum Zentralfriedhof.«
Ich las irrsinnig viel, ich las buchstäblich, was mir der Zufall auf den Schreibtisch warf. Damals machte ich meine Runde Montagvormittag. Irgendetwas fand ich fast immer. Und bis zum nächsten Montag war das Gefundene gelesen, das kam oft vor.
Vom Markt trug ich argentinische Birnenkisten nach Hause. Genagelt aus Leichtholz und klein im Format, ließen sie sich zu einem ständig erweiterbaren Bücherregal stapeln. Einen der fast drei Meter hohen Schränke räumten M. und ich frei, er bekam einen Namen und hieß fortan Geschäft. Dort deponierten wir die Bananenkartons mit den für den Flohmarkt bestimmten Büchern.
Als M. und ich am Abend nach unserem ersten Verkauf das Geld zählten, hatten wir sechstausend Schilling eingenommen — ungefähr die sechsfache Monatsmiete. Durch die Brille der mir gesetzten finanziellen Möglichkeiten blickend, war es, als hätte ich ein Pharaonengrab entdeckt. Das Wort Papier kommt von Papyrus. Auf Papyrus hatte der Pharao ein Privileg. Papier bedeutet in seinem Wortstamm sinngemäß: Was dem Pharao gehört.
Ein halbes Jahr später, beim zweiten Verkauf, nahmen wir das Doppelte ein. M. und ich tanzten vor Freude. Wir verkauften nach Bauchgefühl, auf der Basis von Vermutung oder einfach auf gut Glück, im Zweifelsfall billig, denn Internet gab es nicht, das waren andere Zeiten, kaum zu fassen. Oft lagen wir mit unserem Bauchgefühl daneben, das belebte das Geschäft. Es war aber ohnehin sinnvoller, ein Buch billig zu verkaufen, als es wieder nach Hause zu tragen. Wozu denn? Mit Nachschub war zu rechnen.
Auf dem Heimweg schob ich die von den Klimsza-Nachbarn geborgte Sackkarre mit den gestapelten, jetzt beinahe leeren Kartons ohne Anstrengung die Straße hoch. Selbst die unverkauften Bücher waren in der Sonne leichter geworden, die Deckel wölbten sich, so ausgedörrt war das Papier. Die Sackkarre klapperte und hüpfte ein wenig, was in der Früh undenkbar gewesen wäre, alles bleischwer.
Ich mag den Ausdruck leichtes Geld. Er passt zum Körpergefühl, das ich beim Nachhausegehen hatte, nach zwölf Stunden auf den Beinen, viel Sonne und Staub. Die Muskeln warm, alles pulsierend. M. und ich trugen lederne Umhängegeldtaschen, die meine Geschwister und ich, als wir Kinder gewesen waren, für den Urlaub mit der Naturschutzjugend erhalten hatten. Diese Brustbeutel zogen im Laufe des Tages immer schwerer um den Hals vom vielen leichten Geld. Wenn ich daran denke, spüre ich das Scheuern des Lederriemens im Nacken.
Wir verräumten die leeren und halbleeren Kartons in den Schrank, der den Namen Geschäft trug. Wir stellten uns unter die Dusche, gingen hinüber zu den Klimsza-Nachbarn und warfen auf deren Esstisch das eingenommene Geld in eine große Keramikschüssel, einen sogenannten Weidling. Unter großem Hallo wurde gezählt. Es fühlte sich an, als könnten wir wie Dagobert Duck im Geldspeicher schnorcheln. Anschließend servierte Frau Klimsza ein Brathuhn mit Kartoffeln. Ich war sehr hungrig. Und später, wenn alle vor dem Fernseher durcheinanderredeten, schlief ich vor Erschöpfung fast ein.
Aber im Bett redeten M. und ich weiter:
»Der Mann, der die illustrierte Edda gekauft hat —. Hast du sein Gesicht gesehen? Er war so glücklich!«
M. unterstützte mich bei diesen Verkäufen, sie deckte mein Geheimnis. Trotzdem blieb sie bei ihren Vorbehalten, meine Runden waren ihr nicht geheuer. Ganz wohl war auch mir nicht, wenngleich ich mich hütete, das Thema anzusprechen, es war so ein Gefühl, dass an der Sache etwas Schmuddeliges ist, man wühlt nicht im Abfall anderer Menschen. Überdies war anzunehmen, dass mein Räuberzivil, wenn ich unterwegs war, tatsächlich abgerissener aussah, als ichs mir zugeben wollte. Die eigene Abgerissenheit hält man ja leicht für pittoresker als die der anderen. Wenn M. wieder sagte, ich sähe aus wie ein Strolch, mein Gott, ein Junge mit deinem Verstand! — dann spürte ich die Scham. Dann spürte ich die Verletzung meiner sozialen Selbstansprüche. Ich rückte gerade in erster Generation unter die Akademiker auf und wurde die konventionellen Vorstellungen von dem, wie sich ein zu akademischen Ehren gekommener junger Mensch zu verhalten hat, nicht so leicht los. Dass ich mich jetzt Teilzeit in die Gosse warf, empfand auch ich insgeheim als Grenzüberschreitung nach unten. Wer tat, was ich tat, war nach dem Sittenmaß der damaligen Zeit sozial markiert und gehörte zum gesellschaftlichen Bodensatz.
Interessanterweise hatte ich es nicht mit einem Verbot zu tun, sondern mit einem Tabu. Ein Tabu betrifft ja zuweilen ganz harmlose Dinge wie Rotzfressen in der Öffentlichkeit. Man schämt sich für das genüssliche Rotzfressen, wenn man dabei ertappt wird, mitunter mehr als für das Ignorieren einer roten Ampel. Ein Tabu bezeichnet die Grenze des Vertretbaren. Aber weder ist diese Grenze genau definiert noch erfolgt gegen einen Verstoß eine bestimmte vorgesehene Sanktion. Es ist lediglich eine Frage der Schicklichkeit.
Während meiner Runden begegnete ich oft Behördenvertretern, sie nahmen an dem, was ich tat, nicht den geringsten Anstoß — derlei gehört zum Stadtbild. Wenn man wie Wien Weltstadt sein will, muss man sich gewisse Dinge gefallen lassen, eine Weltstadt ist kein Kasernenhof. Doch hätte ich meinen Eltern offenbart, dass ich mich wöchentlich einmal einen halben Tag lang durch den papierenen Abfall dieser Welt grub, wäre meine Mutter, nehme ich an, unglücklich gewesen und mein Vater, nehme ich an, ernüchtert. Die beiden hatten viel Geld aufbringen müssen, um allen vier Kindern eine höhere Bildung zu ermöglichen. Und jetzt das!
Ja, gut. Der Verzicht auf Bewunderung verschafft einen Zugewinn an Freiheit. Das gilt in vielen Lebensbereichen und natürlich auch für das Schreiben.
Mit dem Abschluss des Studiums endete das Zwischenreich der Jugend. Jetzt bestand die Herausforderung darin, eine Daseinsform zu finden, die einen Namen hatte und als Antwort dienen durfte, wenn ich gefragt wurde:
»Was machen Sie beruflich, junger Mann?«
»Schriftsteller«, hätte ich zur Antwort geben können. Doch Schriftsteller war ich in meinen Augen erst, wenn andere mich so bezeichneten. Damit war vorerst nicht zu rechnen. Zwar arbeitete ich beharrlich, hatte bislang aber nichts veröffentlicht. Und die alternative Antwort, »Kleinhändler von Waren aller Art«, kam nicht in Betracht aus Gründen der Scham.
Es ist immer schwer, aus einer Gestalt in die andere zu treten. Die Momente des Übergangs sind schmerzhaft. Während der nächsten Jahre lebte ich in einem Zwischenreich, das unangenehmer war als dasjenige der Jugend: im Zwischenreich der Erfolglosigkeit. Die schlechtesten Jahre meines Lebens. Die Hälfte der Zeit hatte ich Angst vor der Zukunft, und die andere Hälfte machte ich mir Vorwürfe, weil ich so verzagt war.
So richtig glücklich fühlte ich mich nur im Sommer auf der Seebühne in Bregenz, einer Opernbühne im Bodensee, wo ich als Gehilfe bei der Tontechnik für drei Monate eine definierte Identität besaß. Dort durfte ich mir die Hose mit einem Kälberstrick binden, wenn es mir gefiel, es kümmerte niemanden. Theaterbetrieb. Auf der Seebühne traf sich viel buntes Volk. Während dieser Monate hätte man sogar bei einem wie mir etwas von der Magie des Jungseins einfangen können. Wir fühlten uns frei wie junge Hunde. Wir blödelten bei der Arbeit, beim Einbauen der großen, teils achtzig Kilogramm schweren Lautsprecher in die Kulissen oder beim Verlegen der Kabel im Dreck der Unterbühne. Zwischendurch fiel einer von uns in voller Montur in den See, und die andern lachten.
Mit Beginn des Vorstellungsbetriebs wurde es ruhiger. Wenn alles störungsfrei lief und Fidelio und Rocco allabendlich Florestans Grab schaufelten, saßen wir auf Abruf und spielten Karten. Oder ich las ein Buch.
Mitte September kehrte ich nach Wien zurück, ein ums andere Jahr. Von meiner kleinen Wohnung wusste ich jetzt durch die Lektüre eines aus dem Altpapier gefischten Romans, dass Dostojewski derlei Zimmer beschrieb, wenn er für einen armen Teufel eine passende Bleibe benötigte. Ich lebte dort unter seltsamen Umständen. Zum Beispiel pinkelte ich nächtens ins Waschbecken, weil ich nicht im Pyjama hinaus auf den dunklen und kalten Gang tappen wollte. Dort klapperten die losen Bodenfliesen so seltsam.
Die Beziehung zwischen M. und mir war in den ersten Jahren weitgehend tragödienfrei verlaufen. Das Ungereimte zwischen uns, die wir, dem Naturell nach, sehr unterschiedlich waren, hatten wir teils mit Neugier, teils mit blinder Sorglosigkeit wahrgenommen. Mittlerweile traten die Gegensätze immer deutlicher zutage, die Beziehung bekam eine merkwürdige Drehung und war nicht mehr das, was sie hätte sein sollen.
In der kleinen Wohnung konnten wir uns schwer aus dem Weg gehen. Ich schrieb damals vor allem in der Nacht, was in der Küche am Fensterbrett geschah. Ich war überzeugt, das Feuer meines Talents lodert am sichtbarsten, wenn es von tiefer Dunkelheit umgeben ist. M. stand meistens früh auf, um zur Universität oder zur Arbeit zu fahren. Sie hatte die morgendliche Angewohnheit, in Hektik zu geraten. Ganz zuletzt suchte sie ihren Schlüssel, und spätestens jetzt verlor sie die Nerven. Wenn sie die Wohnung verlassen hatte, legte ich mich wieder ins Bett. Dort blieb ich bis zum Mittag auch dann, wenn ich längst ausgeschlafen war. Kann sein, ich durchlief ein depressives Intermezzo.
In der Wohnung unter mir hatte es einen Mieterwechsel gegeben. Die neu ins Haus Gekommenen gingen keiner Arbeit nach und mochten ihre Musik nur, wenn sie laut war. Am Nachmittag saß ich mit Ohrstöpseln am Schreibtisch und überarbeitete weiter und weiter die beiden mit Anfang zwanzig geschriebenen Romane. Ich brachte es nicht übers Herz, einen dritten Roman zu beginnen, solange das Schicksal der schon geschriebenen ungeklärt war. Doch die geschriebenen gab ich nicht aus der Hand, ständig entdeckte ich neue Mängel, mir war klar, ich stand noch am Anfang. Das Brüten über Form und Sprache, das stundenlange Sitzen über einzelnen Sätzen — ich probierte es, bis ich blutig war. Dabei beschäftigte mich der Inhalt der Romane nur am Rand, was einfältig klingen mag. Aber immerhin war ich klug genug, einzusehen, wie wenig ich von Form und Sprache wusste.
Vom Leben wusste ich nochmals weniger. Ich war das, wofür der walisische Dichter Dylan Thomas das passende Bild gefunden hat: "Ein Junge, der ein Wörterbuch verschluckt hat".
Schon Jahre zuvor hatte ich mich verpflichtet, immer, wenn ich im Wörterbuch etwas nachgeschlagen hatte, anschließend die ganze Doppelseite durchzusehen, ob ich ein brauchbares Wort fand, das ich nicht in aktiver Verwendung hatte. Entdeckte ich eines, schrieb ich es in ein Heft.
aufmöbeln
hinsichtlich
Hochstimmung
beiwohnen
zureiten
Drahtfenster
In mancher Hinsicht war mein Schreiben seit Jahren gar kein Schreiben, sondern ein Herumfeilen. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie viele Seiten Papier der Firma Strohbach & Pötscher über meinen Schreibtisch flatterten, wie viel unwiederbringliche Zeit mir zwischen den Händen zerrann. Manchmal schlief ich nächtens am Fensterbrett der Küche ein. Und morgens schaute ich mich nervös nach den Jahren um, die ich vertan hatte. Im Umdrehen kam es mir vor, als habe es in meinem Rücken Steine geregnet.
Mir war äußerst unbehaglich zumute. Ich dachte: Hoffentlich wird sich das alles nicht eines Tages grausam rächen.
Meine Runden waren ebenfalls so eine Sache. Ich absolvierte sie regelmäßig, seit ungefähr drei Jahren, und das machte die Lage um nichts besser. Das erfolglose Schreiben war finanziert, ich hielt mich gut über Wasser, da ich mir durch das Studium von im Altpapier gefundenen Auktionskatalogen auf unterschiedlichen Sammelgebieten einen soliden Grundstock an Wissen angeeignet hatte. Dies jedoch um den Preis, dass meine Geschäfte immer mehr Zeit in Anspruch nahmen, was das Schreiben weiter zurückdrängte. Im Ergebnis war das Schreiben nicht finanziert, sondern verhindert.
Die langen Fußmärsche entbehrten endgültig jeglicher Romantik, sie wurden zu trüben, einsamen Wanderungen, mir hing das Ungewisse meiner Zukunft wie ein Mühlstein um den Hals. Gehen, gehen, gehen. Und von Zeit zu Zeit, wenn ich einen klaren Gedanken hatte, schüttelte ich den Kopf, und zwischen den Schulterblättern verspürte ich so eine merkwürdige Leere.
Die Jahrzehnte, die seither vergangen sind, haben das Trostlose nicht verklärt. Durch die staubigen, heißen Straßen, über feuchtes, schmieriges Laub, durch den knirschenden Schnee, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Häuser wurden abgerissen, neue Häuser wurden bezogen. Der Wecker, der mehr als ein Jahr lang in einer unbewohnten Wohnung bei gekipptem Fenster immer zur gleichen Zeit eine Stunde lang gepiepst hatte, wurde abgestellt, oder die Batterie war endlich leer.
Fast immer brachte ich etwas nach Hause, und fast immer musste etwas aufgearbeitet werden. Dann lagen beschädigte Bücher auf dem Schreibtisch, die in besserem Zustand wertvoll gewesen wären. Weggeworfen wegen Brüchigkeit und Rostfraß. Was tun damit? Ich besaß Schustergarn, Leim und eine größere Sammlung Papiersorten. Aber die Instandsetzung gelang meistens nicht auf Anhieb so, wie ichs mir gewünscht hätte. Stundenlanges Kämpfen mit der sogenannten Tücke des Objekts. Wenn das Resultat sich endlich sehen lassen durfte, war wieder ein halber Tag vertan.
Viel zu oft beschäftigte mich der Schrank links neben dem Bett, der mittlerweile einen zweiten Namen bekommen hatte: Depot. In zwei Stapeln nebeneinander standen dort zehn Bananenkartons, in denen sich Bücher anhäuften. Vielleicht ist es richtiger, wenn ich sage: die mittelmäßigen Bücher. Denn das Mittelmäßige besitzt eine Tendenz, sich festzusetzen — eine weitere Tücke. Das Gute ist schnell verkauft, das Schlechte schnell weggeworfen. Zwischen gut und schlecht gibt es eine schwer fassliche Grauzone, die mir schon mein ganzes Leben zu schaffen macht.
Oft, wenn ich am Schreibtisch saß, schweifte mein Blick wie magisch angezogen zum Depot. Ich ging hin, hob die Kartons heraus und sortierte das blanke Nichts. Im Grunde war das sinnloser, als gegen eine Wand zu starren. Mag sein, ich warf fünf oder sechs Bücher zurück zum Altpapier. Doch anschließend überkam mich die ganze Nutzlosigkeit dessen, was ich tat, und dann philosophierte ich noch eine halbe Stunde über dem Gegenstand, was für ein Trottel ich war und dass ich in den Arsch getreten gehörte, weil mir so viel Zeit nutzlos verloren ging.
Ich ließ mich damals gerne ablenken. Ich weiß nicht, warum. Heute ist es nicht mehr so. Ständig musste ich Bücher sortieren, und das Sortieren nahm ebenfalls immer mehr Zeit in Anspruch, als ich zunächst veranschlagt hatte.
Vor mir türmten sich die Bücherstapel und dabei das Gefühl: So verbaue ich mir meine Zukunft.
Wenn M. nach Hause kam, war ich gedämpfter Stimmung. Ich wagte es nicht zu bekennen, dass vom Geschäft ein böser Zauber über mich gekommen war. M. liebte es, wenn wir am Wochenende auf Flohmärkte gingen oder uns selber auf den Flohmarkt stellten. Für sie, die bereits während des Studiums als Journalistin Tritt gefasst hatte, war es ein Abenteuer, was ich zunehmend als Sackgasse empfand. Oft gab es Reibereien. Wie gesagt, es kann sein, ich durchlief ein depressives Intermezzo. Was aber mit Sicherheit zu sagen ist: Im beinahe zwanghaften Sortieren der Bücher kamen die Ziellosigkeit und das Resignative in meinem Leben zum Ausdruck. Alles entglitt mir. Inmitten der vielen Bücher und der sinnlosen Haufen aus Papier versank ich wie in Treibsand.
Die Realität meines Alltags stand in krassem Gegensatz zu dem, was mir ursprünglich als Wunsch und Hoffnung vorgeschwebt war. Jahrelang hatte ich mir eingeredet, nach Wien gehen, das Leben mit beiden Händen ausschöpfen und nebenher studieren, werde das höchste der Gefühle sein. Ich würde ein sperrangelweit offenes Leben haben, unbegrenzte Möglichkeiten, und wenn nicht unbegrenzt, so unerschöpflich. In der Hauptsache würde die Verwandlung, die mir bevorstand, nur abhängig sein von meinen Wünschen, meiner Vorstellungskraft und meinem Mut.
So schön hatte ichs mir gedacht. Und wenn ich auf der Straße Menschen sah, die taten, was ich tat, abgerissene Pensionisten und übergewichtige Frauen, die sich in Abfallbehälter beugten, dann erfasste mich Grauen. Ist es das, wozu ich bestimmt bin? Ist es das, was ich sein werde? Bin ich es schon? Hilfe! Das will ich auf keinen Fall! Ich hatte meine Schreckgespenster ja regelmäßig vor Augen, ich war nicht allein unterwegs in den Straßen von Wien und sah in den andern ein Bild meines künftigen oder momentanen Lebens. Es schüttelte mich. Was machst du da!? Warum tust du das?! Bist du verrückt?! Das ist der Weg des Wahnsinns! Du verrennst dich! Du vertust deine Zeit! Und die Zeit kommt nie wieder! Am Ende stehst du da! Schau dir die andern gut an!
Ich hatte ein starkes Gefühl davon, wie sehr man sich in derlei verlieren kann. Rückblickend glaube ich, dass meine Niedergeschlagenheit auch aus dem Wissen kam, dass ich feststeckte, mir dessen bewusst war und nichts dagegen unternahm.
In der Beziehung waren M. und ich an einen toten Punkt gelangt. Zwar redeten wir uns ein, dass eine große Liebe jede Anstrengung wert sei, doch insgeheim wusste jedes für sich, glaube ich, dass diese große Liebe auf ihr Ende zusteuerte. Es gibt Beziehungen, die sind gut für eine bestimmte Zeit. Dann ist diese Zeit abgelaufen. Das wollten wir uns lange nicht zugeben.
Schriftstellerisch kam ich ebenfalls nicht vom Fleck. Ich ging weitschweifigen Tätigkeiten nach, nur eins tat ich nicht, schreiben. Zwischendurch fragte ich mich: Wozu das alles? Naheliegende Antwort: Zu nichts.
Meine Runden, das sagte mir schon das Wort, boten kein Fortkommen, das rundete das Unglück ab und machte es voll. Ich schleppte meine Dummheit im Kreis, denn über das bloße Aufbessern des Haushaltsgeldes kam ich wegen Unfähigkeit nicht hinaus. Abgesehen von den pekuniären Vorteilen blieb dieser Teil meines Alltags unfruchtbar. Die Bücher, die ich nach Hause brachte, mein Gott, die hätte ich mir genauso gut auf dem Flohmarkt besorgen können.
Auf mein Schreiben hatten die Runden keinen sicht- oder spürbaren Einfluss. Zwar brachte ich gelegentlich größere Konvolute privater Briefe nach Hause, auch Tagebücher. Doch sie enthielten ihren Wert in einer für mich nicht konvertierbaren Währung. Beim Lesen kam mir die Sprache anspruchslos vor und der Inhalt alltäglich mit einer Tendenz ins Trostlose. Warum war ich nicht in der Lage, die Informationen, die ich erhielt, zu gewichten? Ich glaube, es lag in erster Linie daran, dass mir mein Faible für Sprache im Weg stand. Es verstellte den Blick und hinderte mich, das Wesentliche zu sehen. Mir war unbegreiflich, warum Menschen sich schlichte Alltagsdinge in schlichten Sätzen mitteilten, Dinge, die ich allesamt kannte. Die jeder kannte!
Einmal fand ich zehn kleine Tagebücher einer Augenarztgattin. Der Augenarzt ein Säufer mit ständigen Affären. Die Gattin machte ihm die Vorzimmerhilfe, was ihr mehr Kritik als Dank eintrug. Ohne es sich offen zuzugeben, war sie verliebt in einen Burgschauspieler, mit dem sie vor Premieren telefonierte. Und immer hatte sie entzündete Nagelbetten.