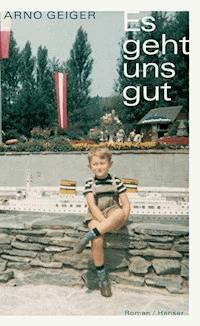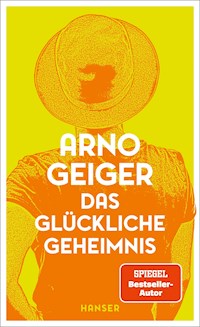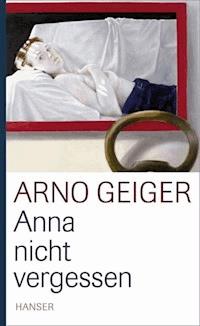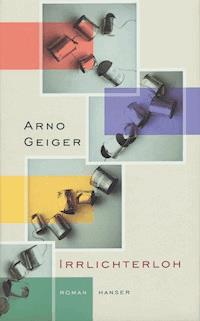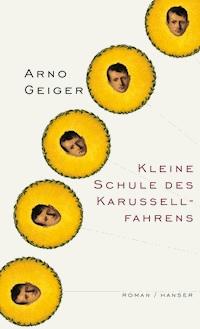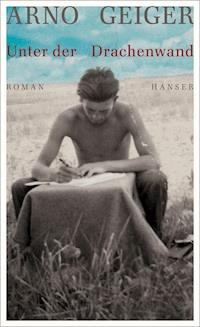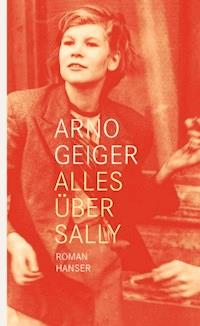Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Hanser, CarlHörbuch-Herausgeber: Hörbuch Hamburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie fühlt es sich an, heute jung zu sein? Arno Geiger erzählt von Julian, einem Studenten der Veterinärmedizin, der seine erste Trennung erlebt und erstaunt ist, wie viel Unordnung so eine Trennung schafft. Um die Unordnung ein wenig zu lindern, übernimmt er bei Professor Beham die Pflege eines Zwergflusspferds, das bald den Rhythmus des Sommers bestimmt: es isst, gähnt, taucht und stinkt. Julian verliebt sich in Aiko, die Tochter des Professors, verfolgt beunruhigt, wie täglich Schockwellen von Katastrophen um den Erdball fluten und durchlebt eine Zeit des Umbruchs und Neuanfangs. Ein Roman über die Suche nach einem Platz in der Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Arno Geiger
Selbstporträt mit Flusspferd
Roman
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24843-4
© Carl Hanser Verlag München 2015
Cover: © bpk/Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz/Dietmar Katz
Hippopotame femelle, Kupferstich von Louis Alexandre Boutelou, in: François LeVaillant, Second Voyage Dans L'Intérieur De L'Afrique, Par Le Cap De Bonne-Espérance, Dans Les Années 1783, 84 Et 85, A Paris, Chez Hendrik J. Jansen Et Compe, Imprimeurs-Libraires, Place Du Muséum, 3, 1794/1795, Tome Second, Planche VII
Alle Rechte vorbehalten
Satz im Verlag
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Eins
Vor einigen Tagen brachte Judith einen Uhu in die Notfallambulanz. Es war unser erstes Zusammentreffen seit fast zehn Jahren, und ich erkannte sie nicht, obwohl ich sie hätte erkennen müssen. Es lag nur zum Teil an den kurzen Haaren, ich war abgelenkt durch den Uhu, weil ich vom ersten Blick an dachte, dass ich ihm nicht helfen kann. Und plötzlich sagte die Frau:
»Wir kennen uns. Ich bin’s!«
Da schaute ich sie an und erkannte sie. Meine Hände zitterten, während ich den Uhu untersuchte, um sicherzugehen, dass mich mein erster Eindruck nicht getäuscht hatte. Der fällt in eine finstere Grube, den fängt niemand auf. Und zu Judith sagte ich:
»Du, Judith, da ist nichts zu machen.«
»Ich habe es fast befürchtet«, sagte sie. Und als stünde ein stiller Vorwurf zwischen uns, fügte sie mit einem kleinen Kopfschütteln hinzu: »Er gehört nicht mir, ich habe ihn vor dem Haus gefunden.«
Sie senkte den Blick, eine unbehagliche Situation. Die orangegelben Augen des Uhus mit den schwarzen Pupillen waren riesig und glotzten mit einem schrecklichen Ausdruck ins Leere.
Während ich das Tier zur Tötung vorbereitete, wussten wir beide nicht, was reden. Früher hatte ich Judith nie verlegen erlebt, sie war immer strahlend gewesen, prall, in Bewegung, der Prototyp der unkomplizierten Frau, die in Kontaktanzeigen gesuchte Frau zum Pferdestehlen. Sie schaute abwechselnd zu Boden oder zur Seite. Ich dachte, es stimmt nicht, dass wir uns kennen, wir haben uns gekannt, jetzt nicht mehr, jetzt sind wir einander fremd bis zum Rätsel.
Dieses Fremdsein war überraschend schnell gekommen, parallel zum Verschwinden der Offenheit. Am Tag nach der Trennung hatte ich so gut wie nichts mehr von der gewohnten Vertrautheit gespürt, und es blieb so bei jedem Wiedersehen. Wir wussten nicht einmal mehr, wie wir einander begrüßen sollten. Kuss auf den Mund? Das wäre mir normal vorgekommen, weil vertraut. Oder Kuss links, rechts? Und wer entscheidet das? Was, wenn ich versuche, sie auf den Mund zu küssen, und sie hält mir die Wange hin? Sollen wir uns die Hand geben? Wir werden uns doch wohl nicht die Hand geben! Dann besser gar nichts. – Also sagten wir: Hallo, wie geht’s? Und du? Was soll ich sagen? Du glaubst mir eh nicht.
Ich spritzte dem Uhu das Sedativum in die Brustmuskulatur, anschließend eine erhöhte Dosis des Narkotikums in die Flügelvene, dazu breitete ich den rechten Flügel aus, die Vene war an der Innenseite leicht zu finden. Judith blieb bei dem Tier, bis es gestorben war. Vor dem Weggehen kam sie aus dem anderen Raum noch einmal zu mir her und bedankte sich. Es tat mir leid, dass ich dem Uhu nicht hatte helfen können. Ich hätte gerne alles in Ordnung gebracht. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich mich entschuldigen sollte, ich hatte dieses überwältigende Bedürfnis, um Verzeihung zu bitten. Aber schließlich, es war nicht meine Schuld.
Judith sagte:
»Ich hoffe, du hast gefunden, wonach du gesucht hast.«
Ich hob fragend die Achseln und nickte halbherzig:
»Im Großen und Ganzen …«
Sie sagte:
»Es war richtig, dass wir uns getrennt haben.«
»Das sehe ich auch so«, erwiderte ich.
»Ja, es war richtig.«
»Vom heutigen Standpunkt aus, soweit’s mich betrifft, ja.«
»Ich habe gehört, du warst in Frankreich.«
»In Paris, zwei Jahre.«
»Ich …«
Judith wollte etwas sagen, ich hatte den Eindruck, etwas Persönliches. Vielleicht brach sie deshalb sofort ab, als eine Schwester mich am Ärmel zupfte und zum Röntgentisch deutete, auf dem ein großer Hund lag.
»Ja, dann …«, sagte Judith: »Nochmals danke.«
Sie ging zur Tür, und bevor sie die Tür hinter sich zuzog, winkte sie in meine Richtung. Das war’s. Wir sehen uns nicht wieder, ich werde nicht wissen, wie ihre Kinder heißen, so sie Kinder hat, und was auf ihrem Grabstein steht und wo er steht, so sie vor mir stirbt. Und dass es ihr Gesicht einmal gegeben hat und dass es rund und glücklich war in Liebe zu mir: Macht nichts.
Die Trennung von Judith hatte ich herbeigesehnt in dem diffusen Gefühl, was wir da hatten, sei nicht das Wahre. Seltsamer Ausdruck: Das Wahre. Es kann aber sein, dass die erste Liebe etwas Wahres verliert, wenn sie nicht mehr nur die erste, sondern auch die einzige sein will, erste, einzige und letzte. Was, wenn ich bei Judith hängenbleibe? – Diese Vorstellung versetzte mich in Unruhe, damals. Ich hatte Angst … wovor eigentlich? Dass ich etwas versäume … in erster Linie. Kann das alles gewesen sein? Weil: Wenn ich an die Zukunft mit Judith dachte, kam mir alles absolut vorhersehbar vor, unser Leben eine glückliche Einöde, flach und weit. Und obwohl am Ende Judith die Trennung vollzog, war ich es gewesen, der sie betrieben hatte, bockig, trotzig und wild entschlossen, mich in Gefahr zu begeben.
Zu diesem Zeitpunkt bin ich zweiundzwanzig. Der Umstand, erwachsen zu sein, gefällt mir außerordentlich. Aber ich weiß in Wahrheit überhaupt nicht, was ich will, einmal in diese Richtung, dann in die andere, einmal alles, einmal nichts. Und immer fühlt es sich absolut richtig an. Und so vieles ist neu. Und so vieles ist … massiv. Manchmal erwischt mich das Neue auf dem falschen Fuß. Und manchmal haut mich die Massivität von etwas um. Meine Unerfahrenheit und meine Neigung, mir Hoffnungen zu machen, bringen zwei unterschiedliche Grün zusammen, eine Mischung, eine ziemlich produktive Mischung: der Treibstoff der Jugend.
So ein Haus im Bregenzerwald wäre natürlich toll. Wobei, eigentlich möchte ich weg, den Segelschein machen und etwas von der Welt sehen, zwischendurch arbeiten, am Strand auf dem Bügelbrett streunende Hunde kastrieren. Manchmal eine Liebschaft mit einer Frau, die Freude am Leben hat. Kinder? Eigentlich möchte ich keine Kinder. Wobei, eine Familie mit sechs Kindern, das wäre natürlich auch cool.
Als Judith sagte, es sei vorbei, fuhr mir der Schreck in die Glieder. Ich hatte erwartet, die Trennung werde mich in einen augenblicklichen Freiheitsrausch versetzen. Ich hatte erwartet, dass es sich anfühlt, als werde ich freigesprochen. Statt dessen flüsterte es nächtelang mit beunruhigendem Nachhall: Ich liebe dich nicht mehr, niemand liebt dich, niemand wird dich je wieder lieben. Unser Leben ist dir zu vorhersehbar? Du willst in die große Welt hinaus? Du willst es mit Himmel und Hölle aufnehmen? Nur zu! Ich hätte dich für klüger gehalten.
Ich war ziemlich fertig deshalb. Mir wurde unheimlich bei dem Gedanken, dass alles, was jetzt noch kommt, abfällt gegen das, was ich gerade weggeworfen hatte. Und als habe es mir gereicht, die Trennung fünf Minuten auszuprobieren, fragte ich Judith, was sie davon halte, dass wir nach einem kurzen, wilden Intermezzo von einigen Monaten oder einem Jahr … also später … dass wir dann einen neuen Anlauf nehmen, gemeinsam zu Ende studieren und eine Familie gründen. Sie hörte mir kaum zu. Wie gesagt, immer strahlend, prall, in Bewegung, der Prototyp der unkomplizierten Frau.
»Es gibt wirklich nichts, was da noch zu bereden wäre«, sagte sie erstaunt. »Vorbei ist vorbei und Entscheidung ist Entscheidung. Jetzt, wo es aus ist, ziehe ich es vor, nicht mehr darüber nachzudenken.«
Obwohl ich ihr mit meinen Stimmungsschwankungen wochenlang das Leben versalzen hatte, war ich von Judiths Antwort wie vor den Kopf gestoßen. Es empörte mich, dass Judith es schaffte, ihre Gefühle zu mir einfach in die Ecke zu stellen. Es empörte mich so sehr, dass ich ihr Gefühllosigkeit unterstellte.
»Wir haben uns entschieden. Warum jammern?«, fragte sie.
Da drehte ich mich um und ging. Tage später sagte sie, sie habe mir, als ich wegging, angesehen, dass ich mir sicher gewesen sei, sie werde mich zurückhalten. Sie habe es mir von hinten angesehen, dass ich dachte, gleich läuft sie hinter mir her und hält mich zurück.
Das war zum Ende des Sommersemesters gewesen, nachdem ich gerade eine große Prüfung bestanden hatte. Wir hatten stillschweigend vereinbart, uns nicht vor einer Prüfung zu trennen. Während des Studienjahres stand so gut wie immer eine Prüfung an, also lief es auf den Sommer hinaus, auf die Ferien. Ferien bieten die Chance, sich vom gewohnten Alltag zu distanzieren. Ferien sind ein überzeugendes Imitat der Erlösung, hell, offen, glückversprechend, leicht. Mit halboffenen Augen in der Sonne liegen und die Blätter hören, die Tage sind lang wie Kaugummi, man liegt auf einer Decke, und es tut sich nicht viel.
Jetzt beugten sich die finsteren Engel der Trennung über mich, und mit plötzlicher Wucht erkannte ich die Spannweite von dem allen.
In den Tagen unmittelbar nach der Trennung schlief ich bei Tibor, einem Studienkollegen. Trotz der Ratschläge, die er mir gab, lieferte ich einige Kurzschlussaktionen. Auf Judith muss ich absolut unberechenbar gewirkt haben, mich selber störten die Widersprüche in meinem Verhalten nicht. Ich fing Judith auf der Straße ab, hielt sie am Arm fest und redete von einer gemeinsamen Zukunft. Statt in die Zukunft blickte Judith auf meine Hand. Daraufhin machte ich ihrer Schwester einen etwas zwielichtigen Besuch, das hätte ich besser unterlassen. Ich schrieb Judith seitenlange Briefe, die eine wechselnde Mischung aus Liebesschwüren und Vorwürfen enthielten. Meine Handschrift aus dieser Zeit bildet das emotionale Durcheinander ab: schwankend, abgehackt, patzig, ständig überm Rand.
Judiths Schwester machte zu Hause bekannt, dass ich in den vergangenen zwei Jahren nicht im Studentenheim gewohnt hatte, sondern bei Judith. Judiths Vater hatte die Miete für die Wohnung bezahlt, jetzt forderte er von mir einen Anteil. Er sagte, er komme sich vor wie eine Sau mit hundert Zitzen. Und dass ich zwei Jahre für den Haushalt seiner Tochter aufgekommen war? Interessierte niemanden. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Trennung so viel aus dem Gleichgewicht bringt.
An einem sonnigen Nachmittag ging ich nochmals zu Judiths Garçonnière, um einige Sachen zu holen. Sommerlich alles, ein heißer Wind wehte durch die Straßen, der Himmel wirkte etwas eingetrübt von den Abgasen der Stadt. Es gab hohe Häuser neben niedrigen, es gab Straßen, in denen drängten sich viele Menschen, und Straßen, da ging niemand, nein, nicht niemand, da ging ein junger Mann.
Vorbei an dem leerstehenden Lokal, in dem bis vor einem halben Jahr ein Fleischer-Ehepaar gewirkt hatte. Vorbei an der Polizeistation, vorbei am Blumenladen, der unlängst noch ein Schuhladen gewesen war, rechts in eine Verbindungsstraße und zu dem Wohnhaus, in dem ich mit Judith gelebt hatte. Vor kurzem war das noch der Weg nach Hause gewesen, jetzt der Weg dorthin, wo früher zu Hause gewesen war und wo mich die Nachbarn noch grüßten wie einen der Ihren. Ich klingelte. Der automatische Türöffner summte. Ich drückte das Haustor auf und erklomm die Treppe mit schweren Schritten. Oben trat ich durch die offen stehende Tür. In der Diele, gleich hinter der Tür, waren Dinge, die mir gehörten, in einem Winkel zusammengestellt, zusammengedrängt wie Rehe im Winter. Der Anblick verschaffte mir ein tief aus dem Bauch kommendes Unbehagen.
»Aha …«, sagte ich.
»So ersparst du dir das Zusammensuchen.«
Ziemlich weit unten in einem der Stapel sah ich ein Buch, das ich Judith zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt hatte. Mit einem leichten Stechen der Wut warf ich die beiden mitgebrachten Tragtaschen aus Plastikgeflecht auf den Haufen.
»Die Erzählungen von Tschechow … hör mal!«
»Die liegen eher auf deiner Wellenlänge«, sagte sie rasch. »Ich habe noch einmal hineingelesen, ich schwör’s, es ist alles so trostlos, wie die Bauern da in ihren Hütten sitzen.«
Sie ging mir voraus in die Küche. Ich war froh, als ich dort auf meinem Stuhl saß. Das gab mir ein Stück Selbstvertrauen zurück. An der Wand links die kleine, elfenbeinfarben lackierte Küchenkredenz mit Einsätzen aus geripptem Glas: die gehörte mir. Judith hatte gesagt, ich dürfe sie stehenlassen, kein Problem, hol sie, wenn du sie brauchst.
»Ja, also … es sitzt sich gut hier«, sagte ich. »Aber d-das soll keine Ankündigung sein, dass ich nicht mehr aufstehen werde.«
»Das beruhigt mich … Ja … Ich denke, du brauchst erst einmal einen Kaffee.«
So saßen wir, Kaffee trinkend, und fragten uns gegenseitig, wie es so ging und was wir so trieben.
»Ich schlage mich durch«, sagte ich. »Und du?«
»Ich auch.«
»Was immer das heißen mag,« sagte ich mürrisch.
»Ja, also … ich sauf nicht, ich heul nicht, ich flirte nicht. Ich bemitleide mich nicht einmal.«
»Ich mich schon.«
Ein junger Mann mit Schmerzen sein, ist eine Ganztagsbeschäftigung.
»Fühlst du dich wohl in der neuen Wohnung?«, fragte Judith. »Ist es nicht zu laut?«
»Es ist hauptsächlich Fließverkehr. Und an die U-Bahn werde ich mich gewöhnen. Aber der Feinstaub macht mir natürlich Sorgen.«
Um meiner Beklemmung Herr zu werden, stand ich auf. Judiths Wohnung befand sich in einem Altbau. Die Fensternischen waren zweieinhalb Meter hoch. Die bodenlange Kunststoffgardine vor dem Küchenfenster glänzte im Sonnenlicht. Ich schob sie ein Stück beiseite und spähte hinaus. Im Hinterhof des Nachbarhauses, wo gerade eine Cateringfirma eine frühere Tischlerwerkstatt bezog, flämmte ein Mann die Pflanzen weg, die aus den Ritzen zwischen den Bodenplatten wuchsen. Ich fand das kleinlich.
Nachher gingen wir in das große Zimmer, in dem auch das Bett stand. Alles picobello aufgeräumt, mein Schreibtisch war demontiert, dort breitete jetzt ein Gummibaum seine Äste aus. Mittendrin die mir wunderschön vorkommende Judith, ich meine, sie hatte eine wunderschöne Haltung, einen wunderschönen Ausdruck. Man sah ihr an, dass sie nicht nur gut aussah mit ihrem breiten Mund und den blauen Augen, man sah auch, dass sie in Mindestzeit studieren würde und dass sie seit der Volksschule auf der Überholspur war, ganz ohne Verbissenheit und Anstrengung. Selbst im Bett: ganz ohne Verbissenheit und Anstrengung, ganz zu Hause in ihrem Körper, pragmatisch, das bin ICH und fertig, das ist doch sonnenklar. Wir hatten von Anfang an ohne jeden Schnickschnack miteinander geschlafen, ohne Tränen, ohne intensivste Leidenschaft. Wir hatten uns besser verstanden, als ich’s wahrhaben wollte, denn auch Judiths Schnörkellosigkeit im Bett war mir am Ende unheimlich gewesen, diese komplette Abwesenheit von Dämonen.
Ich fragte Judith, ob sie noch einmal mit mir schlafen wolle. Sie lächelte sanft, ein ruhiger Gesichtsausdruck, dem das Nein anzusehen war. Ich tat so, als hätte ich’s gewusst, dass sie mit diesem Lächeln reagieren werde. In Wahrheit hatte ich gehofft, sie werde sich aus alter Anhänglichkeit darauf einlassen. Schade. Weil: Wenn schon Trennung, dann irgendwie filmreif oder großzügig, mit dem Anspruch, etwas zum Erzählen zu haben. Damals wären mir solche Gesten der Großartigkeit wichtig gewesen … dass Judith sagt: Jetzt schlafe ich ein letztes Mal mit dir, und anschließend nehme ich aus unserem gemeinsamen Besitz alles, was mich freut, und du bekommst den Rest. Aber an den letzten Sex mit mir wirst du noch auf dem Sterbebett denken.
So hätte es sein können. Statt dessen stand jeder mit verschränkten Armen in einer Zimmerecke und versuchte, die Gedanken des anderen zu erraten. Judith war mir in diesem Spiel bestimmt ein gutes Stück voraus.
Ich bat um die Stehlampe, die wir aus dem Haushaltsgeld gekauft hatten, ich sagte:
»Sie bedeutet mir mehr als dir, das weißt du.«
Sie schüttelte den Kopf, ganz leicht, noch immer mit verschränkten Armen.
Als wir die DVDs aufteilten, die wir gemeinsam gesammelt hatten – abwechselnd durfte jeder eine DVD nehmen, und das Los, wer beginnt, fiel auf Judith –, da nahm sie als erstes meinen Lieblingsfilm.
»Du kannst doch nicht einfach meinen Lieblingsfilm nehmen!«, beschwerte ich mich.
Sie zuckte die Schultern, ohne mir ihre Wahl zu erläutern.
»Doch, kann ich«, sagte sie, nachdem ich meinen Vorwurf wiederholt hatte.
»Und warum?«
»Was fragst du immer warum?«
»Weil es eine verdammte Sauerei ist, dass du als erstes meinen Lieblingsfilm nimmst!«
»Warum nicht?«
»Du hast einen eigenen Lieblingsfilm.«
»Nimm ihn!«
»Bin ich im Kindergarten?«
Sie sagte:
»Vielleicht ist es tatsächlich eine Probe, ob wir jetzt erwachsen sind.«
»Dann schlaf noch einmal mit mir!«
Das brachte sie für ein paar Sekunden aus dem Konzept. Es entstand eine Nachdenkpause von drei oder vier Sekunden, schließlich hatte Judith sich zu ihren Vorsätzen zurückgekämpft.
»Nein-nein. Und außerdem … was soll denn das!«
»Amen.«
Judith schüttelte den Kopf, es fiel ihr nicht schwer, mir in die Augen zu schauen.
Da kam mir die plötzliche Erinnerung, warum ich Judith am Anfang auf den Mond gefolgt wäre. Ich so jung und unfertig, und sie schon so selbstsicher. Den ganzen Tag war ich an ihrem Rockzipfel gehangen, von der Früh bis in die Nacht, so sehr hatte ich sie bewundert. Und ohne dass ich’s mir bei der Trennung zugegeben hätte, wusste ich insgeheim, dass Judith sich auch während unserer gemeinsamen Jahre rascher entwickelt hatte als ich, sie machte mit schwindelerregender Schnelligkeit Boden gut. Nur hatte ich die Geradlinigkeit ihres Denkens und den entspannten Ernst ihrer Lebensführung zunehmend als vorhersehbar empfunden, stur, spießig, altbacken, nüchtern, ein Charakter: wie mit dem Lineal gezogen, so kam es mir damals vor.
Wenn Judith über die Zukunft redete, redete sie nicht über Träume, sondern über Pläne. Sie war jemand, der nicht träumte, sondern plante. Bestimmt hatte sie schon einen neuen Plan. Die Trennung zog sie mit derselben Zielstrebigkeit durch, mit der sie sich für mich entschieden hatte.
Das war auf einer Party gewesen zum Ende der Schulzeit. Ich betrunken, müde. Ich hatte mich in einen Schrank gelegt und war auf einem Kleiderhaufen eingeschlafen. Judith, die beobachtet hatte, dass ich mich in den Schrank verdrückt hatte, kam ebenfalls hereingekrochen, sie fragte, ob noch Platz sei. Wir redeten ein bisschen und schmusten miteinander. Dann waren wir ein Paar.
In dem Kleiderschrank glaubte ich, dass wir anders seien als alle andern. Aber je länger die Beziehung dauerte, desto stärker hatte ich den Verdacht, dass wir womöglich nur geringfügig anders waren als alle andern. Kann das sein? Und wenn ja: Wie kann einem etwas so Schreckliches passieren?
Ich erinnerte Judith an den Kleiderschrank. Die Geister der Glücksmomente schwebten im Raum. Judith lehnte sich für einen Moment an mich, Schulter an Schulter, eine kleine Beschwichtigung. Dann sagte sie mit beunruhigender Sanftheit:
»Aus dem Schrank sind wir jetzt heraus.«
»Du vielleicht. Ich? Nein-nein. Ich befürchte, es dauert noch lange, bis ich da rauskomme.«
»Na … wollen abwarten, was du in sechs Monaten sagst. Du hast die Trennung herbeigebettelt. Ich nehme dir nur die Drecksarbeit ab.«
Ich erschrak über diese Worte. Dann sagte ich kleinlaut:
»Es tut mir leid.«
Und meine Stimme in dem Raum klang anders als zu der Zeit, als ich hier zu Hause gewesen war.
Nach einem Moment des Schweigens setzten wir die Aufteilung der DVDs fort. Ich nahm Fight Club, kein überragender Film, aber unser Film, der Film meiner Generation. Ich hatte eine Zeitlang versucht so zu reden wie Tyler Durden, und die Mädchen hatten versucht so zu tanzen, dass es nach Fight Club aussah. Judith schnappte sich daraufhin Apocalypse Now, das ärgerte mich schon wieder, wo sie doch Kriegsfilme nicht mochte. Bleib cool, sagte ich mir, du musst dich konzentrieren, du musst dich vernünftig verhalten. Was ist los mit dir? Bleib cool, Julian. – Ich kontrollierte bewusst meinen Atem, ich versuchte, durch vorgetäuschtes Schwanken zwischen zwei DVDs Judiths Aufmerksamkeit auf Filme zu lenken, an denen ich kein besonderes Interesse hatte. Aber sie ließ sich nicht in die Irre führen und schnappte mir Der Smaragdwald weg. Am Ende hatte ich trotz der simplen Spielregeln den Eindruck, schlecht abgeschnitten zu haben. Sah ich nur den Stapel zwischen Judiths gekreuzten Beinen? Zwischen ihren nackten, muskulösen, immer ein wenig zitternden Beinen? Ich war bestimmt im Nachteil, weil Judith die Aufteilung als Denksportaufgabe betrieb, während ich mit Widerwillen an die Sache heranging. Es verunsicherte mich, ständig feststellen zu müssen, dass mir die andern in jedem Spiel voraus waren.
Beim Packen war Judith keine Hilfe. Besser so. Schließlich hatte ich alles beieinander und ging. Auf der Treppe fühlte ich mich erschöpft wie nach einer großen körperlichen Anstrengung. Ich schwitzte und zitterte. Ich weiß, vom Zurückschauen bekommt man Heimweh.
Zwei
Von Judiths Garçonnière war ich in eine Wohnung an der Linken Wienzeile gezogen. Ich hatte nicht gefragt, ob ich das dürfe, sondern Elli, meine ältere Schwester, vor vollendete Tatsachen gestellt. Der war das eh recht. Sie hatte dort seit drei Jahren ein Zimmer, wohnte aber seit einigen Monaten bei ihrem Freund. Das Haus an der Wienzeile sah außen herrschaftlich aus, die Wohnung selber war desolat. Es gab drei kleine Kohleöfen zum Luftverpesten, im Gang stapelten sich die Kohlensäcke, alles voller Kohlenstaub, auch im Sommer, weil niemand die Säcke in den Keller tragen wollte. Vermutlich hatte ich nie mehr so schmutzige Haare wie damals. Beim Haarewaschen war das Wasser braun.
In dieser Wohnung führte ich ein unvertrautes Leben. Es gab eine Mitbewohnerin, Schulfreundin von Elli, die hieß Nicki, war ein Jahr älter als ich und studierte Psychologie. Sie war faul, auch nicht besonders begabt, das behauptete zumindest Elli. Auf die Uni ging Nicki selten. Mit Ende des Studienjahres hatte sie die Stadt verlassen, einen Teil des Sommers verbrachte sie bei ihren Eltern in Vorarlberg.
Die Wohnung lag im dritten Stock, plus Hochparterre und Mezzanin, also ziemlich weit oben. Eines der Nachbarhäuser, hinten hinaus, war ein gutes Stück niedriger, weshalb man von der Küche und der Diele auf ein von roten und grauen Ziegeln geschupptes Dach sah.
Mein Zimmer ging vorne hinaus auf die Wienzeile und hatte Morgensonne bis weit in den Vormittag hinein. Elli behauptete, hier schlafe man quasi auf der Straße. Tatsächlich zog unten unablässig der Verkehr vorbei, das Haus zitterte, wenn ein Bus der Verkehrsbetriebe um die Ecke bog, ich konnte nur hoffen, dass das Mauerwerk hielt, bis ich wieder ausgezogen war. Zwischen den beiden zweispurigen, stellenweise dreispurigen Fahrbahnen floss der in ein Bett aus Steinen und Betonplatten gezwängte Wienfluss. Daneben ratterte die U-Bahn, die hier im Freien geführt wurde. In der Nacht glitten die U-Bahnzüge als hell erleuchtete silberne Schlangen vorbei und warfen nervöses Licht auf das armselige, immer schmutzige, fischlose Wasser. Ich konnte die Fahrgäste in den Waggons sitzen sehen, all die Träumer und Nasenbohrer. Dazu das Quietschen der Räder und Bremsen beim Einfahren in die Station, stadtauswärts, kurze harte Schläge. Wenn es mir erst gelungen war, alle Geräusche einem konkreten Vorgang zuzuordnen, würde ich besser schlafen, davon war ich überzeugt. Doch zunächst lag ich stundenlang wach, schlaflos in einem Ausmaß, dass ich glaubte, alles sei nur für mich, für mich und meine Schlaflosigkeit: die Stadt, die Straße, der Fluss, die U-Bahn, die Angst. – Und meine Kiefer mahlten die Erinnerung an Judith.
Die meisten Tage schlug ich mir schauderhaft um die Ohren. Ich vertat eine Unmenge Zeit damit, dass ich im Kopf endlose Tiraden knüpfte, meine bessere und meine schlechtere Seite lösten einander beim Reden ab, so dass beide ausreichend zum Verschnaufen kamen. Erklärungen für Judith, Beschimpfungen für ihren Vater. Nach besonders schlechten Tagen überkam mich die Nutzlosigkeit meines Tuns, und ich erwachte zu kurzfristiger Aktivität. Dann kaufte ich Holz für ein Bücherregal und stahl auf dem Dachboden des Hauses ein altes Türblatt, das ich zur Tischplatte umfunktionierte. Zwei Holzböcke als Tischbeine hatte ich ebenfalls gekauft. Ich flickte meinen Karatekittel, die rechte Ärmelnaht war gerissen. Das Training spritzte ich trotzdem, obwohl ich dem Trainingslokal durch den Wohnungswechsel deutlich näher gekommen war. Von Zeit zu Zeit blätterte ich die Zeitungen durch auf der Suche nach einer Möglichkeit, an Geld zu kommen. Auch auf der Veterinärmedizinischen Fakultät, wo ich ein Zeugnis abholte, studierte ich die Anschlagbretter. Doch keiner der in Aussicht gestellten Jobs ließ mich vergessen, dass das Geld, das ich verdienen würde, in die Taschen von Judiths Vater wandern sollte. Schuldig wollte ich das Geld aber auch nicht bleiben. Was tun? Ich verplemperte zwei weitere Tage. Es stimmt, ein junger Mann mit Schmerzen sein, nimmt einen ganz in Anspruch.
Einsam und verwundert lag ich da inmitten dieser betriebsamen Welt. Wie ein Getriebe, das den Dynamo am Laufen hält, surrte draußen der Straßenverkehr.
Wenn ich in der Nacht kurz aufstand und wieder ins Bett zurückfiel, merkte ich manchmal, dass die Laken getränkt waren von Schweiß. Ich war nicht krank. Das Schwitzen kam von der schieren Unruhe, die mein ängstlicher, leicht einzuschüchternder Geist meinem Körper zumutete. Am Morgen stand ich auf, bleich und taumelnd, ich fragte mich, wie lange ein Organismus das durchhält. Vermutlich nicht sehr lange.
Also sah ich mich wieder nach Gesellschaft um. Vielleicht würden Freunde helfen, meine Niedergeschlagenheit zu übertünchen. Weil Ferien waren und die meisten Studenten die Stadt verlassen hatten, blieben die Wiener. Ich schrieb eine SMS an Tibor, bei dem ich nach der Trennung drei Tage gewohnt hatte. Wir verabredeten uns in einem Lokal am Ende der Porzellangasse, wo die Porzellangasse das letzte Stück bis zum Donaukanal etwas unmotiviert der Berggasse überlässt, offenbar hat sie keine Lust, das Wasser zu sehen. Im unteren Bereich dieser wasserscheuen Straße hatten Schülerinnen einer Modeschule ein Lokal eingerichtet. Es verkehrten dort fast nur junge Leute. Tibor war dort über Jahre mehrmals jede Woche. Er kannte immer jemanden. Ihm gefiel das Lokal, obwohl er betonte, dass er kein Interesse mehr daran habe, mit Models zu schlafen. Er hatte da wohl einschlägige Erfahrungen.
»Die riechen immer so komisch«, sagte er.
Seine Freunde begrüßte er mit dem Händedruck der Freiheitskämpfer. Hintergrund der Geste? Beschäftigte ihn nicht. Hauptsache lässig. Mir war das zu kindisch. Also rammte er mir zur Begrüßung einen Finger zwischen die Rippen.
»Warum so verdrückt?«, fragte er. »Wer mit Leichen schläft, hat schlechte Träume.«
Dann lachte er schallend, und ich spürte, wie schon oft, seine Andersartigkeit, die mich irritierte und anzog wie ein Kratzen und Keuchen hinter der Wand. Tibor hatte etwas Robustes, er machte einen sehr bestimmten Eindruck. Außer ihm kannte ich niemanden, den die Unsicherheit nicht wenigstens ein bisschen quälte. Ich glaube, er besaß ein angeborenes Vertrauen in die Welt, das gefiel mir. Und mir gefiel auch, dass bei ihm immer etwas los war, bei jeder Gelegenheit vorneweg. Als auf der Veterinärmedizinischen Fakultät ein Zwergflusspferd gestrandet war und der ehemalige Rektor es mit nach Hause genommen hatte, bis sich ein geeigneter Platz dafür fand, bot sich Tibor als Tierpfleger an. Begründung: Zwergflusspferde sind anspruchslos. – So verdiente er sein eigenes Geld.
Von den vier Leuten, die er mitbrachte, kannte ich zwei, Claudi, seine gegenwärtige Freundin, und einen weiteren Studenten der Veterinärmedizin, Karl. Karl wohnte im Studentenheim. Über seiner Zimmertür hatte er ein Schild mit dem ersten Satz aus Dantes Inferno angebracht: Lasst alle Hoffnung fahren, all die, die ihr hier eintretet. Das machte ihn interessant, obwohl er ein total langweiliger Mensch war. Veterinärmedizin studierte er nur, weil er am liebsten ein Leben lang mit neugeborenen Kälbern zu tun haben wollte. Diesen Verdacht hatte ich.
Karls Freundin stellte sich als Sabine vor, dabei lachte sie nervös, mir kam vor, ihr Name verursachte ihr eine insgeheime Panik. Sie küsste mich rechts und links. Ich fand es völlig absurd, jemanden zu küssen, den man zum ersten Mal trifft, aber bitte.
»Julian«, gab ich zurück.
Mein Name schien ihre Ängste zu zerstreuen, denn sie verkündete begeistert:
»Julian kenne ich drei.«
Sabine trug ein kleines Fähnchen aus dünnem Stoff, mit ganz kurzen Ärmeln und einem winzigen verschrumpelten, weil nicht gebügelten Kragen, vorne durchgeknüpft. Judith hatte auch so ein Kleid gehabt, von H&M. Aber das Modell in Türkis. Sabine trug das Modell mit den hellblauen Streifen. Diese Kleider reichten bis zum Knie. Sabine sagte, es gebe noch eine dritte Ausführung, in Rot. Ich schaute mich im Lokal um, konnte das rote Modell auf Anhieb aber nicht entdecken.
Selber trug ich eine blaue thailändische Fischerhose mit weiten Hosenröhren, dazu ein Jahre altes Zirkus-T-Shirt, weiß mit vorne einem Clownsgesicht. Wenn man die Wohnung wechselt, kommt das Unterste zuoberst. Ich hatte das T-Shirt trotz fortgeschrittener Fadenscheinigkeit wieder in Gebrauch genommen, weil alte Kleidung einem manchmal ein Gefühl der Sicherheit gibt. Außerdem mochte ich es, dass das T-Shirt eng war und meine Brustmuskulatur betonte.
Die Kellnerin brachte neue Getränke. Tibor erhob sein Glas und sagte in die Runde:
»Eine erfolgreiche Trennung beglückt die Menschen im neuen Jahrtausend.«
»Ja, eh«, brummte ich. Mir missfiel der Spott, mit dem er den Trinkspruch ausgebracht hatte. Wollte er sich über mich lustig machen? Wobei: Es war wohl nicht böse gemeint. Tibor machte Schluss, so wie man etwas ausspuckt. Wenn ich ihm erzählte, dass ich mit Judith telefonierte, sagte er, ich sei ein unverbesserlicher Esel. Er konnte nicht begreifen, dass jemand für eine Trennung mehr als drei Tage aufwendete. Er vertrat den Standpunkt, abwicklungstechnisch sei eine rückstandslose Trennung in einem Gespräch von fünf Minuten möglich. Falls das für mich schal klinge, sei’s ihm wurscht, er habe den Beweis schon mehrfach erbracht, er könne mir Namen nennen. Oder ich könne mich beim nächsten Mal im Schrank verstecken und zuhören, ja, im Schrank.
Claudi, die für das nächste Exempel hätte herhalten müssen, murrte, aber ihr Murren ging unter, weil die andern mich fragten, wie und was. Es fühlte sich an, als sei ich in einen Ascheregen geraten. Die Asche schlug sich auf allem nieder, drang in alle Poren und legte sich auf meine Stimmbänder, so dass ich kaum etwas herausbrachte.
»Wie lange wart ihr zusammen?«
»Hat sie einen anderen?«
»Bist du schon wieder auf der Suche?«
Zu unserer Runde gehörte ein großgewachsener Typ mit römischer Nase, offenbar ein Cousin von Karl. Er wirkte nett, lebte aber, wie mir schien, in seiner eigenen Welt.
»Tosca ist ein ganz überwältigendes Werk …« Undsoweiter.
Jetzt beugte er sich zu mir herüber und legte los, seine Schwester habe nach einer Trennung versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Im Zusammenhang mit dieser Geschichte erzählte er, dass seine Freundin ihn Anfang des Jahres verlassen habe und jetzt mit Achtzehnjährigen herumrenne.
»Das ist doch nicht normal«, empörte er sich.
Alle bis auf mich lachten, gleichzeitig pflichteten sie ihm bei. Tibor behauptete, die Abnormale, die auf Milchbärte stehe, habe eine gewisse optische Ähnlichkeit mit Judith. Der soll gefälligst seine Beobachtungen für sich behalten, speziell diejenigen, die er macht, wenn es um Judith geht.
Während die anderen weiterredeten und Trennungsgeschichten zum Besten gaben und Bestellungen riefen, war ich sehr bange, aber ich versuchte, es nicht zu zeigen. Niemand sieht gerne einen ständig hängenden Kopf. Ich erschrak vor dem Gedanken, dass in der Zukunft etwas unaussprechlich Grauenhaftes auf mich wartete … dass mir dort alle Türen vor der Nase zugeschlagen wurden, eine nach der andern. Meine Nerven waren aufs äußerste angespannt.
»Warum jetzt eigentlich?«, hakte Karl nach.
Der Trottel soll mich gefälligst in Ruhe lassen. Ich hatte keine bessere Erklärung als die, dass es so gekommen war. Diese Erklärung hätte eigentlich ausreichen müssen, klang aber auch in meinen Ohren wie eine Ausflucht. Deshalb ärgerte ich mich.
»Ich versteh’s selber nicht«, sagte ich böse: »Und jetzt geh mir nicht länger auf die Nerven.«
Es wurden einige Wegwerfsätze über Trennungen im Allgemeinen und Speziellen gewechselt. Claudi sei einmal mit einem Typen zusammengewesen, der immer ihre leeren Zahnpastatuben und Shampooflaschen aus dem Müll geholt habe, um sie noch besser auszudrücken. Irgendwann habe sie ihn angeschrien, er solle gefälligst aufhören, in ihrem Müll zu wühlen. Kurz darauf hätten sie sich getrennt, sie weine dem Kerl keine Träne nach.
»Zum Wohl!«
Tibor sagte:
»Trennungen stärken den Charakter.«
Er zwinkerte, als sei ihm da zu seiner eigenen Verblüffung etwas ganz Einleuchtendes aus dem Ärmel gefallen.
Der Cousin von Karl schlug vor, jeder von uns solle ein solches Ein-Satz-Statement abgeben. Er überlegte und sagte in Kunsthistoriker-Manier:
»Trennungen erinnern an den Tod.«
Tibor lachte schallend. Er sagte offen, was er davon hielt, er habe sein Lebtag noch keinen solchen Quatsch gehört. Der Cousin machte ein beleidigtes Gesicht.
Die Kellnerin brachte uns für einige Momente in Kontakt mit einer anderen Wirklichkeit: sie nahm weitere Bestellungen auf. Die Frau gefiel mir, eine speckige, selbstbewusste, fröhliche Polin, die sich Goscha nennen ließ. Sie trug solide Wanderschuhe und hatte eine Schürze umgebunden. Wenn sie lachte, bekam sie an den Seiten der Nase Falten wie ein Hase, der schnuppert. Einen Augenblick lang war ich glücklich. Und der volle berstende Alltag rollte durchs Lokal. Alle Welt schien zu strahlen. Ich dachte meine Gedanken inmitten lächerlich vieler strahlender Menschen. Alle redeten. Und Sabine sagte:
»Jeder sollte sich mindestens einmal im Leben trennen.«
Als niemand darauf reagierte, sagte sie etwas lauter:
»Das war mein Satz.«
»Welcher?«
»Jeder sollte sich mindestens einmal im Leben trennen.«
»Brutal!«, sagte Claudi aus heiterem Himmel, denn offenbar enthielt der Satz eine geheime Botschaft.
Karl fragte:
»War das jetzt wirklich nötig?«
Da gab Sabine ihm eine Ohrfeige, dass ihm die Brille von der Nase flog, zack.
Wenn etwas die Macht zu haben scheint, die Zeit langsamer laufen zu lassen, ist es ein plötzlicher Ausbruch von Gewalt. Mit einem Mal dringt alles wie in Zeitlupe zu einem her, und man kann auf sehr vieles gleichzeitig achten, auf zehn Gesichtsausdrücke, auf zehn kleine Geräusche, auf was immer man will.
Karl, der wie auf Knopfdruck so rot geworden war, dass Striemen nie und nimmer erkennbar gewesen wären, schrie herum, so unangenehm laut, dass er die Ohrfeige tatsächlich irgendwie wegschrie. Sabine, unglücklich, bleich, schrie ebenfalls, nämlich, er solle das Maul halten. Wir anderen hielten uns, jeder auf seine Art, heraus, tun konnte man ohnehin nichts, fand ich, das mussten sie unter sich ausmachen. Wenn sie müde genug geworden waren, würden sie wieder Ruhe geben.
Als sie sich ausgeschrien hatten, umringt von drei Kellnerinnen, die vorsichtig zu beschwichtigen versuchten, fragte Tibor, der bis dahin sein Grinsen im Bierglas versteckt hatte:
»Was sollen wir tun? Sollen wir euch allein lassen?«
»Nein, wir gehen«, sagte Karl, und der Satz war wie entstellt von Partikeln, die daran festklebten, Ablagerungen aus Frustration, Zorn, Scham und der Anstrengung, sich zu beherrschen.
Sabine stammelte etwas, zögerte. Tibor machte mit dem Daumen eine Bewegung Richtung Tür und brummte:
»Hau bloß ab. Was sollen wir jetzt mit dir? Komm morgen wieder, dann kannst du erzählen, wie es ausgegangen ist.«
Als die beiden weg waren, sagte Claudi mit eingezogenem Kopf:
»Leck mich am Arsch.«
Ich war empört und sagte:
»N-nein, also … das geht gar nicht.«
Karls Cousin hingegen winkte ab, er meinte:
»Schade für Sabine, sie mag solche Dramageschichten. Das Ganze wäre für sie ein Ereignis, aber … dass wir es gesehen haben … das ist natürlich peinlich für sie.«
Er nahm einen Schluck. Gleich darauf sagte er noch:
»Karl soll wegen einer Watsche nicht so ein Gesicht machen.«
»No, na, nicht?«, fragte ich und trank mein Glas leer. »Ich an seiner Stelle …«
»Beruhig dich«, fiel mir Tibor ins Wort.
Wir bestellten noch zwei Runden. Irgendwann versandete das Gespräch und kam nicht mehr in Gang. Claudi drückte an ihrem Handy herum. Der Cousin verabschiedete sich. Ich selber fühlte mich wie ausgesetzt unter Fremden. Trotzdem und obwohl ich hundemüde war von den bösen Flaschengeistern und dem Nonsens, dem man sich Tag für Tag stellen muss, folgte ich Tibor und Claudi in die Wasagasse, wo Tibors Familie in einer riesigen Mietwohnung wohnte.
»Schlafen gehen wir erst, wenn der Kuckuck Kuckuck ruft«, sagte Tibor.
Dass wohlhabende Familien in Mietwohnungen wohnen, kannte ich von zu Hause nicht, ich stamme von Bauern und Wirtsleuten ab, solange man’s zurückverfolgen kann. Neu war mir auch, wie selbstverständlich diese Menschen über ihre Wohnungen redeten, als wären sie ihr Eigentum. Für Tibors Eltern und auch für Tibor war es ganz natürlich, dass ihnen sowohl die Wohnung in der Wasagasse als auch die Wohnung der Großmutter gehört. Die Wohnung in der Wasagasse war für mich eine richtige Städterwohnung: Sicherheitstür mit einem Balken, drinnen alles dunkel und eher muffig. Im Wohnzimmer Biedermeiermöbel und ein Ölschinken an der Wand. Auch einen verglasten Bücherschrank mit alten Lederbüchern gab’s, wobei klar war, dass die Bücher nur Ausstellungsstücke waren, weil hier mit Sicherheit niemand las. Tibors Vater machte Geschäfte, ich bin ihm, glaube ich, nie begegnet. Seine Mutter war unscheinbar, sie machte immer nur die Tür auf. Mehr als einen Satz haben wir nie gewechselt.
Im Wohnzimmer redeten wir über das Ereignis, kamen aber bald wieder davon ab, weil es nichts mehr zu lachen gab, je länger wir darauf herumritten. Im Anschluss an ein längeres Schweigen fragte Claudi, wann ich in den Urlaub fahre. Urlaub? Auch dies ein Gesprächsstoff, der besser aus dem Spiel geblieben wäre. Zerknirscht gestand ich, dass ich in Geldschwierigkeiten steckte, weil Judiths Vater unerwartete Ansprüche stellte.
Den Besuch bei Judiths Schwester ließ ich weg, den Rest berichtete ich wahrheitsgemäß. Mitten in der Erzählung verlor ich den Faden. Die Unordnung in meinem Leben fühlte sich tief und bedrückend an. Claudi und Tibor redeten auf mich ein. Aber ich horchte erst wieder auf, als Tibor sagte, er an meiner Stelle würde zugreifen. Jetzt realisierte ich, dass er mir gerade den Vorschlag gemacht hatte, ihn bei Professor Beham zu vertreten, er selber habe sich übernommen und wolle für zwei Wochen aufs Land.
»Ich werd wohl müssen …?«, sagte ich mit einem dummfragenden Gesichtsausdruck.
»Geh Montag früh hin und sag, Tibor schickt dich.«
»Was muss ich tun?«
»Sie werden es dir sagen.«
»Ist okay.«
»Denk an das Geld.«
»Ja-ja, ununterbrochen. Und sonst?«
»Nähere dich vorsichtig.«
»Wem?«
»Dem Zwergflusspferd … Und wenn du gefragt wirst, ob du Französisch sprichst, sag nein.«
Er ließ einige Erklärungen folgen, nicht zu der Sprachproblematik, aber zu Fressgewohnheiten, Tagesabläufen und Diensteinteilungen. Wenn sonst nichts zu tun sei, dürfe man während der Arbeitszeit lernen. Dann eine Wegbeschreibung:
»Dort kommst du zu einem Haus, bei dem das Dach so weit über die Garage heruntergezogen ist, dass du in die Dachrinne kotzen kannst.«
Während er so redete, schlief ich ein. Ich träumte von Frankenstein, der die Gesichtszüge von Judiths Vater hatte, und von Professor Beham, der ein Zwergflusspferd an der Leine durch einen Dschungel aus Plastik führte. Professor Beham dozierte, dass der nach vorn abfallende Körperbau des Zwergflusspferdes Buschbrecher genannt werde. Im Hintergrund hörte ich Trommeln, die langsam lauter wurden, geheimnisvoll wie aus einer Welt, in der Kriege erklärt werden. Da erwachte ich vor Schreck und stellte fest, dass Claudi und Tibor Sex hatten. Die Geräusche kamen aus dem Nebenzimmer. Zwischendurch hörte ich die beiden reden.
»Ich glaube, ich mache das ganze Bett blutig«, sagte Claudi. Dann etwas lauter: »Einmal habe ich mit einem Studienkollegen gebumst, während der Regel. Der war ganz verstört, dass es da so viel Blut gibt, das habe er nicht gewusst, das sei ihm neu.«
Die beiden lachten. Claudi fröhlich, fast glockenhell. Bei Tibor hörte es sich an, als liege Claudi auf ihm oder als sei seine Stimme belegt. Es folgten wieder die rhythmischen Schläge, die sich in meinem Traum in das Geräusch von Trommeln verwandelt hatten. Das alles ging mich nichts an, fand ich. Also schlich ich auf Zehenspitzen aus der Wohnung, hinaus in die Nacht, ins Geflecht der Straßen, ins Konglomerat der Häuser, auf der blauen, schmutzigen Erde, in der großen weiten Welt. Und die Trommeln waren mit mir.
Drei
Der Samstag verwandelte sich in einen Sonntag, der letzte freie Tag. Beim Wachwerden herrschte fast kein Verkehr, so dass ich einen Moment lang dachte, ich wäre woanders. Die Sonne hatte das Bücherregal erreicht, die Plastikhüllen der CDs und DVDs glitzerten an den Rändern. Ich drehte mich einige Male im Bett herum, schaffte es aber nicht, wieder einzuschlafen, das sehnliche Wünschen hatte genau den gegenteiligen Effekt, auch hier. Also stand ich auf und putzte mir die Zähne. Oft, wenn ich mit Judith Zähne geputzt hatte, hatte sie über mein Spiegelbild gelacht, denn nur im Spiegelbild war ihr aufgefallen, wie schief meine Nase ist. Daran musste ich denken.
Im Alltag fehlte mir Judith am meisten. Was tun mit all den Ritualen, die man als Paar hatte? Samstag früh gemeinsam einkaufen gehen, dem Kolporteur eine Zeitung abkaufen, dann, wieder zu Hause, Kaffee trinkend, Füße auf dem Tisch, die Zeitung lesen. Wer bekommt zuerst welchen Teil? Vorne oder hinten? Soll man diese Rituale allein weiterpflegen? Das geht nicht.