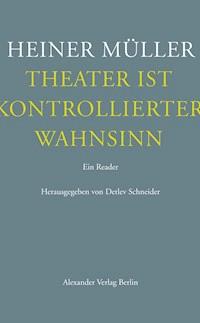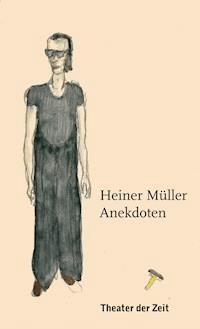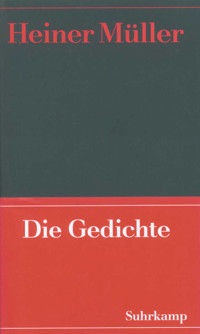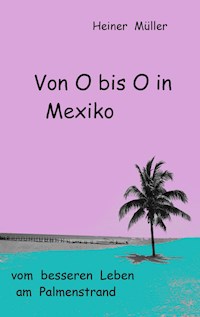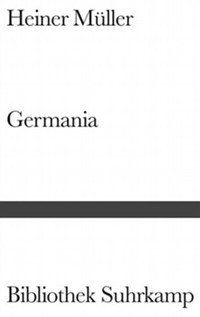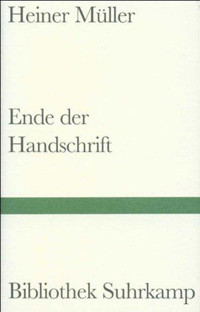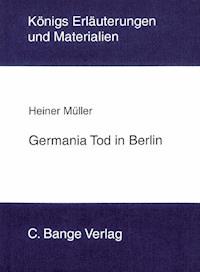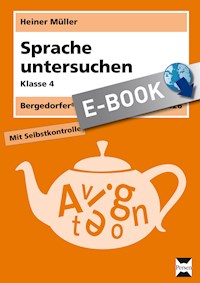17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
• Ein Lexikon als Lesebuch
• Über 160 Einträge
• Von Amerikanisierung, Ami und Coyote über Charles Manson und Marilyn Monroe bis Zombie und Zweiter Weltkrieg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Heiner Müller
Der amerikanische Leviathan
Ein Lexikon
Herausgegeben von Frank M. Raddatz
Mit Fotografien von Ginka Tscholakowa und Brigitte Maria Mayer
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
A
B
C
D
EF
G
H
I
J
K
L
M
N
O
PQ
R
S
T
U
V
W
XYZ
Nachwort
Die amerikanische Epiphanie
Editorische Notiz
Nachweise
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
A
Amerikaerfahrung
AMERIKA, MORGENSTERN, ERBE
Ein Gespräch mit Wolfgang Schivelbusch
[Band I]
Ja, wir haben uns schon darüber unterhalten, daß es mir jetzt wesentlich schwerer fällt, ich auch gar keine Lust hab', etwas Genaues zu sagen. Ich kann's auch gar nicht. Ich werde nach drei Jahren viel besser wissen, was ich jetzt gesehen habe und jetzt sehe. Das ist sicher eine Art von Aufnehmen der Realität, die auch durch die Arbeit bedingt ist. Ich weiß immer erst nach einem Jahr oder nach einem halben, was ich geschrieben habe. Ich kann also nur von subjektiven Sachen ausgehen und das ist, jetzt mal ganz dumm chronologisch, die sogenannte Vor-Vergangenheit meiner Amerikaerfahrung. Die erste Amerikaerfahrung war – so simpel das klingt – Karl May. Da habe ich mich also wenig unterschieden von den anderen meiner Generation. Und da war zunächst Amerika das Land der Bösen […], die die edlen Indianer ausgerottet haben. Es gab dann noch irgendwelche Deutschen, die daran auch beteiligt waren, die aber meist etwas rühmlicher beteiligt waren, also jetzt nicht nur bei Karl May.
Die zweite Sache, an die ich mich erinnere, war – und das gehört nun zu einem etwas realeren Amerikamythos –: Es gab in dem Dorf, wo ich geboren bin, ich glaube, Ende der 20er Jahre, eine große Vereinigung, das war ein Verein, der gegründet worden war, um das Morgensternsche Erbe gerecht zu verteilen unter seinen Verwandten im Erzgebirge. Das heißt, irgendwie war das Gerücht entstanden, daß ein Millionär namens Morgenstern, der aus dem Erzgebirge mal ausgewandert war, gestorben war und alle seine Verwandten im Erzgebirge – das war kurz vor der Depression – zu Erben eingesetzt hat. Und da ist eine Organisation gegründet worden zur Verwaltung dieses Erbes und [der] Verteilung. Es wurden ungeheuere Recherchen angestellt, um die Verwandten zu finden, es gab da etliche Leute, die Morgenstern hießen, und die Familien waren meist sehr verzweigt. Es sollte ohne große Streitigkeiten vonstatten gehen. Und diese Organisation hatte auch Kapital aufgehäuft mit der Zeit – wie das so ist, wenn man einen Verein gründet, hat man irgendwann auch Geld und weiß gar nicht wieso. Und sie haben dann sogar sehr soziale Sachen gemacht, die haben z. B. – alles in Erwartung des großen Millionenerbes, das da kommen wird – Schwimmbäder gebaut. Mein erstes Schwimmbad in dem Dorf, wo ich geboren bin, war gebaut aus der Stiftung »Morgenstern«. Das Erbe kam aber nie an.
Die nächste Begegnung war bei Kriegsende, wo ich in Nord-Mecklenburg war in einer quasi militärischen Einheit, die Kreis-Arbeitsdienst hieß. Und wir wurden dann irgendwann Ende April in Richtung Südwesten in Marsch gesetzt, – ohne daß wir genau wußten, warum – aus dem Lager weg, wo wir ausgebildet worden waren. Und später war klar, daß unsere Führer das Bedürfnis hatten, lieber von den Amerikanern gefangen zu werden als von den Sowjets. Und das war wohl der einzige Grund für diesen Südwest-Marsch. Und da habe ich auch zum ersten Mal lebende Amerikaner gesehen, glaube ich, die mich dann auch gefangen haben; und bei mir hatte ich eine Flasche Anisschnaps, die ich irgendwo aufgelesen hatte. Unterwegs stieß man damals auf umgestürzte Flüchtlingstrecks und tote Pferde, auf alles mögliche. Und ich hatte eine Flasche Schnaps liegen sehen irgendwo, interessierte mich natürlich brennend, und die hab' ich mitgenommen und stellte fest, das war Anisschnaps. Aber bevor ich einen Schluck trinken konnte davon, nahm mir der Amerikaner – kassierte er mir – den Schnaps ab. Das hat ein bißchen die antiamerikanische Einstellung bei mir wiederbelebt, die von Karl May.
Als ich die ersten Stücke von Bond gelesen hab', war für mich zunächst die Fähigkeit imponierend, Sachen in Bilder, in sehr starke und sehr intensive Bilder zu übersetzen, also Vorgänge auf Bilder zu konzentrieren. Zum Beispiel wenn da in einer Szene ein Bauer erschlagen wird, dann eben hinter einem Wäschelaken, das seine Frau gerade auf die Leine gehängt hat, so daß das auf der Bühne keinen sehr guten Effekt macht. Ich meine das nicht negativ. Ich glaube, es hängt damit zusammen – so habe ich mir das damals erklärt – daß, wenn man schreibt und besonders fürs Theater schreibt, in dieser Welt wohl gegenüber den akustischen Reizen die Bilderwelt viel greller ist und viel beanspruchender, auch totalitärer. Ja, daß da ein Zwang entsteht mitzuhalten, wenn man Theater machen will, daß sich eben ein Zeitungskiosk sehen lassen kann. Eine Schwierigkeit, über diese Eindrücke hier zu reden, ist natürlich von dieser Ecke her (also von der Bilderwelt her usw.) nichts Neues für mich. Man braucht nur nach West-Berlin zu kommen oder in die Bundesrepublik, nach Frankfurt oder so, dann hat man den Aspekt genauso.
Wenn ich meinen Eindruck jetzt zusammenfassen wollte von diesem Land im Verhältnis zu Westdeutschland, dann ist das hier eine Gesellschaft – und das kann man nicht Gesellschaft nennen, das ist schon zu einheitlich –, dieses Konglomerat hier ist in dauernden Explosionen, […] explodiert ständig. Aber nie als Ganzes, weil es kein Ganzes ist. Und das ist zunächst mal ein Mittel, die zu wünschende große Explosion zu verhindern. Die wird verteilt, die verteilt sich. Also explodiert das ständig irgendwo.
[…]
Verteilt sich, ja, ja, ja. Was ich meine, ist zunächst etwas ganz Primitives: Das USA-Bild ist natürlich zunächst sehr global, wenn man aus unseren Ländern kommt; und man stellt sich da leicht, wenn man sich überhaupt etwas vorstellt, einen geschlossenen Block vor. Und wenn man hier ein paar Monate ist, merkt man, daß es da sehr verschiedene Blöcke gibt, und daß es auch keine Blöcke sind, die sich eben ständig aneinander reiben, gegeneinander bewegen und ineinander explodieren, wie auch immer. So ungefähr meine ich das. Ich hab' von Amerikanern gehört, daß für sie Frankfurt am Main schrecklicher ist als New York und eine amerikanischere Stadt ist; wobei sie voraussetzen, daß New York für sie schrecklich ist, was für sehr viele Amerikaner scheinbar gilt, die nicht in New York leben. Da ich Frankfurt kenne und es scheußlich finde – das ist klar –, brauchen wir das nicht zu begründen. Es war ja auch die erste Stadt, die wieder hochgejagt wurde. Das hat trotzdem immer noch – obwohl sicher die Stadtplanung ständig zusammenbricht und die Rechnung überhaupt nicht mehr aufgeht – was Ausgerechnetes, das in irgendeiner Weise durchkonstruiert oder präzise in Schubfächer aufgeteilt ist. Verglichen z. B. mit New York oder auch mit Chikago. Ich meine, einerseits ist New York sicher eine Stadt, die verfault und zerfällt, aber im Zerfall bilden sich auch dauernd neue Zellen, und das ist schon beinahe ein Organismus geworden. Durch die Unlösbarkeit der Probleme kriegt das langsam einen organischen Charakter. Überträgt man das jetzt auf eine Stadt, auf die Geschichte, über die der Brecht geschrieben hat, wie der Wald diese […] Leute da auffrißt, so frißt die Stadt eben hier sich selber auf und kotzt sich selber aus, und dieser Übergang ist schon sehr interessant. Wo also die absolute Zivilisation jetzt im technischen Sinne umschlägt in den Dschungel.
[…]
Interessanter ist es für mich natürlich schon dadurch, daß hier die Dritte Welt vertreten ist, sie ist ein Element hier schon, auch wieder in ganz verschiedenen Erscheinungsformen.
[…]
Nicht nur in New York, überhaupt in den USA, sie ist auch im Land und nicht nur als Rohstoffbasis.
[…]
Es ist hier nur augenscheinlicher. Hier sind die Konfrontationen direkter, und hier ist der Druck stärker, und die Auseinandersetzungen sind wahrscheinlich gewaltsamer, oder es kommt schneller dazu. Ansonsten ist die Zivilisation grundsätzlich schon nicht anders. In Texas ist das relativ klinisch, da ist einfach eine klinisch-chirurgische Trennung von Rassen oder Farben, bei einem Beamten aus Boston z. B., da wohnen meist Beamte der Universität von Cambridge. Ich glaube, die meisten Universitätsleute da haben nie den Teil der Stadt betreten, in dem die Schwarzen leben, und haben auch nicht die Absicht, das je zu tun.
Für mich ist wichtig – und das spricht nicht unbedingt für mich und gegen das Material, es sagt zunächst weiter nichts, als daß ich von meinen Grunderlebnissen her angewiesen bin auf Material, in dem es deutliche und direkte Widersprüche gibt – einzig der Umgang mit dem neuen Material. Das ist, glaube ich, für mich eine wirkliche Frage.
[…]
Man kann ein Stück wie ZEMENT, oder was immer, nicht zweimal schreiben. Solch ein historischer Punkt kommt ja nicht zweimal. Und daß das in der DDR auf Anhieb kleiner aussieht, das ist sicher richtig. Aber das sagt noch nichts über die Folgen. Vielleicht sieht das andere auch nur größer und welthistorischer aus, weil es näher ist an den Modellen, die man hat. Die Französische Revolution z. B., die klassische Revolution kann man über die Literaturtradition besser mit alten Modellen verbinden, so daß auch die Strukturen viel, viel verfestigter sind und man das viel schneller in den Blick kriegt. Aber um einen Preis natürlich, und das ist der Preis der Wirkung. Sie sagen, das ist so weit abstrahiert von nationalen [… nationalsozialistischen] Erscheinungen oder Erscheinungsformen, aber das hat auch den Preis, daß es formal so kompliziert sein muß deshalb. Es läßt sich z. B. kaum übersetzen. Der internationale Verständlichkeitsgrad der Parabel, der kommt nicht zum Tragen, weil er z. B. durch eine komplizierte Sprachform erkauft ist. Es ist eben schlechthin nicht internationalisierbar, weil es kaum übersetzbar ist. Na ja, z. B. hier ist ja eine Sache auf jeden Fall klar, daß diese Bilderwelt, die Explosionen, die Inflationswelt der Bilderwelt die Literatur ziemlich in die Ecke oder an die Wand gedrängt hat. Ich glaube, daß ganz wenige Leute hier Fiction lesen. Wenn, dann werden Sachbücher gelesen, die aus irgendeinem Grund gerade auf die Bestsellerliste geschwemmt worden sind. Aber grundsätzlich gibt's nachlassendes Interesse, glaube ich, für Literatur. Aber die andere Seite ist, daß man hier Leute wie [Gaddis] z. B. mag, der eben dicke Romane schreibt, der alle 10 Jahre einen Roman von 800 Seiten schreibt. Das ist ja auch etwas Merkwürdiges, und ich hab' noch keinen Menschen getroffen, der imstande war, den durchzulesen. Ich finde den ganz interessant, aber ich komm' nicht sehr weit. Das ist einfach zu abschreckend. Und was ich meine, ging gar nicht so sehr um den Punkt, daß man nicht bis an sein Lebensende solche Verse schreiben kann. Ich meinte eben, diese Internationalisierung des Materials ist erkauft oder wird erkauft mit dem formalen Kompliziertheitsgrad. Und hier merkt man eben viel deutlicher als woanders – oder für mich war's eben viel deutlicher –, daß auch das Theater eben nicht […] zum Aussterben verurteilt ist, wenn es nicht auch eine […] entwickelt. Man kann nicht mit Sprachkunstwerken irgendwelche größeren Menschenmengen erreichen. Es hat sich bei uns im Grunde auch herausgestellt inzwischen, daß man nicht eine Sache darauf […] stellen kann. Und hier wird es nun absolut deutlich. Den Hauptpunkt, auf den ich ja eigentlich hin wollte, habe ich nun wieder vergessen. Diese Bilderwelt, die zunächst den Eindruck macht einer Exposition oder Fülle von Fantasie – Freisetzung von Fantasie –, setzt nur die Fantasie der Erfinder frei und nicht mal das, und im Ergebnis führt das dazu, daß Fantasie abgetötet wird, weil jeder Impuls, jeder Versuch, etwas zu imaginieren, sofort eine Vorlage findet, ein Klischee, in das man ihn hineingeben kann, das ihn aufsaugt und auch abtötet. Das ist die negative Seite dieser Entverbalisierung oder Entliterarisierung der Gesellschaften, das hat zwei oder mehrere Seiten. Eine Seite ist doch sicher, daß diese Gesellschaft auf den toten Indianern aufgebaut ist. Ich meine das gar nicht moralisch jetzt. Aber daß die Leute, die jetzt hierhergekommen sind aus Europa, eben hier keine Elterngräber und keine Wurzeln hatten, keine Traditionen, und daß es bis jetzt nicht gelungen ist, glaube ich, hier so etwas wie ein Geschichtsbewußtsein herzustellen. Als ich, nach ein paar Wochen Texas, nach Madison flog und nach [Milwaukee] – da war irgendeine Konferenz – und irgend jemand fuhr mich durch [Milwaukee] und zeigte mir die Stadt, hatte ich einen ganz merkwürdigen Eindruck, den ich nicht im Detail begründen konnte, jetzt eigentlich auch nicht, daß nämlich Deutschland so ausgesehen hat, als ich ein Kind war, also in den späten 20er oder eigentlich den früheren 30er Jahren. Ich kann das auch heute noch nicht begründen. Das hat sicher ein bißchen damit zu tun, daß da ein ziemlich starker deutscher Anteil in der Gegend ist. Nun, denselben Eindruck hatte ich von den Leuten, aber nicht nur in [Milwaukee], auf andere Weise auch in Texas, daß da Haltungen übriggeblieben sind, in der Art der Beziehungen unter Leuten, die es in Deutschland spätestens seit 1945 nicht mehr gibt. Das heißt, dieses Land hat keinen Krieg erlebt, diese Bevölkerung im Land weiß nicht, was Faschismus ist, selbst wenn sie das machen. Es hat also keine wirklichen Traumata gegeben, die eine Nation gebildet haben. Ich meine, Nationen bilden sich unter anderem durch Bedrohungen, ob von außen oder von wo immer. Aber ohne ein gemeinsames Trauma gibt es kein gemeinsames Geschichtsbewußtsein. Es geht nur um einen fast biologischen Eindruck, wie sie sich bewegen, wie sie miteinander umgehen, miteinander sprechen, wie sie im Bus sitzen. Das ist alles wie vor 1933; dazu kommt, daß so etwas wie ein natürlicher Demokratismus gegeben war, durch die Umstände, unter denen sich die Leute hier durchsetzen mußten, eine Sache, die in Deutschland nie richtig stattgefunden hat. Und das beides vermischt sich und ergibt den Eindruck von einer Qualität, die in Deutschland nicht erreicht worden ist, historisch nicht erreicht worden ist. Eine mögliche Qualität, die vielleicht jetzt in Europa erreicht worden ist durch das Trauma des Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Das ist hier in großen Teilen des Landes und bei großen Teilen der Bevölkerung eigentlich noch gar nicht angekommen. Hier fehlt einfach ein wirkliches passives oder aktives Teilnehmen an einer historischen Erfahrung. Deswegen die ungeheuere Bedeutung des Vietnam-Schocks, Watergate und was da alles dranhängt. Dadurch ist eigentlich die Situation die, daß ich mich einerseits bewege – ich meine jetzt von meiner Haltung her – wie unter Eingeborenen, ich meine, in dem alten faschistischen Sinn, unter Wilden. Wie ein Mensch, der aus einem sehr alten Weltteil kommt. Und andererseits wie unter Marsmenschen, die also im Jahr 2000 leben. Dieser Widerspruch taucht hier ständig auf, er ist ja auch auf jeder Straße hier schon da. Da ist auf der einen Seite die Steinzeit und auf der anderen Seite das Jahr 2000. Das ist natürlich mit das größte Faszinosum an diesem Land. Die Schwierigkeit mit der Dialektik hier ist ja, daß man damit zurechtkommen muß. Wenn in Europa eben dieser Widerspruch oder die Gleichzeitigkeit von Steinzeit und Jahr 2000 in einer Küche stattfindet, ist hier genug Platz, kann man das hier über das Land verteilen, die verschiedenen historischen Phasen oder Entwicklungsstufen, die gleichzeitig existieren. Deswegen hat man das hier schön wie in einem Schaukasten, man kann das übersehen und einfach die verschiedenen Seiten des Widerspruchs oder der Widersprüche kann man einzeln betrachten. Während man sie bei uns meist doch eben in der Einheit vorfindet, als Einheit vorfindet. Mir fällt auf, wenn ich amerikanische Filme sehe, jetzt hier, und hier sehe ich sie anders natürlich als in der DDR oder in Europa. Mich langweilt das zunehmend, amerikanische Filme zu sehen, vielleicht, weil ich sehr viel gesehen hab', aber ich glaube, unter anderem deswegen, weil da nie Ideen sind, nie Gegenstand. Es geht nie um Ideen. Das Denken ist nie Gegenstand der Darstellung. Es wird auf jeden Fall nie ein Überschuß an Gedanken produziert oder ermöglicht – jedenfalls ganz selten. Bei uns ist auch ganz selten möglich, sich einen – im Sinne von Brecht – anderen Ablauf als den vorgeführten […] vorzustellen. Es wird selten ermöglicht, noch was anderes zu sehen, als einem gezeigt wird. Die Oberfläche ist sehr dicht, auch sehr dicht gegen die Wirklichkeit des Zuschauers und gegen die Wirklichkeit der Produzenten. Also, was ich eigentlich meine, ist die Formel für Naturalismus, daß also im Naturalismus […] das Abschließen der Sache gegen das Subjekt der Produzenten und der Konsumenten ist. Als ich gesehen hab' den Film, von Kazan glaub' ich, »On the Waterfront«, die erste große Marlon-Brando-Rolle, den habe ich vielleicht gesehen vor 10, 12 Jahren – ich weiß nicht – kann mehr gewesen sein, da erschien der mir sehr monumental, sehr elisabethanisch beinahe, also die Geschichte mit den Brüdern usw. und die große Schlußschlägerei am Kai oder an den Docks; da habe ich ungefähr in der gleichen Zeit, oder etwas danach, hab' ich ein paar […] Verfilmungen gesehen. Ich kann mich nicht erinnern an den Regisseur, das waren sehr grobschlächtige Sachen, die mir auch sehr elisabethanisch vorkamen damals. Da waren so die üblichen Konstellationen, daß der Held an einen Stuhl gefesselt zusehen muß, wie seine Partnerin stirbt oder so. Er dann – es geht um eine bestimmte Zeit, in der er die Chance hat, bis zu ihr hinzukriechen und sie zu erreichen. Ich glaube, es war sogar so als eine Teufelswette formuliert, daß, wenn er's schafft bis dann und dann, dann darf sie wenigstens raus oder irgend so was. Dann eben ganz primitiv, jetzt die Zeit ausgeschlachtet, die angegeben und seine Anstrengungen, den Rekord zu halten. Von heute aus gesehen, das fiel mir vorhin ein und [ich] weiß nicht, ob das qualifiziert ist oder ob das nur Quatsch ist, da erscheint mir dieser […] Film, also der, um den es da ging. Am Schluß explodiert ein Haus, wahrscheinlich in Kalifornien am Meer, und das war ein halber Weltuntergang, und es ging wahrscheinlich um Atomspionage oder irgendwas. Der erscheint mir, von heute aus gesehen, viel realer als der […]. Ich suche jetzt den Grund dafür, warum der […] mir, von hier aus gesehen, plötzlich real erscheint. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil er stärker […] hat, weil weniger Details drin waren und weil er unrealistischer war. Deswegen erscheint er mir, von hier aus gesehen, nach Ansehung so vieler Filme, mehr zu sagen über die wirkliche Situation hier als so ein doch relativ gut gemachter »Waterfront«. Vielleicht einfach auch deswegen, weil er viel direkter auf die Massenbedürfnisse zugeschnitten ist, also für Massenbedarf produziert ist und dadurch mehr sagt über die Realität dieser Massen. Wenn man von der Definition ausgeht, ist das völlig korrekt, und das ist ja auch in solchen Filmen wie dem […] Film vielmehr die Situation der Produzenten, daß sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Und während der, so ein vornehmerer Regisseur wie der Kazan, der verkauft sein Genie.
[Band II]
Interessant finde ich schon einen Punkt, also im Zusammenhang mit dem, was einen zunächst am meisten stört, diese Unterbrechung von Filmen und so weiter durch Anzeigen und durch Reklame. Ein Aspekt davon ist ja, daß damit die Einfühlung unterbrochen wird wenigstens, sie wird sicher nicht unmöglich gemacht, aber sie wird durch Unterbrechungen erschwert, oder sie muß immer neu hergestellt werden. Das finde ich inzwischen beinahe einen Vorteil, weil, klar ist der Zweck, beides verkauft sich besser, der Film und die Ware, für die man Reklame macht, aber die andere Seite ist eben, daß doch ein anderes Verhältnis zwischen dem Konsumenten und dem Produkt hergestellt wird. Man kann nebenbei noch einiges andere machen. Wenn man das jetzt politisch fortsetzen will und zurückgehend auf das, was wir über die Explosionen gesagt haben hier, da diese Gesellschaft nicht so einheitlich ist aus historischen und geographischen und was immer für Gründen, da sieht man ihre Teile natürlich besser, und das kann also jetzt sehr hypothetisch ein Vorteil sein bei dieser Art von Präsentation von Filmen z. B. im Fernsehen, daß man die Teile sieht, also, was man vielleicht wollte, was dazwischen kommt, und das kann vielleicht eine Haltung produzieren, die, wenn die Situation gegeben ist und wenn die Isolation benutzt wird, auch politische Folgen hat, daß Leute, die eben nicht ästhetisch erzogen worden sind per [Einfühlung], daß die auch nicht so schnell bereit sind, sich in gesellschaftliche oder politische Prozesse einzufühlen und sich anzupassen und […] daß geschärft ist der Blick für die Teile eines, einer Gesamtbewegung und daß ein manchmal sicher ganz anarchisches und ganz reaktionäres Bedürfnis da ist, dazwischenzugehen und einen Ablauf zu ändern. Und was hier manchmal sehr verblüffend ist, ist der Widerspruch zwischen einer progressiven Haltung und einem absolut stinkenden reaktionären Programm, daß also die stinkendsten Programme von Leuten befördert werden oder daß Leute sich dafür engagieren mit einer Haltung, wie man sich wirklich wünschen würde für ein besseres Programm z. B. in den Auseinandersetzungen jetzt in [Boston] speziell zwischen dem irischen Teil der Bevölkerung und den Schwarzen, daß da die Iren eben wie die Wahnsinnigen jetzt eben ein negatives Geschichtsbewußtsein entwickeln aus der amerikanischen Verfassung, auf der sie nun jetzt plötzlich bestehen. Die Metapher dafür war wirklich ja sehr schön, wo vor ein paar Tagen dieser schwarze Anwalt zusammengeschlagen wurde mit einer amerikanischen Fahne von einem Weißen, und der hat die einfach umgedreht und die Fahnenstange als Schlaginstrument benutzt; und das kann man von zwei Seiten interpretieren, aber es war die amerikanische Fahne, die für ihn die Verfassung war in dem Fall, weil er dagegen ist, daß man ihn, ohne ihn zu fragen, daß man die Kinder, ohne ihn zu fragen, zur Schule fährt, und das ist diese ganz merkwürdige Mischung also, die so verwirrend ist manchmal; […] in Austin, da gehen ab und zu Leute von Haus zu Haus mit einer Liste für irgendwelche Förderung innerhalb der community, die sehr vernünftig sind, berufen sich dabei auf die Verfassung, andererseits, wenn so linke Gruppen, was die da auch gemacht haben, von Haus zu Haus ziehen mit dem Text der amerikanischen Verfassung, ohne drüberzuschreiben, was es ist, und Unterschriften sammeln wollen dafür, dann werden sie rausgeschmissen, weil das ein kommunistisches Programm ist. Was ich so faszinierend fand, das erste Mal, wo mich amerikanische Literatur wirklich beschäftigt hat, das war, als ich gelesen habe »Die Wendemarke« von Faulkner, war ziemlich früh, so '46/47. Das war für mich ein ungeheurer Eindruck, dieses Buch. Später habe ich dann über Faulkner gelesen, und das hat dann meinen Eindruck formuliert, den ich nicht formulieren konnte, weil das zunächst so fremd und so doch ein ziemlich mächtiger Eindruck war, daß charakteristisch für Faulkner wäre, ich glaube, das war [Kazin], war ein ganz gutes Buch mal, das erschien ziemlich früh nach dem Krieg, hieß deutsch »Der amerikanische Roman«, hier heißt es anders, ich habe es inzwischen auch englisch gelesen, aber weiß nicht den Titel. Das Merkwürdige bei Faulkner ist, er führte das auf die Situation im Süden zurück, daß da eine Energie leerläuft immer wieder, daß da Triebkräfte, soziale, historische, was immer, keinen Gegenstand finden, immer diese Diskrepanz zwischen dem Anlaß und dem Aufwand bei Faulkner, und das finde ich was sehr Amerikanisches auch, daß da, was die immer mit Produktivität formulieren, daß da ungeheure Energien rotieren, die keinen Gegenstand finden, der sie wirklich produktiv macht, so daß immer soviel Destruktion dabei entsteht, und das hängt wieder zusammen mit der Ideenlosigkeit der amerikanischen Wirklichkeit. Es gibt keine amerikanische Philosophie, und es hat nie einen Versuch gegeben, aus der amerikanischen Erfahrung, die amerikanische Erfahrung mal jetzt von hier aus jetzt zu verallgemeinern, jetzt als Schlußfolgerung aus dem, was ich meinte mit Faulkner, mit dem Faulkner-Beispiel, daß hier ständig revolutionäre Situationen entstehen, es aber vorläufig ziemlich undenkbar ist, an eine Revolution zu denken. Es geht um das Verhältnis der ständigen Anwesenheit oder Entstehung von revolutionären Situationen ohne Revolution. Da fällt mir ein ein Spruch von, ich glaube sogar [Baudelaire]: »Die Langeweile ist der auf die Zeit verteilte Schmerz.« Und findet so […] statt wie eine auf die Zeit verteilte Revolution, die aber dadurch gleichzeitig erledigt wird. Zunächst mal ist mir eins hier wenigstens viel klarer geworden, als es mir vorher war, daß der amerikanische Kulturexport, also, wenn man das alles als Kultur bezeichnen will, über Fernsehen und Kinos, das hat alles natürlich sehr den Charakter von Vampirismus, und das ist schon beinahe was Parabolisches […] Maschinen in die Welt geschickt, die Fantasie schlucken sollen, weil man hier keine mehr hat. Hier gibt es nur negative Utopien. Ich habe noch keine andere hier auf dem Markt gesehen, also, ob science fiction oder was immer. Und zusammenhängend mit der Geschichtslosigkeit hier und mit dem Mangel, [ ] Fehlen an philosophischer Tradition ist der amerikanische Überbau eine ungeheure Hohlform und ein Vakuum mit einem großen Sog. Und ich bin eigentlich jetzt, es wäre Blödsinn, das zu sagen, ich wollte eigentlich sagen, daß ich jetzt viel milder gestimmt bin gegen diese Polemik von Harich, weil ich die jetzt anders verstehe.
[…]
Wenn man den Harich jetzt mal als ein Symptom nimmt oder als Formulierung einer Reaktion, z. B. die Graffiti in der subway, die sind wohl hauptsächlich von Puertorikanern oder […] ja. Und das ist zunächst ein ungeheurer Eindruck so, was Sie sagten, so proletarische Kunst. Sie versuchen, ihre Anwesenheit zu dokumentieren, also ihnen gehört diese Stadt oder wenigstens auch. Und sie sind auch mehr auf die subway angewiesen als andere Teile der Bevölkerung. Das nächste, was mir auffällt daran, ist, daß die Texte alle scheinbar mit der gleichen Handschrift gemacht sind. Ich glaube, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten, das ist, hat sehr viel zu tun mit dem amerikanischen Schönschreibunterricht, habe ich auch bei vielen Amerikanern, deren Schrift ich gesehen habe, hier gesehen, also die Grundzüge. Und die andere Seite ist, daß die, das Exzessive daran ein Verhältnis zur amerikanischen Schönschreibe, das kommt von den Comics, die ja alle Texte in den Sprechblasen, die ja auch wieder nur von der amerikanischen Schönschreibkunst sich herleiten, damit das jeder Schüler erkennt, und das finde ich dann schon wieder gespenstisch, daß bei so einem, also ästhetisch revolutionären Akt auch gleich wieder das Korsett mitreproduziert wird. Also zunächst mal ist es ein quasi revolutionärer Akt, diese Graffiti da zu machen. Und dann kommt der Vampir und vereinheitlicht die Handschriften. Eine Konsequenz daraus ist sicher, daß ich, das klingt sehr gegen Standpunkt, aber, daß ich jetzt viel mehr davon überzeugt bin, daß ich also dazu beitragen sollte, daß dieser Teil immer mehr Anlaß wird als dieser, das ist die eine Seite, und auf seinem Anlaßsein vielmehr besteht. Wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, dann kann man ungeheuer viel lernen von dem, was hier passiert. Mich bestätigt es eigentlich in Intentionen und auch Plänen, die für mich in der Zwischenzeit, bevor ich hier war, manchmal ziemlich fragwürdig waren, und darin bestätigt mich das eigentlich alles, was ich hier gesehen habe. Zum Beispiel gibt es hier ein Problem, die sowjetische Stoffwahl, weil der Stoff also größere Dimensionen hat als ein möglicher, aber denkbarer DDR-Parallelstoff, und das ist, glaube ich, von jetzt ab für mich die falsche Konsequenz. Ich muß auf jeden Fall unter anderem versuchen, wieder eine Möglichkeit zu finden, Sachen zu machen wie am Anfang, also wie z. B. KORREKTUR oder so was, wo ich mich sehr konkret mit DDR-Material beschäftige, auch wenn das nur in Leipzig interessant ist; aber es ist, finde ich, jetzt wieder ungeheuer wichtig, daneben andere Sachen, also wie alte Pläne, die aber, die ich unter anderem deswegen aufgeschoben habe, weil die im Moment ziemlich bodenlos waren und ich keine Relation finden konnte zu der Vorstellung einer unmittelbaren Wirkung in der DDR, z. B. historische Stücke oder so, […], wo ich jetzt den Bezug viel deutlicher sehe zur DDR-Realität und -Perspektive. Das ist eine Konsequenz auf jeden Fall, daß ich jetzt nicht mehr umhinkann, mir klarzumachen, daß für [einen Arbeiter in] irgendeinem Betrieb in Leipzig die deutsche Misere natürlich ziemlich belanglos ist, für den ist viel wichtiger, daß die Arbeitsorganisation in seinem Betrieb verbessert wird. Und eigentlich ist das ein Zurückgehen auf eine Optik, die man in der DDR unter Autoren jetzt für völlig überwunden hält, was ich jetzt sehr bedenklich finde nach diesem Aufenthalt. Es hängt sicher einfach damit zusammen, daß die Autoren alle, oder fast alle, ein ziemlich sicheres Leben führen in der DDR. Und einerseits machen sie nicht Kunst für Kollegen, die Auflagen sind hoch usw., müssen wir nicht drüber reden, und dieses bequeme Leben ermöglicht ihnen, sich weitgehend mit sich selbst zu beschäftigen. Ich behaupte nicht, daß das unwichtig ist, es wird aber ganz schnell steril, wenn man nicht sich immer wieder daneben auch mit anderen Leuten beschäftigt, die nicht in dieser Situation sind. Ich meine einfach, daß der amerikanische Pragmatismus –, also daß man hier manchmal ungeheure politische Energien einsetzt, um ein Krankenhaus zu verbessern oder zu erhalten, wenn das geschlossen werden soll oder so was. Und bei uns so als Autor neigt man dazu, so ein Krankenhaus schon nicht mehr wichtig zu nehmen. Ich meine, bei uns werden keine geschlossen, aber, ich meine, jetzt nur als […] okay. Ich meine, daß einfach der Alltag der Geschichte erlebt wird und daß Politik was ganz Unmittelbares ist und nicht Ideologie, über die negative Seite haben wir ja gesprochen, aber heute eben die positive Seite, daß Politik ganz ursprünglich genommen wird als das Organisieren von Beziehungen zwischen Leuten. Familiendramen werden doch […] oder die Familie als dramatische Einheit ist schwer zu verkaufen auf einer DDR-Bühne, weil das eingebettet oder gesprengt wird von so vielen, also umgreifenden Gruppierungen, daß sich Konflikte in der Familie nicht mehr so voll entladen können, wie das also bei Strindberg oder wo immer möglich war. Wenn ich von mir ausgehe, also nach '45, in den ersten Jahren konnte man in der DDR noch alle Zeitschriften kriegen aus allen Besatzungszonen und alle Zeitungen, ich habe also damals so ziemlich alles abonniert gehabt, was es so gab an irgendwelchen schwachsinnigen Literaturzeitschriften und so was, [aus] allen Westzonen auch. Das war sicher eine sehr wichtige Informationsquelle und so ein Nachholbedarf. Ich erinnere mich, daß ich, als ich zum ersten Mal eine Brecht-Szene gelesen habe, das war in der »Literarischen Revue« oder »Die Fähre« oder wie das Ding hieß, so eine Zeitschrift, ich glaube, in der französischen Besatzungszone, ich weiß nicht genau. Und da fand ich die Szene, das war natürlich die Szene mit der stummen Kattrin, die wurde da abgedruckt als Beispiel, daß es so was auch gibt. Und das fand ich ziemlich grau, nachdem ich so vieles Interessantes gelesen hatte, französische Literatur und amerikanische. Und so im Laufe der Jahre habe ich, und das ist vielleicht nicht unabhängig von dem, was in der DDR passiert ist, habe ich eigentlich erlebt die Aushöhlung der amerikanischen Literatur, und das wurde zunehmend leerer für mich, also wahrscheinlich einfach, weil es immer weniger beziehbar war auf meine Realität, und der Brecht z. B. wurde immer weniger grau. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Und jetzt, als ich hierherkam, […] mich zu informieren über den Stand der amerikanischen Literatur jetzt oder des Theaters und [zu] versuchen, den Anschluß zu finden, also an '46/47 und das, was damals der neueste Stand war, so Thornton Wilder und Cummings und was immer, was da gerade alles neu verkauft wurde. Und da habe ich zunehmend den Eindruck gehabt einmal, daß dazwischen wenig passiert ist, was für mich wichtig ist und daß auch das, was ich damals wichtig fand, hier inzwischen ganz unwichtig geworden ist, z. B. Thornton Wilder oder was anderes, denn ich habe auch, von der Brooklyn Bridge hatte ich zuerst gehört oder zuerst erfahren durch das Gedicht von Majakowski, für den das in der Zeit, als er hier war und darüber geschrieben hat, eine ungeheure Sache war und durchaus ein Wert. Und deswegen bin ich hier automatisch zur Brooklyn Bridge geschritten irgendwann und habe versucht, darin einen Wert zu entdecken. Aber das ist klar, daß das jetzt nicht mehr stattfindet. Natürlich war aufgrund der amerikanischen Politik gegen die DDR oder gegen die Sowjetunion in den späten 40er und 50er Jahren das zunächst einfach ein feindlicher Block, und da gab es auch gar keinen Grund, sich dafür zu interessieren, wie der im Detail beschaffen ist. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß die Auseinandersetzung sehr […] viel länger dauert, als viele geglaubt haben und auch als ich geglaubt habe wahrscheinlich. Und da wird das natürlich interessant.
[Band III]
Ist es nicht zunächst ganz simpel so, daß durch die amerikanische Politik, also kalter Krieg und so, einerseits die, haben wir schon darüber gesprochen, die USA einfach zu einem feindlichen Block optisch zusammengeschweißt wurden aus unserer Sicht, und andererseits gab es damals nicht nur aus dieser Konfrontation, auch aus inneren Gründen so die Illusion, der Kommunismus findet morgen statt, morgen ist es soweit. Inzwischen hat sich herausgestellt, es dauert etwas länger. Und jetzt wird natürlich ganz wichtig, wie der Hauptgegner zusammengesetzt ist. Das klingt jetzt alles so tagespolitisch, aber daß das wieder befehligt worden ist, dieses Aufkommen von wirklichem Interesse durch Chile. Da war Vietnam, und dann gab es die Versuche, miteinander ins Gespräch zu kommen, auf welcher Basis immer. Und dann gab es den Putsch in Chile, und damit war die Tür wieder zu, also gerade für Intellektuelle in der DDR, das aus vielen Gründen, die auch zum Teil negativ sind, z. B. daß man mit dem Versuch in Chile, da konnte man viele Illusionen investieren, die in der DDR entstanden waren auch im Zusammenhang mit der Dubček-Phase in der ČSSR. Und da war Chile dann so was wie eine Ersatzillusion dafür. Und dann ist die Illusion geplatzt, und das hat man den USA übelgenommen. Mit Recht, aber negativ daran ist, daß man relativ illusionäre Vorstellungen hatte von den Möglichkeiten einer solchen Revolution oder Veränderung in einem Land wie Chile. Deswegen können wir nicht allgemein darüber reden, glaube ich. Man hat nicht erreicht, wirklich eine Massenkultur zu machen, die Kultur, die die Massen erreicht, oder Kunst, die die Massen erreicht, wozu es doch sehr viele Gelegenheiten gab, Möglichkeiten. Uns aus verschiedenen Gründen, über die wir hier nicht unbedingt detailliert reden müssen, ist das nicht zustande gekommen. Und das sind Entwicklungen, die immer wieder abgebrochen worden sind, und da gibt es dann Leerstellen, wo man die Leute einfach unterhalten will. Und bei Unterhaltung bietet sich dann an, einen amerikanischen Film zu kaufen. Es ist nicht einfach so, daß –, mit der zunehmenden Industrialisierung wächst natürlich auch die Abhängigkeit vom Weltmarkt und es wird immer mehr als Problem erkannt, den anderen Charakter, die Differenz zu behaupten und auszuprägen. Und damit wird auch interessanter oder damit wird es notwendig, sich dafür zu interessieren, was denn das andere ist. Man kommt nicht mehr aus mit globalen, pauschalen Urteilen oder Aburteilungen. Die Bundesrepublik oder das Fernsehen der Bundesrepublik […] verwendet nur das oder gibt nur das als Information weiter an die DDR-Zuschauer, von dem sie glauben, daß sie es gebrauchen können unter anderem gegen die DDR. Es gibt aber in diesem Land sehr viel, was die Bundesrepublik nicht gebrauchen kann im Moment, und das ist das Interessante, also was die sich nicht leisten können, wirklich wahrzunehmen und zu analysieren, und das ist für uns das Interessante. Deswegen ist es wichtig, diese Vermittlung zu überspringen und diese Vermittlung auszuschalten, den Informationstransport über die USA durch die Bundesrepublik an die DDR