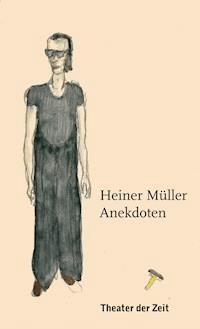9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Krieg ohne Schlacht - Heiner Müllers fesselnde Autobiografie über ein Leben zwischen Ost und West, Kunst und Politik Heiner Müller, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker der Nachkriegsgeschichte, erzählt anekdotenreich, klar und ehrlich aus seinem Leben. Geboren 1929 in Sachsen, wurde er noch kurz vor Kriegsende zum Reichsarbeitsdienst und zum Volkssturm herangezogen und geriet dann in amerikanische Gefangenschaft. Nach wissenschaftlicher und journalistischer Arbeit kam er Ende der 50er-Jahre zum Theater. In seiner Autobiografie Krieg ohne Schlacht spricht Müller offen über seine Auseinandersetzungen mit der allgegenwärtigen Partei- und Staatszensur in der DDR und schildert jene Vorgänge, die 1961, nach der Uraufführung des Stückes »Die Umsiedlerin«, zu seinem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband der DDR führten. Vor allem aber berichtet er eindringlich über seine langjährige Arbeit als Dramatiker und Regisseur, erst am Berliner Ensemble und dann, ab 1976, an der Volksbühne. Die Beschreibung der Theaterarbeit zwischen Ost und West, zwischen künstlerischer Freiheit, politischem Engagement, dem Ausloten von Möglichkeiten und der Erfahrung von Unterdrückung und Repression zeichnen ein anschauliches und genaues Bild des Kultur- und Geisteslebens in den Zeiten der deutschen Teilung und des Kalten Krieges. Ergänzt um bislang unveröffentlichte Dokumente aus dem Nachlass, ist Krieg ohne Schlacht nicht nur eine beeindruckende Lebensgeschichte, sondern vor allem ein unersetzliches zeitgeschichtliches Dokument und ein Klassiker der deutschen Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Heiner Müller
Krieg ohne Schlacht – Leben in zwei Diktaturen
Eine Autobiographie
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Heiner Müller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Heiner Müller
Heiner Müller (1929–1995) gilt als einer der wichtigsten deutschsprachigen Dramatiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Für sein Werk als Dramatiker, Lyriker, Prosa-Autor und Regisseur wurde er mit diversen Literaturpreisen ausgezeichnet, u. a. dem Heinrich-Mann-Preis (1959), dem Georg-Büchner-Preis (1985), dem Nationalpreis der DDR (1986), dem Kleist-Preis (1990) und dem Europäischen Theaterpreis (1991).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Heiner Müller, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker der Nachkriegsgeschichte, erzählt aus seinem Leben. Anekdotenreich, klar und ehrlich: ein faszinierendes Panorama der deutschen Zeit- und Kulturgeschichte.
Geboren 1929 in Sachsen, wurde Heiner Müller noch kurz vor Kriegsende zum Reichsarbeitsdienst und zum Volkssturm herangezogen und geriet dann in amerikanische Gefangenschaft. Er begann wissenschaftlich und journalistisch zu arbeiten, bevor er Ende der 50er Jahre zum Theater kam. In seiner Autobiographie spricht er über seine Auseinandersetzungen mit der allgegenwärtigen Partei und Staatszensur in der DDR und schildert jene Vorgänge, die 1961, nach der Uraufführung des Stückes »Die Umsiedlerin«, zu seinem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband der DDR führten.
Vor allem aber berichtet er über seine langjährige Arbeit als Dramatiker und Regisseur, erst am Berliner Ensemble und dann, ab 1976, an der Volksbühne. Die Beschreibung der Theaterarbeit zwischen Ost und West, zwischen Freiheit, Engagement, dem Ausloten von Möglichkeiten und der Erfahrung von Unterdrückung und Repression zeichnen ein anschauliches und genaues Bild des Kultur- und Geisteslebens in den Zeiten der deutschen Teilung und des kalten Krieges.
Heiner Müllers Lebenserinnerungen haben für Furore gesorgt: für Ablehnung und Kritik, für Bewunderung und Begeisterung. Ergänzt um bislang unveröffentlichte Dokumente aus dem Nachlass, ist »Krieg ohne Schlacht« nicht nur eine beeindruckende Lebensgeschichte, sondern vor allem ein unersetzliches Dokument und ein Klassiker der deutschen Literatur.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Kindheit in Eppendorf und Bräunsdorf, 1929–39
Waren / Müritz, ab 1939
Im Krieg, 1944
Waren nach dem Krieg, 1945–47
Rückkehr nach Sachsen, Frankenberg, 1947–51
Die ersten Jahre in Berlin, seit 1951
Der 17. Juni 1953
»Der Lohndrücker«
Die »Umsiedlerin«-Affäre, 1961
»Philoktet«
»Der BAU«, 1964
»Ödipus Tyrann«, 1966
Die Macht und die Herrlichkeit
Brecht
»Horizonte« / »Waldstück«, 1968
Theaterarbeit in Ostberlin, die siebziger Jahre
Ernst Jünger
USA
Schreiben und Moral
»Die Hamletmaschine«, 1977
»Der Auftrag«, 1980
Sowjetunion, Ostblock
Frankreich usw.
»Fatzer-Material«, 1978, und »Quartett«, 1981
»Verkommenes Ufer«
»Anatomie Titus Fall Of Rome«
Robert Wilson / Freunde
Kino, Bildende Kunst, Musik
»Wolokolamsker Chaussee«, 1985–1987
Erinnerung an einen Staat
Dokumente
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
NICHT FÜR »EISENBAHNER«
Dokument 4
GESPRÄCHE ÜBER LITERATUR
Dokument 5
Dokument 6
AUS DEN STELLUNGNAHMEN DER STUDENTEN ZU »UMSIEDLERIN«
Dokument 7
BRIEF DES BERLINER ENSEMBLES AN DAS KULTURMINISTERIUM
Dokument 8
STELLUNGNAHME DES SEKRETARIATS DES SCHRIFTSTELLERVERBANDES
Dokument 9
Dokument 10
PROTOKOLL DER SITZUNG DES GESCHÄFTSFÜHRENDEN VORSTANDES DES DEUTSCHEN SCHRIFTSTELLERVERBANDES VOM 30. 10. 1961
Dokument 11
Dokument 12
SELBSTKRITIK HEINER MÜLLERS
Dokument 13
Dokument 14
FRANZ FÜHMANN: BEMERKUNGEN ZU HEINER MÜLLERS VOLKSSTÜCK »DIE UMSIEDLERIN ODER DAS LEBEN AUF DEM LANDE«
Dokument 15
Dokument 16
BIERMANN-RESOLUTION
Dokument 17
DISKUSSIONSBEITRAG AUF DER »BERLINER BEGEGNUNG« VOM 13. UND 14. DEZEMBER 1981
Dokument 18
REDE WÄHREND DES INTERNATIONALEN SCHRIFTSTELLERGESPRÄCHS »BERLIN – EIN ORT FÜR DEN FRIEDEN«
Dokument 19
Dokument 20
PLÄDOYER FÜR DEN WIDERSPRUCH
Dokument 21
ANMERKUNGEN ZU »KRIEG OHNE SCHLACHT« VON B. K. TRAGELEHN
Dossier zur erweiterten Ausgabe
Dossier von Dokumenten des Misteriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR und weitere Materialien
Einleitung zum Dossier-Teil
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4/a
Dossier 4/b
Dossier 4/c
Dossier 4/d
Dossier 4/e
Dossier 4/f
Dossier 4/g
Dossier 4/h
Dossier 4/i
Dossier 4/k
Dossier 4/l
Das Müller-Phantom
»Es gibt ein Menschenrecht auf Feigheit«
Aus dem Nachlaß
[Vorwort zu KRIEG OHNE SCHLACHT]
KRIEG OHNE SCHLACHT LEBEN IN ZWEI DIKTATUREN
[Gegenüberstellung früherer Textstufen, korrespondierend mit dem späteren Kapitel »Die Macht und die Herrlichkeit«]
Anhang
Editorische Notiz
Bibliographische Notizen
Aus dem Nachlaß
Soll ich von mir reden Ich wer von wem ist die Rede wenn von mir die Rede geht Ich wer ist das
Kindheit in Eppendorf und Bräunsdorf, 1929–39
Ich war eine schwere Geburt. Sie hat lange gedauert, von früh bis neun Uhr abends. 9. Januar 1929.
Mein Vater ist in Bräunsdorf geboren. Das ist ein Dorf in der Nähe von Limbach-Oberfrohna. Limbach und Oberfrohna sind zwei zusammenhängende kleine Städte, westlich von Chemnitz, hauptsächlich mit Textilindustrie. Der Vater meines Vaters war Strumpfwirkermeister in einer Textilfabrik, Arbeiteraristokratie, von der Mentalität her sehr nationalistisch. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg. Darüber hat er nie gesprochen. Dann war er in irgendeinem patriotischen Turnverein.
Die Mutter meines Vaters stammte aus Bayern und hatte in Bräunsdorf auf einem Gut gearbeitet, als Magd. Es gab ein großes Gut in Bräunsdorf, Großgrundbesitz, das sogenannte Rittergut. Mein Vater erzählte eine Geschichte: Als er aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam, hat seine Frau ihn gefragt, ob er Weiber gehabt oder Kinder gemacht hätte. Später gestand er den erwachsenen Söhnen, er hätte damals, als er die Frage mit »Nein« beantwortet hat, den einzigen Meineid seines Lebens geschworen. Er hatte auf die Bibel schwören müssen. Da wurde dann nicht mehr gefragt.
Meine Mutter ist in Eppendorf geboren. Die Mutter meiner Mutter war die Tochter eines reichen Bauern aus einem Dorf weiter oben im Erzgebirge. Die Familie war sehr verzweigt, Bauern, sehr reich, berühmt als Brandstifter. Sie haben aus Versicherungsgründen einander die Höfe angezündet, wahrscheinlich auch aus Haß. Es gab Geschichten von Selbstmorden, Aufhängen auf dem Dachboden – Bauernselbstmorde. Dagegen war der Vater meiner Mutter unterste soziale Schicht, sein Vater früh gestorben, seine Mutter Näherin. Davon ernährte sie die Kinder. Irgendwann ist sie krank geworden, erblindet bei der Arbeit. Mein Großvater, damals dreizehn Jahre alt, hat sie gepflegt. Die Familie der Großmutter konnte ihn nicht akzeptieren, die Großmutter wurde enterbt. Meine Mutter erzählt die Geschichte vom Salzhering[1]: Ein Hering wird an der Stubendecke aufgehängt, und alle dürfen daran lecken. Armut war ihre Grunderfahrung, Armut bis zum Hunger, besonders im Ersten Weltkrieg. Mein Vater fiel in der Schule durch Intelligenz auf, durch Interesse für Lesen und Schreiben. Deshalb die Empfehlung der Lehrer: Der gehört nicht in die Fabrik, sondern in irgendeine behördliche Schreibstube. Er fing als Lehrling im Rathaus der Gemeinde Bräunsdorf an, lebte dann in Hohenstein-Ernstthal, dem Geburtsort von Karl May. Er wohnte möbliert bei einer Beamtenwitwe, die versucht hat, ihm Tischmanieren beizubringen. Er wußte einfach nicht, daß man Erbsen nicht mit dem Messer ißt. Schließlich wurde er versetzt und arbeitete in Eppendorf im Rathaus. Eppendorf war ein Industriedorf. Dort hat er meine Mutter kennengelernt. Ich glaube, meine Mutter war vor mir schon einmal schwanger. Aber sie hatten kein Geld und keine Wohnung.
Eine Geschichte aus Eppendorf: Es gab dort ein Schwimmbad, sehr gut gebaut, mit Sprungturm und allem. Es war von Krediten bezahlt worden, die als Vorschuß auf das Morgensternsche Erbe gegeben wurden. Das Morgensternsche Erbe war eine große erzgebirgische Massenphantasie, ausgelöst durch ein Gerücht. In den zwanziger Jahren soll in den USA ein Millionär namens Morgenstern gestorben sein und, weil er aus dem Erzgebirge stammte, erzgebirgische Gemeinden zu seinen Haupterben eingesetzt haben. In Erwartung dieses Morgensternschen Erbes, das nie kam, ist viel gebaut worden. Es gab Wachen auf Kirchtürmen in Erwartung des großen Geldtransports. Die Geschichte meines Großvaters, des Vaters meiner Mutter, habe ich aufgeschrieben[2], später erst die meines Vaters.
Wie verhalten sich diese Texte zur »Wirklichkeit«?
Wie Literatur. Als ich das erste Mal in den USA war, sah ich auf dem Flug von New York nach Dallas / Texas beim Überfliegen eines größeren Sees einen Ölfleck auf dem Wasser, und mir fiel zum ersten Mal wieder dieser Großvater ein, den ich im Schlußteil der Geschichte abgeurteilt habe. Könnte man in ein Gespräch mit Toten kommen, mit ihm würde ich gern reden, auch mit meinem Vater. Oder die Texte noch einmal schreiben, anders, wenn dafür die Zeit ist.
Dieser Großvater war sozialdemokratisch erzogen, er war Sozialdemokrat auf eine ganz unintellektuelle Weise. Seine Frau ging, je älter sie wurde, immer öfter in die Kirche, sie brauchte das. Er kam nie mit. Er sagte nur, wenn du das brauchst, geh hin. Ich war in den Ferien oft bei ihm. Er hatte noch alte Jahrgänge sozialdemokratischer Zeitschriften vom Anfang des Jahrhunderts. Das war mein Hauptlesestoff mit zehn, zwölf, dreizehn Jahren. Es gab da Texte von Gorki, Romain Rolland, Barbusse, Diskussionen und Leserbriefe. Durch einige Hefte ging zum Beispiel eine Nietzsche-Diskussion unter sozialdemokratischen Arbeitern, die »Zarathustra« gelesen hatten.
Wenn ich meinen Text über ihn jetzt lese, dann ist der natürlich aus meiner Identifikation mit der neuen Ordnung geschrieben, die Askese brauchte, Opfer brauchte, damit sie funktionieren konnte. Und das ist das Grundproblem: Die Opfer sind gebracht worden, aber sie haben sich nicht gelohnt. Es ist nur Lebenszeit verbraucht worden. Diese Generationen sind um ihr Leben betrogen worden, um die Erfüllung ihrer Wünsche. Für ein Ziel, das illusionär war. Eigentlich habe ich diese Geschichte über den Großvater mit einer Funktionärshaltung geschrieben und deswegen jetzt das Bedürfnis nach einem Gespräch mit ihm, um mich dafür zu entschuldigen. Es gibt ein Foto von den beiden Alten, wie sie dasitzen, Leute, die schwer gearbeitet haben, die Hände auf den Knien. Er war still und bescheiden, nie hat er Heil Hitler gesagt, weder auf der Straße noch sonstwo. Er war unauffällig, man kannte ihn im Dorf. Er trank gern Baldrian, Schnaps war zu teuer. Er hatte immer eine Flasche davon bei sich. Oft ging er mit mir Pilze suchen. Die waren ein Hauptnahrungsmittel, sie kosteten nichts. Einmal hatte ich einen wilden Streit mit ihm. Wir suchten Pilze in der Nähe von Augustusburg, immer zu Fuß. In Augustusburg gab es eine Drahtseilbahn zur Burg. Mich interessierte natürlich die Drahtseilbahn, ich wollte damit fahren. Er hatte kein Geld, aber das hat er mir nicht gesagt, nur, wie unmännlich das wäre, mit der Bahn zu fahren. Er blähte das zu einem großen moralischen Problem auf, und wir haben uns darüber sehr gestritten. Er hatte kein Geld und konnte das nicht zugeben, deswegen mußte er daraus eine Ehrensache machen. Dann sind wir gelaufen. Es dauerte ziemlich lange. Ich erinnere mich an einen andern Streit, als er mir erzählte, der Bauer auf dem Hof über dem Hang hätte das »Männel«, und ich glaubte nicht daran. Das Männel ist ein Diminutiv von Mann, ein Kobold, ein dienstbarer Geist, mein Großvater hatte es aus dem Schornstein fahren sehen, zwischen Mitternacht und ein Uhr früh. Davon war er nicht abzubringen. Das Männel war eine Waffe im Konkurrenzkampf der Bauern, es konnte die Kühe des Nachbarn verhexen und die Milchproduktion der eigenen steigern. Eine große Rolle spielte im Erzgebirge auch das fünfte Buch Moses. Es gab Leute, von denen wußte man, sie haben das fünfte Buch Moses und können hexen. In Bräunsdorf war eine Bäuerin im Kuhstall eines Nachbarn entdeckt worden, in der Hand das ominöse Buch. Verhexte Kühe geben schlechte Milch oder krepieren.
Was sind Deine allerersten Erinnerungen?
Die erste ist ein Gang auf den Friedhof mit meiner Großmutter. Da stand ein Denkmal für Gefallene des Ersten Weltkriegs, aus Porphyr, eine gewaltige Figur, eine Mutter. Für mich verband sich das Kriegerdenkmal jahrelang mit einem lila Mutterbild, mit Angst besetzt, auch vor der Großmutter vielleicht, die mich über den Friedhof führte.
Die zweite Erinnerung: Meine Eltern waren krank, ich auch. Wir lagen alle drei im Bett. Es kam regelmäßig eine Krankenschwester, wahrscheinlich von einer kirchlichen Organisation, und einmal brachte sie Erdbeeren mit. Diese Erdbeeren sind mein erstes Glückserlebnis.
Dann die Verhaftung meines Vaters, 1933, und im wesentlichen war das schon so, wie ich es aufgeschrieben habe.[3] Ich hatte ein kleines Extrazimmer, lag da im Bett, es war morgens, ziemlich früh, fünf, sechs Uhr. Ich wurde wach, Stimmen und Gepolter nebenan. Sie schmissen Bücher auf den Boden, säuberten die Bibliothek von linker Literatur. Ich sah durchs Schlüsselloch, daß sie meinen Vater schlugen. Sie waren in SA-Uniformen, meine Mutter stand daneben. Ich habe mich wieder ins Bett gelegt und die Augen zugemacht. Dann standen sie in der Tür. Ich sah blinzelnd nur den Schatten der beiden etwas kräftigeren SA-Männer, dazwischen klein den Schatten meines Vaters, und habe mich schlafend gestellt, auch als mein Vater meinen Namen rief. Der Grund der frühen Verhaftung: Mein Vater war nicht mehr in der SPD, sondern in der SAP. Willy Brandt war da, glaube ich, eine führende Figur und Jacob Walcher. Die SAP-Leute waren besonders verdächtig, noch keine Kommunisten, aber auch keine Sozialdemokraten mehr. Das wiederholte sich nach 1945. Ich weiß, daß mein Vater einen Revolver hatte und daß er und ein paar andere sich auf einen bewaffneten Kampf vorbereiteten. Einer seiner Genossen war ein Lehrer, für mich sehr wichtig, weil er mit mir geübt hat, rechts zu schreiben. Ich war Linkshänder, und das wäre in der Schule ein Problem geworden. Das muß vor 1933 gewesen sein, denn er wurde mit meinem Vater verhaftet. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er hatte mir rechts schreiben im Spiel beigebracht, ohne irgendwelchen Zwang, das war sehr schön. Er hatte eine große Liebe zu Kindern. Dieser Lehrer war ein etwas weicherer Typ als mein Vater, und sie haben ihn so lange geprügelt, bis er verriet, daß mein Vater einen Revolver hatte, der im Wald vergraben war. Meine Mutter war nach der Verhaftung zusammen mit einem Schwager in den Wald gegangen, dort haben sie den Revolver vergraben, schön geölt und eingewickelt. Das wußte der Lehrer und verriet es, aber er kannte die Stelle nicht. Daraufhin haben sie auch meine Mutter verhaftet und für kurze Zeit im Rathaus in den Keller gesperrt, weil sie von dem Revolver nichts sagen wollte. Dann gab es am nächsten Tag, nach der Nacht im Keller, eine Gegenüberstellung mit dem Lehrer. Er hat sich entschuldigt: »Die haben mich geschlagen, ich konnte nicht mehr, ich habe es verraten.« Meine Mutter mußte mit ihrem Schwager in SA-Begleitung in den Wald und das Ding ausgraben. Ich muß noch sagen, es kannten sich alle. Einer von den SA-Leuten bei der Verhaftung meines Vaters war ein ehemaliger Verehrer von ihr, den sie abgewiesen hatte.
Du erwähnst in Deiner Erzählung auch einen Besuch im KZ.
Später haben wir meinen Vater im KZ besucht. Es war eine merkwürdig kahle Landschaft, und auf dem Plateau das Lager. Wir mußten durch das Drahtgittertor mit meinem Vater reden, er sah sehr schmal und klein aus. Ich habe ihm Bilder gezeigt, die ich gemalt und gezeichnet hatte, und Zigarettenbilder. Meine Mutter kam gar nicht dazu, mit ihm zu sprechen. Sie hat mir erzählt, daß ich danach im Schlaf geredet habe: »Spring doch über den Zaun!« Ich konnte nicht verstehen, daß er drin bleibt. Er hat mir ein paar Geschichten erzählt. Die erste Aktion bestand darin, daß den Häftlingen die Haare geschnitten wurden. Autobahnschneiden nannten sie das, quer über den Kopf, so daß sie Verbrecherfotos machen konnten. Die erschienen dann in der lokalen Presse, die Verbrechergesichter der Linken mit Texten dazu: »Das sind die Bolschewisten, die euren Kindern die Milch und euch eure Frauen wegnehmen wollen.« So in der Art. Beim Appell blieb der Kommandant, ein SA-Führer, bei meinem Vater stehen. Mein Vater hatte einen etwas gelblichen Teint und schwarze Haare. Der Kommandant fragte: »Jude?« Mein Vater antwortete: »Nein, nicht daß ich wüßte.« – »Dann hat sich deine Mutter von Juden ficken lassen.« Die Mutter meines Vaters war eine glühende Nationalsozialistin und verehrte Hitler: Er rauchte nicht und aß kein Fleisch und hatte keine Weibergeschichten. Es gab da einmal eine Schwiegertochter, die rauchte, sehr viel später. Die hatte es nicht leicht. »Die deutsche Frau raucht nicht« war eine Nazi-Parole.
Wie lange war Dein Vater in Haft?
Sie entließen meinen Vater nach einem Jahr, oder auch schon nach einem Dreivierteljahr. Die Bedingung war, daß er nicht zurückgeht nach Eppendorf, sondern in einen anderen Kreis zieht. Und deshalb zogen wir dann um in das Haus seiner Eltern in Bräunsdorf. Die Geschichte von dem Appell hat er natürlich seiner Mutter erzählt, mit großer Schadenfreude. Sie war tief empört und trat einen großen Beschwerdegang an, durch alle Instanzen bis nach Chemnitz, und erreichte tatsächlich, daß dieser Kommandant sich bei ihr, einer deutschen Mutter, entschuldigen mußte.
Sie war eine sehr deutsche Mutter, weil sie viele Kinder hatte, vor allem Söhne. Einer war durch eine Diphtherie taubstumm geworden. Dieser Sohn war, neben meinem Vater, der einzige Nichtnazi in der Familie. Er malte und versuchte, seine Familie davon zu ernähren, was eine Tragödie war, weil er zu diesem Zweck eben Kitsch malen mußte. Motive für Bauern, Sonnenuntergänge, Schiffe mit Sonnenuntergang, Alpenlandschaften, trinkende Mönche. Interessant waren seine Zeichnungen, also das, was er nicht für den Verkauf machte. Er hat bis zuletzt davon gelebt, daß er solche Schinken serienweise herstellte. Aber die Zeichnungen waren das Eigentliche. Er war taubstumm, aber man konnte sich mit ihm über Laute verständigen. Später in Berlin besuchte er mich öfter. Er hatte einen Kunsthändler in Köpenick, der ihm jeden Monat ein Quantum Sonnenuntergänge abkaufte. Er kassierte das Geld, und dann kam er zu mir. Einmal klingelte er, da wohnte ich schon in Pankow, und sagte »Ub Schei«. Ich war schon so trainiert, daß ich wußte, er sagt »Ulbricht Scheiße«. Die Laute waren zu verstehen. Schreiben konnte er natürlich auch. Er rauchte wie ein Schlot, hatte Liebesgeschichten mit anderen jüngeren taubstummen Damen, seine Frau war auch taubstumm. Er hatte eine Geliebte in Chemnitz, anderswo andere. Er erzählte mir oft davon, zeigte mir Fotos von den Frauen. Später bekam er ein Raucherbein, das amputiert wurde. Er ist schrecklich gestorben. Er lag lange im Krankenhaus, konnte sich nicht verständigen. Schließlich haben sie ihm das zweite Bein auch noch amputiert, aber er starb nicht. Die Ärzte hatten gehofft, daß sein Herz aussetzt, aber er hatte ein sehr starkes Herz, er hat, glaube ich, sechs Wochen gelegen, voll amputiert, ohne die Möglichkeit, mit jemandem zu reden.
Was hat Dein Vater nach der Entlassung gemacht?
Mein Vater war nach der Entlassung arbeitslos und hat, weil er über Verwaltungsangelegenheiten und Umgang mit Behörden Bescheid wußte, für Geld oder Lebensmittel Bauern beraten, die irgendwelche Amtsprobleme lösen mußten. Nebenbei machte er noch ein juristisches Selbststudium, was wiederum sehr viel später, nach dem Krieg, dazu führte, daß er Generalstaatsanwalt von Mecklenburg-Vorpommern werden sollte. Jedenfalls, er war zu Hause. Ich erinnere mich, ich habe versucht, mitzustudieren. Ein Wort war mir immer aufgefallen, das Wort Erblasser. Ich habe erst zehn Jahre später begriffen, daß es Erb-Lasser heißt. Meine Mutter arbeitete in einem Betrieb in Limbach als Näherin, fuhr jeden Morgen mit dem Fahrrad hin und abends zurück. 1936 dann oder schon Ende 1935 gab es in der Schule zum Beginn des Autobahnbaus das Aufsatzthema »Die Straßen des Führers«. Man sagte uns, daß die besten Aufsätze prämiert würden. Ich kam nach Hause und erzählte das meinem Vater. »Dafür mußt du keine Prämie kriegen, kümmere dich nicht darum«, dann hat er das Essen gemacht. Wir aßen, und auf einmal sagte er: »Ich helfe dir, den Aufsatz zu schreiben.« Ein Satz, den er mir diktierte, lautete: »Es ist gut, daß der Führer die Autobahnen baut, dann bekommt vielleicht auch mein Vater wieder Arbeit, der so lange feiern mußte.« Dieser Satz löste bei mir den Verratsschock aus. Ich war so erzogen, daß ich wußte, draußen ist der Feind, die Nazis sind der Feind, die ganze äußere Welt ist feindlich. Zu Hause sind wir eine Festung und halten zusammen. Plötzlich war da dieser Riß. Der Aufsatz wurde prämiert, mein Vater bekam Arbeit bei der Autobahn. Er war aber nur ein halbes Jahr dort, hielt das Schaufeln nicht aus.
Welche Erinnerungen hast Du an Eppendorf?
In Eppendorf hatte ich einen Spielkameraden, Sohn eines Fabrikanten. Die Fabrik lag gegenüber unsrer Wohnung, und wir wohnten zunächst in einem Haus, das zur Fabrik gehörte.
Nach der Verhaftung meines Vaters hatte meine Mutter kein Geld, das Essen war knapp, es gab ein Angebot von diesem Fabrikanten, ich könne dort jeden Tag mitessen. Natürlich hatte ich Hunger, aber gleichzeitig war es eine ungeheure Erniedrigung, dort am Tisch zu sitzen, sich durchfüttern zu lassen. Da ist auch ein Haßpotential entstanden, ein Rachebedürfnis. Dieser Fabrikant war Sozialdemokrat gewesen, der Freitisch war gut gemeint, aber für mich doch eine schlimme Erfahrung.
Als mein Vater im KZ war, gab es ein paar Freunde, Söhne von Beamten, die sagten mir, daß sie nicht mehr mit mir spielen dürften, weil mein Vater ein Verbrecher wäre. Auch diese Erfahrung eine wichtige Voraussetzung für vieles Spätere. Immer war ich isoliert, von der Außenwelt getrennt durch mindestens eine Sichtblende. Ich fand dann doch ein paar Freunde. In Bräunsdorf gab es eine Kinderbande. Ich hatte aber immer Schwierigkeiten, anerkannt zu werden. Zum Beispiel konnte ich keine Schleife binden. Dafür lachten mich die Mädchen aus. Für die Bande war ich ein Spinner, weil ich ein Taschentuch benutzte statt zwei Finger, und daraus ergaben sich Geschichten wie die mit dem Schwalbennest. Es ging darum, ein Schwalbennest in einem Kuhstall mit Steinwürfen zu zerstören. Um anerkannt zu werden, habe ich besonders scharf geschossen, und ich traf auch. Und dann sah ich die jungen Schwalben am Boden liegen. Der Bauer hat uns aus dem Kuhstall gejagt. Er hatte zwei schwachsinnige Söhne, die in sechs Schuljahren weder Lesen noch Schreiben gelernt hatten. Sie waren Rivalen um den Hof, das Erbe. Sie prügelten sich regelmäßig, manchmal mit Sensen. Der Alte ging mit dem Dreschflegel dazwischen und schlug sie nieder. Der jüngere Sohn hetzte oft den Hund hinter uns her. Einmal sperrte er uns im Hof ein und ließ die Pferde heraus. Die Pferde galoppierten durch den Hof, wir standen an die Wände gepreßt, alle Türen zu. Wir haben Rekorde aufgestellt im Wegrennen vor dem Hund.
Welche Auswirkungen hatte die lange Arbeitslosigkeit Deines Vaters?
Das war ganz günstig für mich, weil er über alles mit mir sprach und den ganzen Tag für mich Zeit hatte. Er besaß auch literarischen Ehrgeiz; es gibt Texte von ihm. Er machte Resümees von seiner Lektüre, auch viele Exzerpte, und las Philosophie. Das Bedürfnis, alles zu wissen, alles zu kennen, war sehr ausgeprägt bei ihm, und ich war sein einziger Gesprächspartner.
Waren / Müritz, ab 1939
Nach Mecklenburg sind wir gegangen, weil mein Vater da eine Arbeit bekommen hat. Er hatte immer Annoncen, Stellenangebote gelesen. 1938 kam ein Stellenangebot von einer Landkrankenkasse in Waren. Sie suchten einen Betriebsprüfer. Die Arbeit bestand darin, auf den Gütern der Großgrundbesitzer die sozialen Belange zu überprüfen und die Beiträge zu kassieren. Die Großgrundbesitzer hatten hauptsächlich Saisonarbeiter, polnische meistens. Das waren wüste Verhältnisse, noch 1938/39. Es gab Baracken für die polnischen »Schnitter«. Die meisten Familien hatten nur ein Gefäß, zum Scheißen, zum Kochen, zum Waschen.
Mecklenburg war für uns als Sachsen wie eine Emigration. Man war Ausländer. Waren war eine kleine Stadt, vielleicht 50 000 Einwohner, ein Luftkurort für Berliner. Ich war völlig isoliert, vor allem in der Schule. Ausländer wurden aus Prinzip verprügelt. Da mußte man immer ziemlich schnell sein. Ich konnte sehr gut laufen.
Die Schule in Bräunsdorf war eigentlich ganz human gewesen. Der Klassenlehrer war gleichzeitig HJ-Führer. Das war das einzige Problem. Für den war ich natürlich der Sohn eines Staatsfeindes. Er war nicht unanständig, aber ich merkte die Spannung. Bei den Kindern in der Schule nicht, nicht in Bräunsdorf.
Einmal trug uns der HJ-Lehrer ein Gedicht über einen Lehrer vor. Die letzte Zeile hieß: »Wenn der Lehrer Bocksturz macht.« Bocksturz ist ein Überschlag. Die Zeile habe ich behalten, weil der Lehrer danach umfiel und nicht wieder aufstand. Wir haben uns eine Weile gewundert und gelacht, aber der stand nicht wieder auf. Es wurde ein Arzt geholt. Es stellte sich heraus, daß er eine Krankheit hatte, Asthma oder Epilepsie. Das widersprach dem Bild von einem HJ-Führer schon sehr.
Der Ärger fing in Mecklenburg an. Diese Schule war eine völlig andere Erfahrung. Dreißig Kinder in der Klasse oder mehr. Der Weg zur Schule war gefährlich, auch der Heimweg, weil irgendwelche Mecklenburger auf Ausländerjagd gingen. Auf dem Schulhof haben die Lehrer meistens die großen Schlägereien unterbunden. Ich war der einzige Ausländer in der Klasse. Danach ging ich auf die Mittelschule, weil die billiger als das Gymnasium war. Es mußte ja Schulgeld bezahlt werden. In der Mittelschule gab es zwei alte Lehrerinnen, an die ich mich erinnere, alte Jungfern, sie lebten auch zusammen, zwei würdige alte Damen. Bei denen habe ich mir Bücher ausgeliehen. Sie hatten eine große Bibliothek. Ich war ein guter Schüler und ein sanftes Kind; die beiden Alten liebten mich sehr. 1945 haben sie sich umgebracht, nachdem sie von Russen vergewaltigt worden waren. Sie sind zusammen in den See gegangen.
Von der Mittelschule kam ich auf die Oberschule. Ich kriegte eine Freistelle wegen guter Zensuren. Meine Eltern hätten das Schulgeld nicht bezahlen können. Allerdings war ich dadurch auch ausgeliefert. Ich mußte mich gut verhalten. Ich hatte immer das Gefühl, die Lehrer wüßten, daß ich nicht dazugehöre; wahrscheinlich war es auch so. Da war der Klassenlehrer, der ab und zu in Uniform erschien. Er erklärte uns den Kommunismus: »Kommunismus ist, wenn man an einem Fleischladen vorbeigeht, in dem eine Wurst hängt, und schlägt die Scheibe ein und holt die Wurst heraus. Das ist Kommunismus.« Einige fragten nach den Juden, denn es gab natürlich Juden in Waren. Denen waren entsprechend seiner Kommunismusdefinition in der Kristallnacht die Scheiben eingeschlagen worden. Da hat er uns dann erklärt, daß mit den Juden jetzt aufgeräumt wird und daß man als Deutscher mit Juden eben nichts zu tun haben darf. Der Widerspruch blieb aber. Fotos im Geschichtsbuch zeigten den Posträuber Dschugaschwili und den Juden Bronstein, der angeblich in Berlin als Schuhputzer gearbeitet hatte.
In der Oberschule stand ich, weil ich Freud gelesen hatte, im Ruf eines Casanova und wurde bei sexuellen Problemen zu Rate gezogen. Dabei hatte ich selbst überhaupt keine Erfahrung. Aber ich habe den Casanova gut gespielt.
Ich war in der HJ, das war unvermeidlich, wegen der Freistelle. Meine Mutter erzählt, daß ein Lehrer sie zur Rede stellte, weil ich nicht in der HJ beziehungsweise im Jungvolk war. Sie sagte: »Das ist mein Sohn, und das bestimme ich.« Aber dann wurde die Freistelle in der Schule davon abhängig gemacht.
In der HJ sein, das hieß Marschieren, Singen. Man mußte in der Lage sein, ein Lagerfeuer zu machen, einen Topf Wasser zum Kochen zu bringen, und es gab Geländemärsche mit Gepäck. Geschossen wurde noch nicht. Die Geländespiele waren die Hauptsache, auch das Attraktivste für die meisten. Man hatte einen sogenannten Lebensknüppel, und die Aufgabe war, dem Gegner seinen Lebensknüppel zu entreißen, dann war der tot. Der Höhepunkt des Geländespiels war die Schlägerei um die Knüppel. Ich hatte irgendwann eine einfache Technik entwickelt und mir den größten, stärksten Gegner ausgesucht, der mir schnell meinen Lebensknüppel wegnahm. Dann war ich draußen. Die Toten durften dann zusehn, wie die andern sich weiter prügelten. Ich kann mich nicht erinnern, daß mir das Spaß gemacht hätte. Zu Hause wurde über alles oppositionell geredet, und in der Schule durfte man nicht sagen, was man zu Hause hörte und sprach. Andererseits ging von den Nazi-Ritualen eine Faszination aus. Die Liedzeile: »Wir werden weitermarschieren, wenn alles in Scherben fällt« jagte mir Schauer über den Rücken. Mein Vater brachte mir zur gleichen Zeit die »Internationale« bei: »… und heilig die letzte Schlacht.« Das ging zusammen.
Einer meiner Banknachbarn in der Oberschule war ein Adliger aus Ostpreußen, die Familie war evakuiert worden. Manchmal schrieb er mir fromme Verse auf. Zum Beispiel: »Frage nicht, warum, Gottes Mund bleibt stumm, doch lernst schweigen du, sagt dir Gott, wozu.« Sein Vater war Offizier. Sechs Jahre war ich ziemlich befreundet mit ihm. Einmal kam er auch mit zu mir nach Hause. Ich hatte gerade angefangen, Rilke zu entdecken, und las ihm Rilke-Gedichte vor. Er hat sich krummgelacht darüber. Da habe ich dann mitgelacht.
Wie erging es Deinem Vater in dieser Zeit?
1940 wurde mein Vater noch einmal verhaftet, weil er in seinem Betrieb, in der Krankenkasse, aus »Mein Kampf« vorgelesen hatte, was Hitler über den Bolschewismus geschrieben hat, am Tag des Nichtangriffspakts. Er war zwei Wochen in Untersuchungshaft. Er konnte sich herausreden, aber es gab wieder eine Hausdurchsuchung, die Bibliothek wurde wieder dezimiert. Bei dieser Verhaftung war ich nicht dabei. Er ist, glaube ich, im Betrieb, in der Krankenkasse, verhaftet worden.
Was bedeuteten Dir damals als Junge Bücher?
Mein Vater hatte eine Prachtausgabe von Casanovas Memoiren, mit schwülen Illustrationen in Vierfarbdruck. Das war natürlich eine Lieblingslektüre von mir. Aber er fand das doch verderblich oder zu früh für mich. Jedenfalls tauschte er den Casanova mit einem Kollegen gegen eine Schiller-, Hebbel- und Körner-Ausgabe ein. An der Stelle, wo Casanova gestanden hatte, fand ich nun Schiller, Hebbel und Körner. Ich habe den ganzen Schiller gelesen, die Stücke jedenfalls, von Hebbel auch alle Stücke. Und von da an wollte ich Stücke schreiben. Die Schule konnte mir die Klassiker nicht mehr verderben, weil ich sie schon kannte. Ich habe damals sehr viele Reclam-Bücher gelesen, weil das die billigsten waren. Mein Vater hatte sehr viele und kaufte ständig dazu. So habe ich mit zwölf, dreizehn Erzählungen von Edgar Allan Poe gelesen. Auch »Die Abenteuer Gordon Pyms« standen im Regal, doch das hatte mein Vater weggenommen wegen der Kannibalismus-Szene. Deswegen habe ich es natürlich mit besonderem Eifer gelesen. Es war ein unvergeßlicher Eindruck, besonders der abgebrochene Schluß mit der Gestalt aus Schnee.
Was waren Deine ersten eigenen literarischen Versuche?
Ab zehn ungefähr fing ich an zu schreiben, zuerst Balladen. Das ging aus von einer Reclam-Anthologie von deutschen Balladen zum Beispiel. »Die Hunnen jauchzten auf blutiger Wal. Die Geier stießen herab zu Tal.« Die Hunnen interessierten mich wegen der Nibelungen. Dann fing ich an, Stücke zu schreiben.
Das alles ist beschlagnahmt worden, wie alles beschriebene Papier, bei der Hausdurchsuchung nach der Flucht meines Vaters 1951 aus der DDR.
Die Rilke-Phase hat sich merkwürdigerweise nicht ausgewirkt. Ich habe das gern gelesen, später auch Stefan George, aber nie versucht, so etwas zu machen. Vielleicht wegen des Schocks mit dem Gelächter über Rilke.
In Mecklenburg hatte mein Vater kaum noch Zeit für Bücher oder mich. Es gab aber einen Deutschlehrer an der Oberschule, der mir Bücher borgte. Im Unterricht las er uns Trakl vor: »Und nächtens stürzen sie aus roten Schauern / Des Sternenwinds gleich rasenden Mänaden«. Einmal hatte er ein Problem. Ich wollte die »Gespenstersonate« von Strindberg lesen, und das wollte er mir nicht geben. Später erfuhr ich, daß er einen Mitschüler, der auch Bücher bei ihm borgte, vor mir gewarnt hat. »Hüten Sie sich vor diesem Menschen.« Damals hatte ich gerade angefangen, Bücher über Psychologie und Psychoanalyse zu lesen. Mit fünfzehn, sechzehn dann auch Literatur über Hypnose. Und dieser Mitschüler war mein bestes Medium. Mein größter Erfolg als Hypnotiseur war eine Gemeinheit: Mir gefiel ein Mädchen, in das er verliebt war, in aller Unschuld, glaube ich. Ich habe ihn per Hypnose dazu gebracht, sich von ihr zu trennen. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Denn es stellte sich – ich schnürte da um sie herum – schließlich heraus, daß sie zwei Brüder hatte, und diese Brüder waren Schmiedegesellen.
Im Krieg, 1944
Meine Schule wurde geschlossen. Das war wahrscheinlich im Herbst 1944. Wir wurden alle eingezogen. Zum Teil als Flakhelfer, zum Teil zum Arbeitsdienst. Es wurden auch für die SS Leute gesucht, aber Freiwillige zunächst. Das war eigentlich die Hauptangst, daß man zur SS kam, nicht nur bei mir, diese Angst hatten viele. Ich erinnere mich ganz dumpf an die Musterung. Da wollte keiner hin. Wir waren fünfzehn. Die ganze Klasse wurde eingezogen, aber zerstreut, es kamen nie zwei oder drei zusammen irgendwohin. Ich mußte zum Reichsarbeitsdienst. Vor der Einberufung gab es eine Werwolfausbildung, eine Art Guerilla-Ausbildung. Aber ich habe das verdrängt, ich weiß nichts mehr davon. Das fand wohl in Waren statt, noch in der Schulzeit, glaube ich, eine Vorbereitung auf den Volkssturm. Man lernte mit der Panzerfaust umgehen, schießen, sich im Wald bewegen usw. Ich konnte nicht gut schießen, das war mein Glück. Ich sah schlecht ohne Brille. Schon seit Jahren hatte ich an der Tafel nichts mehr lesen können. Das war meine Rettung beim Reichsarbeitsdienst. Reichsarbeitsdienst, das hatte nichts mehr mit Arbeit zu tun. Das Wichtigste war Schießen. Der Ausbilder war ziemlich jung, Mitte Zwanzig, ein idealistischer Nazi, ein integrer Mann. Der teilte uns ein in Männer und Idioten, nach den Schießergebnissen. Ich war Idiot, und die Idioten interessierten ihn nicht weiter. Die Männer hat er geschunden. Als Idiot konnte man den Dienst ertragen. Es dauerte auch nicht sehr lange, ein paar Wochen. Dann waren die Russen schon in Mecklenburg, und es gab einen Marsch in Richtung Westen. Unsre Ausbilder wollten lieber von den Amerikanern gefangengenommen werden als von den Russen, also marschierten wir nach Schwerin.
»Feindberührung« hatten wir eigentlich nicht. Einmal mußten wir in den Straßengraben, weil Panzer über die Straße fuhren, sowjetische Panzer. Und einmal gab es eine Schießerei. Das war schon nach der Auflösung der Truppe. Tiefflieger, das war das unangenehmste, wenn die Tiefflieger angriffen. Auf dem Marsch nach Schwerin habe ich in einem verlassenen Dorf Bücher geklaut. Wir mußten dort Wasser fassen für die Feldflaschen und kamen in ein leeres Haus. Alles war noch drin, die Möbel und die Bibliothek. Der ehemalige Bewohner, vielleicht der Lehrer des Dorfes, hatte schöne Dünndruckausgaben, Insel-Dünndruckausgaben. Ich klaute eine Kant- und eine Schopenhauer-Ausgabe. Davon habe ich heute leider nur noch Reste.
Ich erinnere mich an meine zu engen Stiefel. Wir hatten vor dem Marsch ganz schnell neue Stiefel fassen müssen, es gab keine Zeit zum Probieren, meine waren eben zu eng, also hatte ich dauernd Blasen an den Füßen.
Unsre Waffen waren alte norwegische Gewehre, andre gab es schon nicht mehr. Auch Flugzeuge wurden nicht mehr mit Flugzeugbenzin, sondern mit Sprit betankt. Dann irgendwann, ungefähr in der Mitte auf dem Weg nach Schwerin, kam ein Kradmelder von vorn, hielt kurz und fuhr an uns vorbei weiter. Danach ging unser Ausbilder schluchzend wie ein Kind die Kolonne ab und sagte: »Der Führer ist gefallen.«
Ein paar Stunden später hielten wir auf einem großen Bauernhof, der auch verlassen war, und der Oberboß, den wir sonst kaum gesehen hatten, hielt eine Rede. Der Führer sei gefallen und die Verräterclique um Dönitz habe kapituliert. Er könnte uns keine Befehle mehr geben, aber wer ein Mann sei und ein Deutscher, der träte jetzt zu ihm, um sich in die Wälder zu schlagen und weiterzukämpfen. Die andern könnten nach Hause gehn. Es traten fünf, sechs deutsche Männer zu ihm, die schlugen sich dann ins nächste Gebüsch. Wir andern zerstreuten uns in der Landschaft und trotteten allein weiter, ziemlich erleichtert.
Ich weiß nicht, in was für einem Geisteszustand ich in diesem halben Jahr gewesen bin. Man kennt die Schlachtbeschreibung von Stendhal in der »Kartause von Parma«, wo der Held sein Idol Napoleon weit hinten einmal ganz klein vorbeireiten sieht. Das Wesentliche an solchen Konstellationen ist, man kriegt nichts mit. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich Angst gehabt hätte. Nur an die Stiefel erinnere ich mich. Es ist wie unter Schock nach einem Unfall. Ein Ort der Angst war eher der Luftschutzkeller. In Waren sind kaum Bomben gefallen. Man hörte immer nur die Bomberverbände, die nach Berlin flogen. Es war oft Fliegeralarm, wir saßen, bevor ich eingezogen wurde, viel im Keller. Zu der Zeit war sowieso schon klar, daß der Krieg verloren war, mir jedenfalls. Vielen andern sicher nicht Es gab ja immer noch das Gerücht von der Wunderwaffe, die der Führer in der Hosentasche gehabt haben soll. Darauf haben viele bis zuletzt gewartet und daran geglaubt. Ich habe mich eher gefreut auf das Ende. Was danach kommt, darüber haben auch die Älteren nicht nachgedacht. Der Krieg war eine Schiene, auf der sind sie gelaufen, sind sie marschiert. Was man tun konnte, war warten. Es war aber alles noch soweit organisiert. In diesem Ausbildungslager an der Ostsee gab es ausreichend zu essen und zu trinken.
Meinen Ausbilder habe ich später wiedergetroffen, sonst niemanden aus dieser Zeit Ich sah ihn in Schwerin, als ich schon frei war. Er war von den Amerikanern zum Straßenfegen eingeteilt. Die setzten am liebsten Offiziere zu Dreckarbeiten ein. Das war die amerikanische Methode, ein Demütigungsritual. Er war also jetzt Straßenfeger, und wir begrüßten uns, und dann sagte er: »Ich habe schon angefangen darüber nachzudenken, ob nicht ich ein Idiot gewesen bin.«
Das Kriegsende war für mich plötzlich ein absoluter Freiraum. Ich bin ziemlich ziellos durch die Gegend getrottet, man hörte ab und zu Schüsse, Artillerie, man sah Panzer in der Ferne durch ein Kornfeld fahren. Ich sah eine zerschossene Brücke, ein Bild, das sich mir sehr eingeprägt hat. Irgendwo bin ich in einen Zug eingestiegen. Er fuhr in Richtung Westen. Er war voller Frauen, Kinder und Soldaten. Er fuhr ein Stück, dann hielt er wieder. Man hörte Gebrüll und Schüsse. Dann stoppten ein paar Russen mit Maschinenpistolen den Zug und suchten ihn nach Soldaten ab. Auf der anderen Seite war ein ziemlich steiler Abhang. Zwei Soldaten sagten: »Wir hauen hier ab, kommst du mit?« Da bin ich mit ausgestiegen, den Abhang hinunter. Die Russen schossen hinter uns her. Wir sind dann ein Stück weitergelaufen, überall lagen tote Pferde und umgekippte Wagen von einem Flüchtlingstreck. Neben einem toten Pferd lag eine Flasche mit Anisschnaps, der erste Anisschnaps meines Lebens, hausgebrannt. Ich habe die Flasche genommen, und ein paar Meter weiter stand der erste Amerikaner und hielt uns an. Als erstes nahm er mir die Flasche weg. Das habe ich den Amerikanern nie verziehn.
Dann fand ich mich auf einer Koppel, einer Viehkoppel, in amerikanischer Kriegsgefangenschaft wieder. Sie trieben uns dort hinein, und wir haben dort einige Zeit verbracht. Es kamen immer mehr, zu essen gab es nichts. Die Amerikaner waren sehr hektisch, sehr nervös, sehr ängstlich. Gegen Abend haben sie uns dann in Kolonnen in Richtung Schwerin getrieben, alle fünf Meter ein schwerbewaffneter Amerikaner. Wenn ein Gefangener in den Straßengraben trat, weil er pinkeln wollte, wurde sofort geschossen. Übernachtet haben wir auf einem Rollfeld. Man schlief da ganz gut. Man merkte bei den amerikanischen Soldaten die Wirkung der Propaganda: Die Deutschen waren Bestien, ganz gefährliche Raubtiere.
Am nächsten Tag kamen wir in ein Dorf bei Schwerin, um Scheunen herum war ein Riesengelände abgesteckt, ein großes Gefangenenlager. Wir übernachteten in den Scheunen. Es gab mal einen Auflauf auf der Straße vor dem Lager. Dann wurde erzählt, daß sie Himmler auf der Straße geschnappt hätten. Er hätte aber rechtzeitig auf seine Zyankaliampulle gebissen und wäre krepiert. Solche Legenden waren sehr beliebt.
Ich hatte vor der Gefangennahme irgendwo eine Dose Büchsenfleisch aufgesammelt. Die habe ich dann über den Zaun gegen ein Ziviljackett, dunkelgrau, hell gestreift, kaputt und zerrissen, eingetauscht. Am Tor stand ein Posten. Ich habe zwei Tage gewartet, bin dann zu dem Posten gegangen, ein stämmiger Amerikaner, und habe mich mit ihm unterhalten, habe ihn gefragt, wo er her ist. »Iowa.« Ob er Familie hat, verheiratet ist, ob er Kinder hat. Er hatte zwei Kinder und hat mir Fotos gezeigt. Ich sagte: »Beautiful kids«. Da waren wir beide ganz gerührt, und er dachte an seine Kinder. »Beautiful family«. Dann haben wir uns die Hand geschüttelt, und ich bin weggegangen. So war ich draußen. Dazu gehörte keine besondere Raffinesse. Ich war sechzehn.
»Hühnergesicht« aus der TODESANZEIGE[4] ist keine Fiktion. Nur, daß ich ihn nicht umgebracht habe. In meiner Erinnerung sind es Tage, die er durch eine ziemlich wüste, flache Gegend mit seinem Hühnergesicht hinter mir her lief. Wobei das relativ unwahrscheinlich ist, die Strecken waren nicht so groß. Ich hätte ihn umbringen können. Ich hatte Nietzsche gelesen und vor allem Dostojewski, »Raskolnikow«. Das Beil. Wie ich ihn in Wirklichkeit losgeworden bin, weiß ich nicht mehr.
Danach bin ich auf einem großen Umweg um Schwerin herum in ein Dorf gekommen, in dem ich dann einige Zeit blieb. Wahrscheinlich ein paar Wochen. In Scheunen hatten sich ehemalige KZ-Häftlinge etabliert, unter anderem ein Schwuler mit dem rosa Winkel. Was er bedeuten sollte, wußte ich damals nicht. Italiener waren dabei, ein Rumäne, der vom Zirkus kam und viel von Pferden verstand, und Polen. Eine Zigeunerin hat mir aus der Hand gelesen und prophezeit, daß ich zusammen mit einem älteren Mann nach Sibirien komme, wenn ich in den Osten gehe. Ich wurde sie schwer los, sie wollte sich ständig an mich hängen. Die Italiener schlachteten um das Dorf herum auf den Weiden Kälber. Dann kamen brüllend die Bauern mit Knüppeln, aber sie konnten nichts machen. Die andern waren in der Übermacht, es war ein rechtloser Zustand. Das Kalbfleisch aßen wir vor der Scheune. Nach den Kälbern kamen die Pferde dran. Die schmeckten auch gut, man mußte sie nur ganz schnell braten. Das wußte der Rumäne.
Dann hatten wir auch keine Pferde mehr. In dem Dorf hatte sich schon wieder eine Ordnung etabliert, es gab eine Gemeindeverwaltung. Wir hatten also eine Versorgungskrise. Dann hörten wir, daß in einer Nachbarscheune, die polnisch besetzt war, Schnaps gebraut wurde. Die Polen hatten einen Kanister Sprit gefunden und daraus ein bräunliches Getränk von tödlicher Durchschlagskraft gemischt. Das Wesentliche für uns war, wenn man mit denen einen Schnaps trank, kriegte man ein Stück Speck und ein Stück Brot. Aus leiblicher Notdurft haben wir uns dieser Schnapszeremonie unterworfen. Ich erinnere mich, daß ich aus irgendeinem Grund von einem Polen einen Kinnhaken kriegte und ungefähr zwölf Stunden später neben einer Jauchegrube aufwachte. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gegen den Schnaps gesagt, ich weiß es nicht. Das war der erste Schnaps meines Lebens. Wir waren eine multikulturelle Gesellschaft, totale Anarchie. Aber die Italiener waren gute Ordnungskräfte. Im Chaos waren sie hervorragend, während die Deutschen im Chaos meistens unzuverlässig wurden.
Dann suchte die Gemeinde Freiwillige, denen Fahrräder zur Verfügung gestellt werden sollten, um aus einem Nachbardorf für die Flüchtlinge Kartoffeln zu holen. Es waren sehr viele Flüchtlinge da. Man hatte einen größeren Kartoffelvorrat aufgetrieben, und die sollten herantransportiert werden. Da es keine Transportmittel gab, bekamen vier Freiwillige Fahrräder. Ich war einer von ihnen. Ich habe keine Kartoffeln geholt, das Fahrrad der Gemeinde gestohlen und bin damit an die amerikanisch-russische Grenze gefahren, zusammen mit zwei anderen, die auch nach Hause wollten. Die Grenze lag an einem kleinen Fluß, und Kilometer vorher erzählten uns die Leute schon, daß hinter den Schlagbäumen und dem Grenzposten das Grauen begänne. In dem kleinen Wäldchen lägen die ersten Leichen. Die Männer kämen alle nach Sibirien, wenn sie nicht gleich erschlagen würden, die Frauen würden vergewaltigt.
Die Amerikaner waren zu faul, den Schlagbaum hochzudrehn, wir wanden uns mit unsern Fahrrädern herum, die Russen hievten feierlich ihren Schlagbaum hoch, nahmen uns die Fahrräder ab und fragten nach Uhren. Wir waren zu dritt. »Uri?« war die erste Frage. Wir hatten keine. Dann wurden wir hinter dem Wäldchen zu einem Haus eskortiert und in den Keller gebracht. Dort saßen schon vierzig andere Todeskandidaten und warteten auf ihre Hinrichtung. Wir haben da drei, vier Stunden in Erwartung eines ungewissen Schicksals verbracht. Dann kam ein riesiger Topf mit Erbsensuppe und Speck. Wir haben wieder ein paar Stunden gewartet. Einige erzählten von den Toten, die sie draußen gesehen hätten. Unsre Hoffnung war, daß man Delinquenten nicht füttert. Dann wurden wir auf die Straße eskortiert und marschierten wieder, nur nicht mehr im Gleichschritt. Wir trotteten in Richtung Osten und freuten uns auf Sibirien. Es waren kaum Soldaten dabei, oder nur Soldaten, die sich schon zivil gemacht hatten. Als es anfing, dunkel zu werden, sagten uns die Russen, wir könnten jetzt allein weitergehn.
Wir müßten nur, wenn es dunkel ist, von der Straße verschwunden sein, weil dann scharf geschossen würde. Wir haben uns für die Nacht wieder irgendwo in einer Scheune verkrochen.
Am Morgen sind wir in unsre verschiedenen Richtungen weitergetrottet, ich von da an allein bis Waren. Unterwegs bin ich zweimal angehalten worden. Einmal trat ein Russe aus dem Wald und fragte, ob ich Pole wäre. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, was besser ist, Pole sein oder nicht Pole sein. Ich habe in den Wald gesehn und sah Stacheldraht. Da war mir klar, daß sie Polen einsackten. Ich sagte: »Nix Polski«, und konnte weitergehn. Dann kam noch mal einer aus dem Wald und schnauzte mich an: »Papier«. Ich dachte, der will einen Ausweis sehn, ich hatte meinen Rettungsschwimmer-Ausweis mit Paßbild auf einem Stück Pappe. Er faßte es an und sagte: »Nix, dawai«. Er wollte Papier zum Zigarettendrehen, das habe ich erst später begriffen. Als Deutscher denkst du bei Papier gleich an einen Ausweis.
Ich kam von Südwesten wieder in Waren an – eine sehr schöne Gegend, Seen und Wälder. Ich stand ziemlich hoch und blickte auf die Stadt, dieser Moment ist mir in Erinnerung. Es stand noch alles. Waren ist kaum bombardiert worden, nur die Flugzeugwerke. Meine Mutter war da, mein Bruder, und ein russischer Offizier, eine Einquartierung, ein freundlicher, höflicher Mann, er sprach deutsch. Mein Bruder war sehr beliebt, Kinder liebten sie ja sowieso. Es war eine chaotische Zeit. Es ging immer um die Beschaffung von Essen, das klappte über die Russen. Meine Mutter kochte dann auch für sie. In der Zeit der Vergewaltigungen war sie zu einer Freundin gezogen, deren Mann aus dem KZ noch nicht zurück war. Diese Frau lebte mit einem Jugoslawen, kein Titoist, sondern ein Ustascha-Mann, glaube ich.
Ein Riese um die einsneunzig, ein Bär, freundlich. Der sprach russisch und hat die Russen abgewimmelt. Er hatte eine ganze Herde Frauen im Haus und hielt die Russen von ihnen ab.
Waren nach dem Krieg, 1945–47
Die Zeit nach dem Krieg war ziemlich wüst, aber auch ganz intensiv. Zum Beispiel der Tanzpalast in Waren. Da war jede Nacht Tanz. Tanz auf dem Vulkan, eine Mischung aus Endzeit und Karneval. Nach dem Krieg fing eigentlich nichts Neues an, es war nur etwas zu Ende. Es gab noch keine neuen Hoffnungen. Es war alles ziemlich wild, alles ging ganz schnell. An einem Abend im Tanzpalast mußte ich dringend scheißen, und das Klo war wieder überflutet, also ging ich in die Büsche neben dem Haus. Ich hatte gerade die Hose runtergelassen, da tauchen zwei Russen mit MPs aus dem Busch auf und wollten wissen, was ich da machte. Ich versuchte ihnen klarzumachen, daß ich scheißen will. Das glaubten die mir aber keineswegs. Ich habe schnell die Hose hochgezogen, habe mich fallen lassen, bin den Abhang hinuntergerollt, und sie haben hinter mir hergeschossen. Im Klo schwamm die Scheiße, so überfüllt war der Tanzpalast.
Zusammen mit einem ehemaligen Lehrer von der Oberschule, Sozialdemokrat bis 1933, der dann auch der erste Schuldirektor nach dem Krieg wurde, war ich für die Säuberung, die Entnazifizierung der Bibliotheken des Landkreises verantwortlich. Wir säuberten die Bibliotheken von Naziliteratur, auch die der Gutsherren. Diese Tätigkeit war die Grundlage meiner eigenen Bibliothek. Ich habe geklaut wie ein Rabe. Das war eine schöne Zeit. Ich habe Bücher geklaut, gelesen und einfach sehr viel kennengelernt.
Danach wurde ich Angestellter im Landratsamt. Mein Vater war stellvertretender Landrat in Waren geworden, und man mußte irgendeine Arbeit haben. So wurde ich »Beamter«. Ich hatte gar nichts zu tun, saß nur in einem Büro, mit einem älteren Mann, der für die Bodenreform zuständig war. Wir fuhren gelegentlich aufs Land zu Bauern. Und Bauern kamen mit Beschwerden und Problemen ins Büro. Ich habe immer dabeigesessen und mir das angehört, auch mal was aufgeschrieben.
Das alles wurde später Material für die UMSIEDLERIN.[5] Gelegentlich mußte ich auf den Dachboden, um Akten zu holen. Außerdem lagerten auf dem Boden die Bestände der Stadtbücherei und der Kreisbibliothek. Es gab keine Räume dafür. Da legte ich mir dann immer die Bücher zurecht, die ich abends mitnehmen wollte. Eine Nietzsche-Ausgabe, Bücher von Ernst Jünger. Ich konnte meine Bibliothek weiter vervollständigen; das war meine Haupttätigkeit als Angestellter.
Und ich schrieb in der Zeit im Landratsamt eine Novelle, sie ist verschollen, die Geschichte eines Mannes, der aus dem KZ zurückkommt, seine Familie ist zerstreut, seine Frau hat einen Liebhaber. Und der Mann sucht den, der ihn ins KZ gebracht hat. Ich weiß nicht mehr, wie es ausging. Ich erinnere mich an ein Bild: eine Hand, die aus einem Grab wächst.
Wie war das genau im Landratsamt?
Ich saß da an einem kleineren Tisch, und der Beamte, der zuständig war, der Abteilungsleiter, saß an seinem Regierungsschreibtisch, und die Bauern standen und trugen ihre Sachen vor. Viel mehr als das, was sie sagten, haben mich die Tonfälle interessiert, die Art, wie sie sprachen. Ich weiß kein konkretes Detail mehr, weil das alles eingegangen ist in den Text von UMSIEDLERIN. Und damit ist es auch aus meinem Gedächtnis gelöscht.
Aber der Vorgang ist interessant: Ich saß dort und machte mir Notizen, aber ohne Interesse für die Sachen, um die es ging.
Mit der Beendigung des Textes ist dann jede Erinnerung an die Fakten ausgelöscht. Sicher habe ich damals auch die Inhalte aufgenommen, aber es gibt keine Erinnerung mehr daran. In einer Cino-Übersetzung, ein provençalischer Dichter aus der Troubadour-Zeit, beschreibt Ezra Pound den Vorgang: »Ravens, nights, allurements / And they are not / Having become the soul of song.«
Diese ganze Zeit war der Grundstock für mindestens zwanzig Jahre meiner Arbeit. Der Fleischermeister aus SCHLACHT[6] stammte aus dieser Zeit. SCHLACHT sowieso, die meisten Szenen, TRAKTOR[7] auch. Es sind auch zum großen Teil Sachen, bei denen ich immer neu angesetzt habe, sie zu schreiben. Zum Beispiel die Fleischergeschichte. Da gibt es einen Ansatz, ein Hörspiel daraus zu machen, dann ein paar Prosaversuche, Gedichte verschiedenster Art. Auch mehr oder weniger schlecht. Der Beruf »Fleischer« ist allerdings Literatur; es war ein Bäcker, der sich wegen seiner offenen Kollaboration mit den Nazis im See umgebracht hat.[8] Die Frau hat versucht, ihn zu retten, ohne Erfolg. Es gab viele Suizide damals. Allein in Waren etwa vierhundert Selbstmorde.
Den Mann, der seine Familie nach Hitlers Tod mit Eva Braun getötet hat[9] und dann nicht den Mut hatte, sich selbst umzubringen, habe ich danach gesehen. Er lief mit grauem Gesicht und einem Schäferhund durch die Stadt. Ein Motiv für die Selbstmorde war die Angst vor den Russen, dann die Vergewaltigungen, das waren Racheorgien. Eine Nachbarin zum Beispiel ist in unserm Haus von Russen vergewaltigt worden. Der Mann mußte zusehn. Eine Woche lang wurde vergewaltigt. Ich war da noch in Schwerin. Der Polizeichef von Waren, oder sein Stellvertreter, hat seine ganze Familie versammelt, bevor die Russen einrückten. Seine Familie, das waren zwölf Leute, drei Generationen. Und dann hat er gesagt, wer kein Kuhrt ist – die Familie hieß Kuhrt –, kann gehen. Eine junge Frau mit einem Kind ist gegangen. Die andern hat er erschossen, sich selbst dann auch.
Eine andere Geschichte habe ich unterwegs gehört, auf dem Weg von Schwerin nach Waren: Da waren drei Freifrauen, drei Generationen, Großmutter, Mutter und Tochter, allein in ihrem Zwanzig-Zimmer-Schloß, und warteten auf die Russen. Die Männer waren tot, zwei in Rußland gefallen, einer war nach dem 20. Juli hingerichtet worden. Vor den Russen kam flüchtende SS vorbei, in Unterhosen, nur noch mit Resten von Uniformen. Einer von ihnen, ein kroatischer SS-Leutnant, ein »Gastarbeiter«, wollte einen Zivilanzug. Die Frauen sagten ja, aber dafür müßte er sie umbringen. Der Kroate hatte keine Waffen mehr. Er hat dann in einem Schuppen eine Axt gefunden. Die drei Frauen verteilten sich auf ihre zwanzig Zimmer, und er hat sie einzeln mit der Axt erschlagen. Dann zog er den Anzug an und ging weiter.
Die Umsiedlertrecks spielten eine große Rolle als Stoff, eine massenhafte Bewegung. Da wohnten auch Leute bei uns, Tage und Wochen, noch bevor ich eingezogen wurde, aus Ostpreußen, aus Polen. Die Geschichte von der Weichselüberquerung bei Eisgang, die im Stück dann vorkommt, ist aus der Zeit.[10] Ich weiß noch, wie sie ankamen. Da war gegenüber von unserm Haus ein Scheunenviertel, und da lagerten sie, bis sie weiterzogen. Es gab die wahnwitzigsten Geschichten darüber, was da alles auf dem Treck passiert war. Zum Beispiel Entscheidungen zwischen dem Schwein und der toten Großmutter. Was nimmt man in die nächste Stadt mit, die tote Großmutter oder das Schwein? Etwas mußte geopfert werden, beides zugleich war zu schwer.
Welches Verhältnis hast Du heute zu UMSIEDLERIN?
DIE UMSIEDLERIN ist mein liebstes Stück. Die Geschichte hat am meisten Stoff; sie ist auch am frischsten. Es ist ja immer so, am Anfang gibt es eine Unschuld in den Texten, die du nicht wiederfindest. Vielleicht kurz vorm Sterben, auf andere Weise.
Wie hast Du die Russen erlebt in Waren?
Als ich nach Waren zurückkam, waren die Vergewaltigungen vorbei, bis auf Einzelfälle. Es gab einen Vorfall mit dem Stellvertreter meines Vaters, einem dicken Mecklenburger. Dem hatte ein Russe die Uhr geklaut, die Armbanduhr, und er hat den Fehler gemacht, es dem Militärkommandanten zu sagen. Es gab regelmäßige Treffen beim Kommandanten, jede Woche einmal, Befehlsempfang für die Funktionäre. Das war mit ungeheuren Trinkereien verbunden, also immer hundert Gramm Wodka, und jeder sagt einen Trinkspruch. Sie kamen auf allen vieren nach Hause. Das war die russische Politik, die deutschen Funktionäre mit Wodka gefügig zu machen. Dieser arme Mensch hatte ein Magengeschwür und konnte nicht saufen. Er ist ein paarmal beinahe erschossen worden, weil er nicht trank. Jedenfalls wurde ihm die Uhr geklaut, und er hat es dem Kommandanten gesagt. Der Kommandant ließ seine Männer antreten. Er sollte den heraussuchen, der ihm die Uhr geklaut hatte. Er fand ihn auch, zeigte auf ihn, und der Kommandant hat den Soldaten auf der Stelle erschossen.
Einmal wurde ich zum NKWD bestellt, eine Villa an der Müritz, das war gespenstisch. Das Haus lag etwas zurück im Park, und das Tor war kaputt. Am Tor stand ein Posten, der sich aber nicht rührte. Ich ging hinein, der Flur war dunkel, ein langer Flur, und ich stand bis über die Knöchel im Wasser, irgendwo war Licht, ich bin durch das Wasser gewatet, habe die Tür aufgemacht, da saß ein sehr freundlicher Offizier und sagte: »Nehmen Sie Platz, Herr Müller, bitte. Wie geht in Schule? Was machen Schüler in Pause? Was erzählen Schüler in Pause? Brauchen Sie Handschuhe für Boxen? Brauchen Sie? Wir können machen. Was sprechen Kameraden in Pause?« Ich habe ihm erzählt, Kameraden in Pause sprechen über Mädchen. Es hat ihn nicht sehr interessiert, und ich war entlassen.
Es gab da einen Kulturoffizier, einen Juden – die Kulturoffiziere waren meist Juden –, der ab und zu Schüler einlud. Dann gab es Tee und Gebäck, und er sprach über Kultur. Ich lernte ihn kennen, noch bevor die Schule wieder angefangen hatte. Er ging durch die Stadt und sprach gern mit Jungen. Wir standen zu dritt bei uns vor dem Haus. Er kam, stellte sich vor und redete über deutsche Kunst und Literatur, er konnte Heine auswendig. Sein Lieblingssatz war: »Deutsche Kunst ist eine Traumkunst.« Irgendwann gab es bei ihm eine Abschiedsparty mit Tee und Gebäck, er mußte zurück in die Sowjetunion. Das bedeutete: ins Lager. Wir wunderten uns, daß er weinte. Das mit dem Lager hat er natürlich nicht gesagt, wir wußten es auch nicht. Das haben wir später gehört. Wir haben uns nur gewundert, daß er weint. Deshalb war er für uns nicht Besatzungsmacht. Die Macht weint nicht.
Das Verhältnis zu den Russen war zum Teil mit Angst besetzt, aber für mich weniger, weil ich ja eigentlich zu den Siegern gehörte, obwohl die natürlich auch bedroht waren. Mein Vater hatte einmal ein Problem: eine Liebesaffäre mit einer Dolmetscherin. Sie gestand ihm, daß sie vom NKWD auf ihn angesetzt war. Das gab es immer, diese Beunruhigung.
Ich hatte durch die Funktion meines Vaters relativ wenig Kontakt zur Bevölkerung. Die Funktionäre waren isoliert. Es fällt mir ganz schwer, mir vorzustellen, was »normale« Bürger in dieser Zeit über die Lage gedacht oder gesagt haben. Das war eine Glasglocke. Die Leute sprachen mit Funktionären nicht über das, was sie dachten. Das war dann in Sachsen, in Frankenberg, wieder anders. Die Leute in Waren sprachen nicht darüber. Das hat auch mit Mecklenburg zu tun, dort ist man sehr verschlossen. In Mecklenburg gibt es »Spione« an den Wohnungen, draußen am Fenster Spiegel, wie Rückspiegel am Auto, damit man sieht, wer vorbeigeht oder hereinkommt.
Mecklenburg ist das nördlichste Norddeutschland. In den langen Wintern grauenvolle Selbstmorde. Die Leute erschossen sich mit Schweinebolzen oder hängten sich im Stall auf. Schwarze Schwermut, Schnaps und wenig Phantasie. Bismarck hat über Mecklenburg gesagt: »Mecklenburg ist wie ein alter Mehlsack, wenn man draufschlägt, kommt immer noch etwas heraus.« Die Sachsen sind anders. Sie hatten geheime Volkslieder, zum Beispiel auf die Melodie von »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«: »Brüder, versauft eure Gelder / kauft euern Priem im Konsum / maust euer Holz in die Wälder / und bringt euern Pieck bald um.« In Sachsen gab es eine starke SPD-Tradition.
Hast Du damals schon Theater gesehen?
Das einzige Theater, das ich damals gesehen habe, das erste meines Lebens überhaupt, war eine »Wilhelm Tell«-Aufführung im Gasthaus, wo später die Tanzveranstaltungen stattfanden. Ein »Wilhelm Tell« ohne Pferd. Ich war enttäuscht, weil ich mich auf das Pferd gefreut hatte. Eine Tourneeaufführung. Das nächste Theater, das ich gesehen habe, war »Tristan« in Chemnitz, ich glaube 1947/48, dann eine Laien-Aufführung von »Golden fließt der Stahl« von Karl Grünberg, auf Sächsisch. Das nächste war dann schon in Berlin »Mutter Courage«, dazwischen nichts. Ich selbst habe in der Schule in Frankenberg den »Zerbrochnen Krug« inszeniert. Die Inszenierung war sicher kein Meisterwerk.
Erinnerst Du Dich an Bücher, die Du damals gelesen hast?
Als Kind hatte ich viel Tolstoi gelesen, auch Gorki, und kurz vor der Einberufung, das war der erste wirklich starke Eindruck, Dostojewskis »Raskolnikow« und natürlich Nietzsche. Dann las ich, was gerade erschien, Scholochow zum Beispiel, Majakowski. Serafimowitsch: »Der eiserne Strom«, Fadejew: »Die Neunzehn«, große vergessene Bücher. Zu meiner Beute als Säuberer von Bibliotheken gehörte »Im Banne des Expressionismus« von Soergel, eine Fundgrube. Nach dem Krieg, bis zur Währungsreform, konnte man alle Zeitschriften kriegen, die es in den Besatzungszonen gab, alle Neuerscheinungen. Mein Vater konnte das bezahlen damals, Information war eine Geldfrage. Eine Entdeckung Amerikas war der erste Faulkner, den ich gelesen habe: »Wendemarke«, 1947. Oder Hans Henny Jahnn. Diese Eindrücke waren danach für Jahre zugedeckt mit Brecht.
Rückkehr nach Sachsen, Frankenberg, 1947–51
Weil mein Vater in Frankenberg Bürgermeister wurde, zogen wir wieder nach Sachsen. Dort ging ich weiter auf die Oberschule. Wir hatten einen guten Deutschlehrer, der mich auch mit Literatur versorgte. Er hat mir sogar Geld angeboten für ein Debüt als Schriftsteller. Er meinte, ich müßte zuerst eine Novelle schreiben, das wäre der beste Start, und er wäre bereit, mir Geld vorzustrecken, wenn ich eine Novelle schriebe. Er kannte von mir nur Aufsätze. Und damit gab es sogar Ärger. Ein Aufsatzthema war ein Schiller-Spruch: »Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an.« Ich hatte gerade Anouilh gelesen. Bei Anouilh stand ein Spruch gegen den Pöbel, der Wurst ißt und Kinder zeugt, wogegen die Elite, die man sich nur mit einem Loch in der Schläfe vorstellen kann usw. Das habe ich in dem Aufsatz zitiert und geschrieben, daß der Satz von Schiller eben doch inzwischen den Geruch der Gaskammern hätte. Das war ein großes Problem für meinen Lehrer. Er sagte, als literarische Leistung müßte er es mit Eins bewerten, als Aufsatz mit Fünf. Er hat sogar mit meinem Vater darüber gesprochen, wie mit mir an der Schule zu verfahren sei, mein Verhältnis zur Schulordnung. Hinzu kam, daß ich immer mit einem roten Halstuch in die Schule kam, meistens zu spät. Außerdem rauchte ich in der Pause. Andrerseits: Ich erinnere mich an einen Text aus »Jubiabá« von Amado, den er uns vorgelesen hat. Der Held war ein Neger auf Montage, der onaniert, weil er allein ist, und »seine Hand war die Frau«. Das hat er uns vorgelesen, eine Leistung für einen deutschen Lehrer.
Also angenehme Schülererinnerungen?
Der einzige Alptraum war Mathematik, weil ich da zwei Jahre nichts getan hatte. Keine Hausaufgaben, nichts. Ich habe, glaube ich, noch eine Vier oder eine Drei bekommen. Mathematik hat mich nicht interessiert; die Gegenstände haben mich nicht interessiert, die Methode schon. In Geographie hatte ich Schwierigkeiten, weil ich mit der Tochter des Lehrers geschlafen hatte. Er hat mir beim Abitur die schwierigsten Fragen gestellt.
Woran hast Du Dich als erstes im Schreiben versucht?