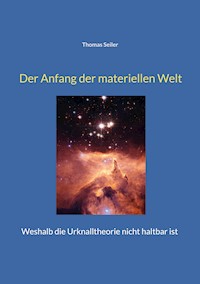
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Lehre der katholische Kirche über den Anfang des Universums beinhaltet, dass es in seiner Vollkommenheit und Schönheit durch eine rein übernatürliche und sofortige Erschaffung ins Dasein kam und daran anschließend die Bewegung der Materie den Naturgesetzen folgte. Der Autor zeigt die Anfechtung dieser bis heute aufrechterhaltenen Lehre durch den Philosophen René Descartes im 17. Jahrhundert, die zu einem Paradigmenwechsel führte. Darauf folgt eine wissenschaftliche Bewertung des gängigsten Modells für einen naturalistischen, evolutionären Ursprung des Kosmos, der sogenannten Urknalltheorie, die in ihren wesentlichen Vorhersagen im Widerspruch zu den astronomischen Beobachtungsdaten steht. Die Galaxien rotieren viel zu schnell, um über die postulierten Zeiträume zusammenzuhalten. Die beobachtbare Dichte wichtiger Elemente liegt um einen Faktor zwanzig zu niedrig. Der Mikrowellenhintergrund ist zu homogen, um die tatsächliche Galaxienverteilung ableiten zu können. Die Entstehung der ersten Sterne aus Gasnebeln scheitert am allgemeinen Gasgesetz. Der fortschreitende Blick von unserer Nachbarschaft bis in die Tiefen des Weltalls lässt die erwartete Reifegrad-Entwicklung im Erscheinungsbild der Galaxien nicht erkennen. Die Erde weist ein breites Spektrum fein-abgestimmter Eigenschaften auf, die eine Entstehung aus einer Explosion heraus unplausibel machen. Nach neueren Super-Nova-Vermessungen müsste diese explosionsartige Ausdehnung sogar immer schneller werden, wofür es in der Naturwissenschaft keine Beispiele gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Die Offenbarung Gottes
Eine biblische Prophezeiung
Die kosmologische Hypothese
Argumente für das kosmologische Standardmodell
Die Isotropie der Rotverschiebung
Der kosmische „Fossilbericht“
Die Entstehung der Sterne
Der Kernpunkt
Weitere astronomische Beobachtungen
Schlussfolgerung und Bedeutung
Einführung
Am 22. November 1951 hielt Papst Pius XII. vor der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften eine Ansprache mit dem Titel „Die Beweise für die Existenz Gottes im Lichte der modernen Naturwissenschaft". In dieser Ansprache kommentierte er die „Theorie des Urknalls" und kam zu dem Schluss, dass dieses Szenario einen Anfang des Universums bedeuten würde, bei dem sich die Materie zunächst in einem höchst außergewöhnlichen Zustand befand:
„Die Wissenschaftler sind sich darin einig, dass nicht nur die Masse, sondern auch die Dichte, der Druck und die Temperatur der Materie absolut enorme Ausmaße erreicht haben müssen...“1
Und er verwies darauf, dass uns dies mit dem Übernatürlichen konfrontieren würde:
„Zu Recht besteht der Verstand in seinem Wahrheitsdrang darauf, zu fragen, wie die Materie diesen Zustand erreicht hat, der so anders ist als alles, was wir in unserer normalen Erfahrung vorfinden; und er will ferner wissen, was diesem Zustand vorausgegangen ist Vergeblich würden wir eine Antwort in der Naturwissenschaft suchen, die ehrlich zugibt, dass sie sich einem unlösbaren Rätsel gegenübersieht Es ist wahr, dass eine derartige Frage die Naturwissenschaft als solche überfordern würde.“2
Der BBC-Wissenschaftsjournalist Simon Singh erklärt, dass die Schlussfolgerung des Papstes nach Ansicht von Georges Lemaître, der diese neue Art, den Ursprung des Universums zu erklären, erfunden hatte, inakzeptabel war:
„Lemaître wandte sich an Daniel O'Connell, den Direktor der Vatikanischen Sternwarte und wissenschaftlichen Berater des Papstes, und schlug vor, gemeinsam zu versuchen, den Papst davon zu überzeugen, zur Kosmologie zu schweigen. Erstaunlicherweise war der Papst willfährig und stimmte der Bitte zu – der Urknall sollte nicht länger ein Thema für päpstliche Ansprachen sein.“3
Im Gegensatz zu Papst Pius XII. lehnte Lemaître jegliche implizite Aussage ab, die in seiner Theorie auf einen Schöpfer hinweisen würde. Nicht nur die vermeintliche natürliche Entfaltung des Universums, sondern sogar der Anfang, der Urknall selbst, musste ohne Gott stattgefunden haben. Georges Lemaître erklärt:
„Soweit ich sehe, bleibt eine solche Theorie [des Uratoms] völlig außerhalb jeder metaphysischen oder religiösen Frage. Sie lässt dem Materialisten die Freiheit, jedes transzendente Wesen zu leugnen. ... Für den Gläubigen beseitigt sie jeden Versuch der Vertrautheit mit Gott ... Das stimmt mit dem Wort Jesajas überein, der von dem verborgenen Gott‘ spricht, der schon im Anfang des Universums verborgen war ... Die Wissenschaft muss angesichts des Universums nicht kapitulieren, und wenn Pascal versucht, aus der angeblichen Unendlichkeit der Natur die Existenz Gottes abzuleiten, dann dürfen wir annehmen, dass er in die falsche Richtung schaut.“4
Diese Worte belegen Lemaîtres gedankliche Nähe zu dem Kosmologen Stephen Hawking. In seinem letzten Buch vor seinem Tod (erschienen 2018) und seiner Beerdigung in der Westminster Abbey neben Charles Darwin argumentierte Hawking 2018 folgendermaßen:
„Die Naturgesetze sagen uns ..., dass das Universum wie ein Proton aufgetaucht sein kann, ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen und ohne Energie zu beanspruchen, aber auch, dass möglicherweise nichts den Urknall verursacht hat Nichts.“5
In den folgenden Abschnitten werden wir sehen, dass nicht nur ein solcher Anfangszeitpunkt eines Urknalls nicht mit der Naturwissenschaft in Einklang zu bringen ist. Auch das nachfolgende Szenario einer kosmischen Entwicklung von einer „Singularität“ über heiße Strahlung zu Atomen, Staub, Sternen und Galaxien steht im Widerspruch zu astronomischen Beobachtungen.
1 Pius XII., Ansprache vor der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, 22. November 1951, 42.
2 Ebd., 43.
3 Simon Singh, Big Bang, 2010, Harper Collins UK., S. 362.
Die Offenbarung Gottes
Der christliche Glaube lehrt, dass der Schöpfer des Universums uns mitgeteilt hat, was in der Frühgeschichte der Welt wirklich geschehen ist. Uns wurden die beiden Säulen der göttlichen Offenbarung gegeben: die Heilige Schrift und die Heilige Tradition. Papst Pius XII. rief die Gläubigen in seiner Enzyklika Humani Generis dazu auf, deren Autorität auch in Fragen der Wissenschaft aufrechtzuerhalten:
„Nicht wenige stellen ja dringend die Forderung, die katholische Religion möge diese , wissenschaftlichen ‘ Fachgebiete möglichst stark berücksichtigen. Das ist in der Tat lobenswert wo es sich um wirklich bewiesene Tatsachen handelt; es ist jedoch mit Vorsicht aufzunehmen, wo es sich mehr um die Frage von Hypothesen handelt, auch wenn sie irgendwie auf irdischer Wissenschaft beruhen, durch welche die in der Heiligen Schrift oder in der Tradition enthaltene Glaubenslehre berührt wird Wenn solche von Vermutungen ausgehenden Meinungen direkt oder indirekt gegen die von Gott geoffenbarte Glaubenslehre sind, dann kann eine derartige Forderung in keiner Weise zugelassen werden.“6
Die kirchliche Lehre von der Erschaffung des Universums beruht auf der vom Heiligen Geist eingegebenen Offenbarung, die dem Propheten Moses gegeben und im ersten Buch der Heiligen Schrift niedergeschrieben wurde. Auf der ersten Seite des Buches Genesis lesen wir, was am ersten Tag der Schöpfung geschah:
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“
Genesis 1,1
Daraufhin wird geoffenbart, dass Gott durch die Scheidung des Wassers in einen unteren und einen oberen Bereich das Firmament geschaffen hat, welches Er „Himmel“ nannte. Daraus folgt, dass die Erde vor dem Himmel erschaffen wurde.
Am dritten Schöpfungstag erschuf Gott die Pflanzen:
„Und Gott sprach: Es lasse die Erde Pflanzen sprossen, die grünen und Samen tragen, und Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, die ihren Samen in sich haben, und es geschah also. “
Genesis 1, 11
Der Herr offenbarte also, dass die Erde und auch die Pflanzen vor der Sonne, dem Mond und den Sternen existierten, weil diese erst am vierten Schöpfungstag erschaffen wurden. Da die Urknalltheorie hingegen fordert, dass die Erde 8,8 Milliarden Jahren nach der Existenz der ersten Sterne entstanden ist, liegt hier ein Widerspruch zur geoffenbarten Lehre der katholischen Kirche über die zeitliche Abfolge der Schöpfung vor. Auch wenn man die Schöpfungstage bildlich als sehr lange Zeiträume verstehen würde, führt es letztlich in diese Schwierigkeit.
In den Versen 14-19 informiert uns die Genesis über die Erschaffung der Himmelskörper:





























