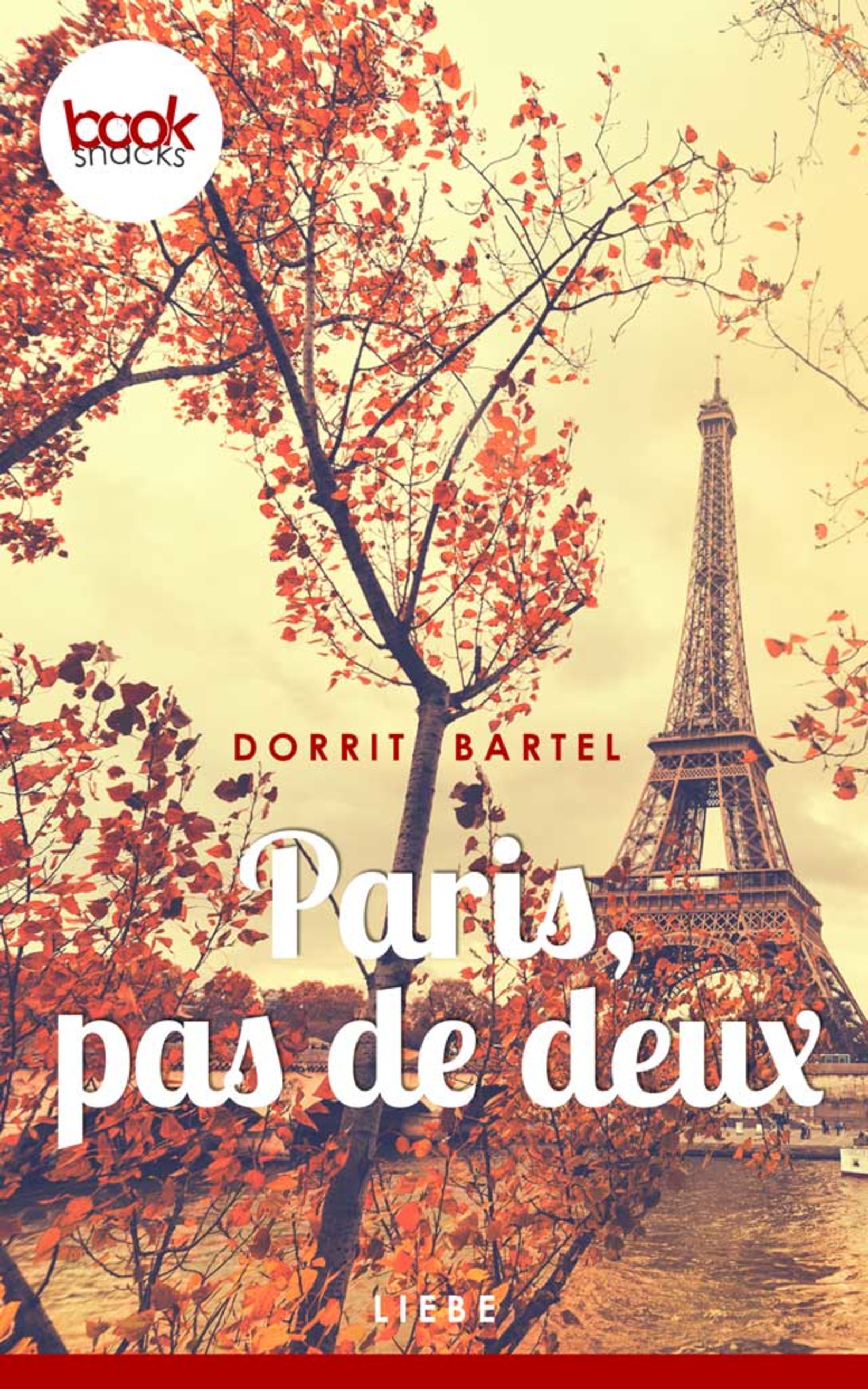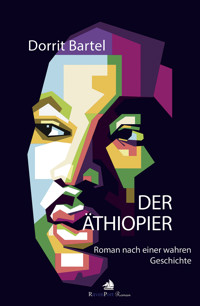
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RavenPort Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Inspiriert von einer wahren Geschichte erzählt dieser Roman das Leben von Adane, der einmal mehr aufsteht als er fällt. Früh muss er seine Familie in der äthiopischen Savanne verlassen und erfahren, dass er selbst nicht über sein Leben bestimmen kann. Er passt sich wechselnden Umständen an: An einer Missionsschule wird er zum Christen, als Solidaritätsstudent in der DDR zum Kommunisten. Als Politiker kehrt er nach Äthiopien zurück, doch mit dem Zusammenbruch des Sozialismus landet er im Gefängnis. Bedroht von der Todesstrafe schwört er sich, zukünftig eigene Entscheidungen zu treffen, wenn er überlebt. Wider Erwarten kommt er frei und entsagt den Ideologien. Zurück in Deutschland arbeitet er fortan mehr mit den Händen als mit dem Kopf. Seine wahre Bestimmung findet er zuletzt wieder in der Heimat. Er sorgt für die Bildung von Kindern und gibt ihnen das Werkzeug zur Selbsthilfe: Den freien Willen. _____________________________________________ "Dieser Roman ist von großer erzählerischer Dichte und Wärme. Die Autorin Dorrit Bartel schreibt liebevoll, unverkitscht und lässt uns ganz auf der Seite von Adane stehen bei seiner Lebensreise zwischen Kulturen und historischen Umwälzungen." (Nina George) "Absolut lesenswert in seiner Kombination aus beeindruckendem privatem Lebensweg, eingebunden in die gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Jahrzehnte in Äthiopien und Deutschland." (Leserstimme)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Äthiopier Adane Wondimu muss sich in seinem Leben immer wieder neu erfinden. Savannenkind, Missionsschüler, Solidaritätsstudent in der DDR, Maurermeister, Philosoph, Politiker, Häftling … Es sind nicht weniger als weltgeschichtliche Ereignisse, die seinem Leben immer neue Wendungen geben. Nicht nur einmal droht ihn der Zusammenprall unterschiedlicher politischer, kultureller und gesellschaftlicher Systeme zu zerreiben, doch schließlich wird er zum Mittler zwischen den Kulturen. Der vorliegende Roman zeichnet ein ungewöhnliches Leben nach und erzählt von ganz persönlichen Folgen der Globalisierung.
„Dieser Roman ist von großer erzählerischer Dichte und Wärme. Dorrit Bartel schreibt liebevoll, unverkitscht und lässt uns ganz auf der Seite von Adane stehen bei seiner Lebensreise zwischen Kulturen und historischen Umwälzungen.“
Nina George, Autorin von „Das Lavendelzimmer“
Dorrit Bartel ist Mecklenburgerin qua Geburt, Berlinerin durch Entscheidung, Europäerin aus Überzeugung und – wie es ein afrikanischer Freund einmal ausdrückte – Afrikanerin mit dem Herzen. Sie reist seit über zehn Jahren oft für längere Zeit nach Afrika und schreibt in Berlin und Dakar über eben diesen Kontinent und seine Bewohner.
Sie zeichnet ein differenziertes Bild afrikanischen Lebens, das in Europa oft in Klischees gedacht wird. Dabei lernt sie selbst viel von ihren Begegnungen und Erfahrungen in Afrika: Demut, Gelassenheit, Zuversicht. 2023 erschien ihr Buch „Afrikas Pulsschlag | Begegnungen in acht Jahren und vier Ländern“.
Wenn sie nicht schreibt, lektoriert sie Romane anderer Autoren, hilft als Schreibcoach und koordiniert die Aktivitäten des Netzwerks Autorenrechte.
Dorrit Bartel
DER ÄTHIOPIER
Roman
Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der noon Foundation „Aufstieg durch Bildung“ 2025
Anmerkung:
In diesem Buch wird an einigen wenigen Stellen das N-Wort benutzt. Dies geschieht nach gründlicher Abwägung im Sinne der Authentizität und nach Absprache mit Adane, dessen Geschichte zu diesem Buch inspirierte. Auch er fand die Verwendung des Wortes richtig und nötig.
Dorrit Bartel
Der Äthiopier
1. Auflage © 2025 RavenPort Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Autor: Dorrit Bartel
Umschlagdesign: Angela Schwarze
Illustrationen: Muhammad Asnan Hafidh
Druck: Custom Printing
ePub: Helmut Schaffer, Hofheim a. Ts.
ISBN Print: 978-3-69061-201-2
ISBN ePub: 978-3-69061-200-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors
unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Verviefältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bitte besuchen Sie den RavenPort Verlag im Internet: www.ravenport-verlag.de
Inhalt
2021 in Äthiopien
Savannenkind
Unter Nonnen
Ferien in der Savanne
Addis Abeba I
Unter Soldaten
In Gefahr
Freunde
Unter Weißen
Frauen
Internationale Beziehungen
Das Ende des Sozialismus
Addis Abeba II
Gefängnis
Hilfe aus Deutschland
Zurück unter Weißen
Familienangelegenheiten
Unter Asiaten
Das Projekt
Abschied
Ein neuer Anfang
2021 in Äthiopien
Februar 2018
Danke
2021 in Äthiopien
Adane schaut den Kindern beim Essen zu und versucht, die Leere in seinem Magen zu ignorieren. Er wird erst essen, wenn die Kinder genug Gerstenbrei gegessen haben. Gerste ist seit Wochen ihr Hauptnahrungsmittel, denn Gerste ist nahrhaft und preiswert.
»Onkel, kannst du mir bei Mathe helfen? Ich verstehe einfach nicht …«
Sein Telefon klingelt. Es ist der Anruf, den er seit Wochen gleichermaßen erhofft und fürchtet.
»Wir sprechen später«, sagt er, nimmt das Telefon und geht nach draußen. Dort nimmt er den Anruf an und sagt: »Jetzt gibt es Arbeit?«
»Sei Donnerstagnachmittag in Addis, dann fahrt ihr nach Kobo.«
»Kobo? Dort wird gekämpft.«
»Noch nicht.«
»Aber morgen vielleicht. Oder nächste Woche. Die Grenzen des Kriegs verschieben sich jeden Tag. Und überall dort gibt es Massaker.«
»Du brauchst also keinen Job?«
Nach kurzem Schweigen fragt Adane: »Wie lange?«
»Das hängt vom Internationalen Roten Kreuz ab. Davon, wann wie viele Häuser geliefert werden.«
»Was zahlt ihr?«
»Fünfhundert Birr am Tag.«
»Verpflegung?«
»Wir tun, was wir können. Wirst du da sein?«
»Ja.« Er will sich erst morgen endgültig entscheiden, aber das sagt er dem Anrufer nicht.
»Dann bis Donnerstag.«
Mit dem Telefon in der Hand bleibt er stehen. Er wird Fertighäuser für Flüchtlingsunterkünfte zusammenbauen. Für Menschen, die in ihrem eigenen Land auf der Flucht sind. Immerhin wird er doppelt so viel verdienen wie bei seinem letzten Job vor fünf Monaten. Fünfhundert Birr am Tag sind etwa zehn Euro. Früher hat Adane in manchen Monaten dreihundert Euro Trinkgeld von deutschen Touristen bekommen. Zusätzlich zu seinem Verdienst. Dann kam die Seuche. Und später der Krieg. Niemand weiß, ob je wieder Touristen in dieses Land kommen. Dieser verdammte Krieg.
Er hört die Stimmen der Kinder, ohne zu verstehen, was sie sagen. Immerhin haben sie ihr Zuhause noch. Er wagt nicht, sich vorzustellen, dass der Krieg auch zu ihnen kommen könnte. Dass er mit den Kindern dann das Zuhause verlassen muss, das er mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Das stabilste Haus in der Straße. Wie es sich gehört für jemanden, der das Bauen in Deutschland gelernt hat. Er gestattet sich einen flüchtigen Gedanken an das Land, in dem er viele Jahre ruhig und sicher gelebt hat. Und noch immer leben könnte. In der Nähe seiner leiblichen Kinder. Er hat sich für seine Heimat entschieden. Die Frage, ob er seine Entscheidung bereut, hat er sich nie gestellt und stellt sie sich auch jetzt nicht. Er braucht seine Kraft für die Gegenwart. Er wird wieder alles organisieren müssen. Vollmachten erteilen, Telefonlisten aktualisieren. Alles vorbereiten für den Fall der Fälle.
Vor vier Wochen sollte er diesen Auftrag schon einmal antreten. In letzter Minute rief der Mann aus Addis an und sagte, es sei zu unsicher und sie würden noch warten. Später fand Adane heraus, dass sich nicht genug Verzweifelte gefunden hatten, die im Kriegsgebiet arbeiten wollten. Adane war erleichtert, denn auch er hatte nicht fahren wollen. Aber er hätte den Job nicht ablehnen können. Es gab keine andere Arbeit und die Kinder hatten kaum mehr etwas zu essen.
Jetzt bauen sie Gemüse in ihrem Garten an: Zucchini, Tomaten, Salat und Kartoffeln. Doch bis zur Ernte dauert es noch eine Weile. Und sie können nicht nur von Gemüse leben.
Noch immer hat er sieben Nichten und Neffen zu ernähren. Früher waren es zwölf. Fünf hat er inzwischen in Ausbildung und an Universitäten gebracht. Jetzt sollen auch die letzten sieben wenigstens einen Schulabschluss erreichen. So lange muss er Geld verdienen.
So lange muss er am Leben bleiben.
Fayissa, der Jüngste, reißt ihn aus seinen Gedanken. »Onkel, kann ich bei den Nachbarn mit dem Hund spielen?«
»Natürlich, wenn sie nichts dagegen haben.« Adane beugt sich hinunter und streicht dem Jungen über die Wange. Er sieht ihm nach, als er durch das Tor hüpft, in Vorfreude auf die Nachbarskinder und ihren Hund.
Adane ist noch immer gerührt und stolz darauf, dass der Junge nach ihm benannt wurde. Nach dem Onkel, der in der Familie hohes Ansehen genießt, weil er nicht nur selbst gebildet ist und sogar in Europa studiert hat. Sondern vor allem, weil er einem Dutzend Kinder der Familie ebenfalls Bildung ermöglicht. Anfangs war die Familie nicht sicher, ob es richtig sei, die Kinder aus der Savanne zu holen, um sie zur Schule zu schicken. Jetzt ist seine Familie stolz auf ihn und ihre Kinder, die den Ehrgeiz des Onkels übernommen haben. Und glücklich sind in seinem Haus. Sie beschweren sich nicht einmal, wenn es wochenlang nur Gerste zu essen gibt.
Noch immer schaut Adane auf das Tor, durch das Fayissa vom Hof gehüpft ist. Der Junge weiß nicht, dass er nach seinem Onkel benannt wurde, denn er kennt ihn nur als Adane. Wie alle anderen. Doch vor mehr als sechs Jahrzehnten begann er sein eigenes Leben ebenfalls mit dem Namen Fayissa. Bevor er aus seiner Familie und seiner Savannenkindheit gerissen wurde und eine norwegische Nonne seinen Namen ins Amharische übersetzte.
Er ist nie zurückgekehrt; nicht zu seinem Namen, nicht in die Savanne. Eines Tages will er Fayissa davon erzählen. Wenn er dazu noch die Gelegenheit haben wird.
Savannenkind
Fayissa wünschte sich einen Hund. Einen Hund, den er streicheln und umarmen konnte und der ihm durch die Savanne folgte, so wie es die Hunde seiner Brüder taten. Dort, wo er lebte, bekamen kleine Jungen irgendwann einen Hund, der sie auf ihren Wegen durch die Savanne begleitete. Fayissas Familie gehörte zum Stamm der Borana. Die Boranas lebten als Nomaden im südlichen Äthiopien, nördlichen Kenia und manchmal im Sudan. Sie kümmerten sich von jeher um keine Grenze. Wenn es an der Zeit war, rissen sie ihre Hütten ab und errichteten sie an einem anderen Ort. Wichtig war Gras für die Ziegen, eine Wasserquelle nicht allzu weit weg vom Dorf und Reisig für den Bau der Hütten. Zu jener Zeit lebte die Familie in Äthiopien, aber das wusste Fayissa nicht. Er war zu jung, um schon einmal einen Umzug mitgemacht zu haben. Wie jung er war, wusste er ebenfalls nicht. Niemand in seinem Dorf wusste, wie alt er oder seine Kinder waren. Niemand schrieb es auf, denn niemand konnte schreiben. Geburtstage feierte man nicht, jeder Tag war ein Tag, an dem Leben gefeiert und geehrt wurde. Manchmal erinnerte man sich an eine Geburt, die kurz vor dem großen Regen stattgefunden hatte. Oder kurz danach? Es war nicht wichtig.
Die kleinen Kinder in der Savanne liefen so lange nackt herum, wie ihre Haut glatt war. Wenn sich erste Schamhaare zeigten, bekamen sie Kleidungsstücke. Wenn die Mädchen zu bluten begannen, waren sie alt genug, um zu heiraten. Wenn die Jungen ihr erstes Tier erlegten, taten sie einen großen Schritt auf dem Weg zum Mann. So wurde das Alter in der Savanne gemessen. Für ein Savannenkind gab es viele kleine Schritte auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Ein solcher Meilenstein war ein eigener Hund.
Die Tage in Fayissas Leben glichen sich. Zum Frühstück tranken er und seine Geschwister gemeinsam eine Tasse Milch. Seine Schwestern begannen mit Taju, der Mutter, das Tagwerk: Ziegen melken, Wasser holen, Wäsche waschen, Mais stampfen und zu Brei kochen – schließlich waren dreizehn Kinder zu versorgen. Seine größeren Brüder trieben die Ziegen auf die Weide. Nur die kleinsten Jungs hatten keine Pflichten. Sie verließen die Hütte der Familie in einer Formation von groß nach klein: Doyo, Wako und Fayissa. Mit dabei waren immer Doyo-Hund und Wako-Hund, wie sie zur Unterscheidung genannt wurden. Bloß Fayissa hatte keinen. Taju hatte auf seinen Wunsch bisher immer geantwortet: »Wenn du größer bist, bringt Vater einen Hund für dich mit.«
Deshalb erwartete Fayissa seinen Vater jedes Mal sehr ungeduldig, wenn dieser – oft nach Wochen oder Monaten – nach Hause kam. Sein Vater war nicht oft zu Hause, denn er hatte zwei weitere Frauen mit mehreren Kindern. Und wenn er nicht dort lebte, war er auf der Fora. So wurde die Zeit genannt, in der die Männer gemeinsam ihre Rinderherden in weit entfernte Gebiete trieben und dort unter freiem Himmel lebten, solange die Wiesen genug zu fressen für die Tiere boten.
Heute war alles anders. Fayissa und seine Brüder zogen am Morgen nicht los, denn seine Schwester Kabale heiratete und das ganze Dorf war in aufgeregter Vorfreude beschäftigt. Seit Tagen bereiteten die Dorfbewohner das große Fest vor. Die Männer hatten ein Rind geschlachtet und das Fell des Tiers zum Trocknen ausgelegt. Die Frauen stampften Mais, kochten Fleisch und rührten Milch für Joghurt und Frischkäse. Die Speisen füllten sie in feuchte Tontöpfe und stellten sie in schattige Erdlöcher unter Akazienbäumen.
Fayissa stand mit den anderen Kindern des Dorfes einige Meter entfernt von der Braut und bestaunte seine Schwester. Kabale saß in einem farbenfrohen neuen Kleid auf einem Stein. Mit schüchternem Blick ließ sie die Prozeduren der Frauen über sich ergehen, die sich hauptsächlich mit ihrer Frisur beschäftigten. Fayissa roch die Butter, mit der das Haar Kabales eingerieben wurde. Immer wieder zupften die Frauen an den Haaren, bändigten eine widerspenstige Strähne und strichen erneut Butter darauf. Dabei erinnerten sie sich singend an frühere Hochzeiten, ihre eigenen und die der anderen Frauen des Dorfes. Ihre Lieder priesen das künftige Paar und wünschten ihm viele Kinder. Für die Braut erhofften sie viele Söhne. Frauen vom Volk der Borana wünschten sich viele Söhne, denn mit jedem männlichen Nachkommen stieg ihr Ansehen in der Gemeinschaft. Männer hingegen wünschten sich Mädchen, die sie gegen Rinder eintauschten, sobald sie alt genug zum Heiraten waren.
Halake, der Bräutigam, und sein Vater kamen mittags mit einer Rinderherde. Vor Monaten hatten sie die Familie zum ersten Mal besucht, weil Halake Kabale zur Frau nehmen wollte. Nachdem Kabales Vater herausgefunden hatte, dass es in der Familie des jungen Mannes keinen Feigling und keinen Lügner gab, hatte er weiteren Gesprächen zugestimmt. So waren der Bräutigam und sein Vater immer wieder gekommen, hatten Tücher für die Frauen und Kaffeebohnen für die ganze Familie mitgebracht, um die Stimmung bei den Verhandlungen zu heben. Die fanden nur dann statt, wenn der Vater zu Hause war, denn er entschied.
Die Erwachsenen hatten Milch und Kaffee getrunken, Buluk, in Milch gekochten Maisbrei, gegessen und dabei über den Zeitpunkt der Hochzeit gesprochen. Und über die Menge der Rinder, die Kabales Vater für seine Tochter erhalten würde. Geeinigt hatte man sich auf zwei Stock, zweihundert Tiere, mit denen sie jetzt ins Dorf kamen.
Heute wurden Halake und sein Vater mit Verneigungen und Kaffee begrüßt. Taju erzählte ihrem zukünftigen Schwiegersohn davon, wie Kabale sich um ihre kleinen Geschwister kümmerte und auch sonst alles gelernt hatte, was eine Frau können musste: Tiere versorgen, kochen, waschen, Hütten bauen. Bei all diesen Arbeiten stellte Kabale sich geschickt an und Taju war sehr stolz auf ihre Tochter. Das Ritual verlangte nach dem Gespräch mit der Brautmutter eines mit ihrem Vater, der seinen zukünftigen Schwiegersohn bat, seine Tochter immer gut zu behandeln. Bei alledem wurden wie immer Kaffee und Milch getrunken.
Fayissa, der mit seinen Geschwistern am Eingang der Hütte stand, wurde müde von den langen Ritualen. Endlich, als er schon meinte, die Hochzeit würde nie stattfinden, erhob sich die Gesellschaft und begab sich zu einem eigens für diesen Tag hergerichteten Platz. Das aufgeregte Wispern, das den ganzen Tag in der Luft gelegen hatte, verstummte, als der Vater kurz vor Einbruch der Dämmerung Kabales Hand in die Hand ihres Mannes Halake legte.
Von nun an war sie seine Frau. Von nun an würde sie nicht mehr in ihrer Familie leben. Sie würde in Halakes Dorf ziehen, Kinder bekommen und ein neues Leben beginnen. Ihr Lächeln, das am Vormittag noch zögernd gewesen war, wandelte sich zu einem echten Strahlen und sie war das, was sie sein sollte: Die schönste Frau des Tages, die von allen die meiste Aufmerksamkeit bekam.
So wollte Fayissa sie in Erinnerung behalten, der sich nicht vorstellen konnte, dass Kabale am nächsten Tag nicht mehr bei ihnen sein würde. Sie würde ihm morgens nicht mehr die Milch reichen und abends nicht den Maisbrei bereiten, wie sie es oft getan hatte, wenn Taju mit anderen Dingen beschäftigt war. Wer würde das jetzt für ihn tun?
Bis weit in die Nacht sangen und tanzten die Frauen um sie herum. Fayissa kauerte sich auf den Boden inmitten der Tanzenden und schloss die Augen. Er war es gewohnt, bei Einbruch der Dunkelheit zu schlafen, nicht selten fand seine Mutter ihn nach langen Tagen in der Savanne schlafend unter einer Akazie. Dann trug sie ihn in die Hütte, wo er sich ein Lager aus Tierfellen mit seinen Brüdern teilte. Die Mädchen schliefen auf dem Bett daneben. Als kleinster wurde Fayissa in der Mitte platziert, umgeben von der Wärme seiner Brüder, und Taju deckte sie mit einer Decke zu. An diesem Abend jedoch war der Gesang der Frauen seine Decke und bot Geborgenheit für einen ruhigen Schlaf.
Die Frauen besangen Waka, den Schöpfer aller Lebewesen. Sie dankten ihm für die Gesundheit der Tiere und der Familie und baten um ein langes und erfülltes Leben für das frischvermählte Paar.
Fayissa erwachte noch einmal kurz, als seine Mutter ihn zum Lager trug. Eingehüllt in den Geruch seiner Mutter sowie den von Feuer, Butter und Essen öffnete er für einen Moment seine Augen und sah das Brautpaar in die Hütte schlüpfen, die für diesen Anlass gebaut worden war.
Am nächsten Morgen verließ Kabale die Familie. Fayissa sah Tränen in den Augen seiner Mutter, doch als er sie danach fragte, sagte sie, es sei nichts. Auch Fayissas Augen füllten sich mit Tränen, doch er zwinkerte sie fort. Wenn seine Mutter nicht weinte, wollte er auch tapfer sein.
Wenige Tage später machte sich auch sein Vater wieder auf den Weg. Es würde Monate dauern, ehe er zurückkam. Vielleicht war Fayissa dann groß genug für einen Hund.
Nach der folgenden Regenzeit wechselte Fayissas Bruder Doyo in die Gruppe jener Jungen, die ihre Tage nicht mehr mit absichtslosem Spiel verbrachten. Er suchte nun tagtäglich mit den Ziegen die nahegelegenen Grasflecken auf, begleitet von seinem Hund. Es blieben Wako, Wako-Hund und Fayissa, die morgens die Hütte verließen, um den Tag mit der Jagd nach Schmetterlingen, Eidechsen und Vögeln oder dem Beobachten größerer Tiere zu verbringen.
Wako hatte sich schnell daran gewöhnt, jetzt der Anführer zu sein. Er bestimmte die Richtung und Fayissa folgte ihm. Manchmal trafen sie auf Löwen oder Geparde, hauptsächlich aber zogen Antilopen, Giraffen und Zebras in größeren Gruppen an ihnen vorbei. Die Jungen hatten sich Stöcke gesucht, die sie mit beiden Händen an den Enden anfassten und quer hinter ihren Schultern trugen – so wie es die Erwachsenen taten. Manchmal ließen sie sich unter einer Akazie nieder, deren Schirme den einzigen Schatten in der sengenden Hitze der Savanne spendeten.
Fayissa lehnte sich mit dem Rücken an den Stamm eines Baumes, sah nach oben in das Glitzern der Sonne zwischen den Blättern und dachte an Kabale, die weit weg unter derselben Sonne ein neues Leben begonnen hatte. Und an seinen Vater, der auf der Fora war oder bei seinen Geschwistern von anderen Müttern, die in anderen Dörfern lebten. Und daran, dass er selbst eines Tages auf die Fora gehen würde. Wenn er groß war.
Wako näherte sich ihm ohne seinen Stock, dafür mit einem Tier in seinen Händen. »Schau, ich habe eine Eidechse gefangen.«
Vorsichtig hielt er Fayissa das sich windende Reptil entgegen. Wako-Hund tänzelte aufgeregt herum, als erwartete er eine Mahlzeit für sich. Fayissa tat das zitternde Tier leid, das Wakos festem Griff nicht entkommen konnte.
»Lass sie frei«, bat er und weil sein Bruder nicht zu hören schien, versetzte Fayissa ihm einen Schubs. In der Abwehr des Stoßes lockerte sich der Druck von Wakos Fingern. Die Eidechse entschlüpfte und schoss blitzschnell den Stamm der Akazie hinauf. Wako und Wako-Hund sahen ihr enttäuscht nach. Fayissa lächelte zufrieden.
Missgestimmt verließ Wako den schattigen Platz. Die Savanne ist weit und flach und Fayissa beobachtete den Weg seines Bruders in Richtung eines Wasserlochs. Erst später folgte er Wako, weil er Durst hatte.
Ein Geier kreischte, die Blätter der vereinzelt stehenden Akazien wisperten im Wind und im dürren, braunen Gesträuch am Boden raschelten Eidechsen oder Schlangen. Das waren gewohnte Töne, doch plötzlich schob sich ein anderes, weniger vertrautes Geräusch dazu. Fayissa brauchte eine Weile, ehe er es verstand. Ein Seufzen, ein schweres Atmen, ein gequältes Schnurren? Fayissa blieb stehen und lauschte, doch so sehr er sich konzentrierte, er konnte es nicht mehr hören. Vielleicht hatte er sich geirrt. Der Geier kreiste noch immer über ihm. Gab es hier ein gerade sterbendes Tier? Manchmal stürzten sich die Geier auf eine Antilope oder Giraffe, die den Löwen oder der Hitze erlegen waren. Heute waren Fayissa und Wako auf kein totes Tier gestoßen, aber der Geier hatte aus der Luft den besseren Überblick.
Wieder hörte Fayissa das Seufzen. Er schien ihm näher gekommen zu sein. Erneut hielt er inne, lauschte, sah sich um. Bewegte sich fünf Schritte weiter – das Geräusch wurde leiser. Er ging zurück, blieb stehen und musterte mit zusammengekniffenen Augen aufmerksam die Gegend. Da sah er es: Ein kleines Knäuel mit goldgelbem Fell und schwarzen Flecken, das vor dem grau-braunen Gesträuch kaum zu erkennen war. Vorsichtig näherte er sich. Jetzt erkannte Fayissa, dass es ein Gepardenbaby war. Es machte keine Anstalten wegzulaufen. Fayissa blieb im Abstand von einigen Metern stehen, denn die Mutter dieses Tieres würde sich auf jeden stürzen, der ihm zu nahekäme. Doch weit und breit gab es keine Anzeichen für ein Muttertier. Wachsam beobachtete er seine Umgebung und schlich näher. Das arme Tier wirkte vollkommen geschwächt und zitterte. Hatte es Angst? Womöglich sogar vor ihm? Aber die Augen des Babys schienen zu sagen: »Hilf mir.«
Auf keinen Fall konnte Fayissa das Baby allein lassen. Beruhigend murmelte er auf den Gepard ein, ohne sich ihm weiter zu nähern. »Schschsch.« Minutenlang starrten sie einander an. Lag das Kleine im Sterben? Kreiste deshalb der Geier über ihnen, im Vorgefühl einer Mahlzeit? Ahnte das Baby seinen bevorstehenden Tod? Jedenfalls wandte es seinen Blick nicht von Fayissa. »Hilf mir, hilf mir.«
»Schschsch. Ganz ruhig. Ich bleibe hier.«
Noch immer war keine Gepardenmutter zu sehen und auch der Geier war verschwunden. Fayissa setzte sich in gebührendem Abstand im Schneidersitz zu dem Tier. »Ich bin Fayissa. Ich wohne dort.« Er zeigte mit dem Finger zunächst auf sich selbst, dann in die Richtung seines Dorfes. Von hier aus wirkten die Hütten klein. Der Gepard schaute ihn verstehend an. Und so erzählte Fayissa ihm von seiner Mutter, seinen Geschwistern, von Wako und der Eidechse und von seinem Vater. Normalerweise redete Fayissa nicht viel, aber während er sprach, ließ das Zittern des Gepards nach. Also redete Fayissa weiter, bis sich seine pelzige Zunge immer schwerer bewegte. Durst hatte ihn auf den Weg gebracht, doch den hatte er völlig vergessen. Auch das Tier würde Durst haben, die Sonne schien erbarmungslos nieder und die dürren Sträucher boten nur wenig Schutz. Wie konnte er Wasser holen? Er war wie immer nackt und hatte bloß seinen Stock dabei. Es blieben nur seine Hände. Er stand auf. »Ich komme wieder und bringe dir Wasser.«
Nach einigen Schritten drehte er sich um, schaute dem schwer atmenden Gepard noch einmal in die Augen und war sich ganz sicher: Das Kleine hatte Vertrauen zu ihm. So schnell er konnte, rannte er zum Wasserloch. Sein Bruder war längst fort, wahrscheinlich ins Dorf zurückgekehrt. Fayissa trank ein paar Handvoll und trug dann mit seinen Händen Wasser zu dem Baby, das dankbar und gierig die wenigen Tropfen, die Fayissa auf dem Rückweg hatte bewahren können, von seinen Fingern leckte. Fayissa rannte noch zwei weitere Male zum Wasserloch und brachte jedes Mal ein paar kostbare Tropfen des rettenden Wassers mit. Nachdem das Baby getrunken hatte, wirkte es nicht mehr so matt wie zuvor. Fayissa wagte sogar, es zu streicheln, und schlang schließlich seine Arme um das kleine Tier. »Schschsch.«
Offensichtlich hatte die Gepardenmutter ihr Kind schon aufgegeben oder war selbst gestorben. Fayissa blieb mit dem Baby bis zur Dämmerung sitzen. Dann schlief er ein, müde von der Aufregung des Tages und seinen Wegen zum Wasserloch. Er erwachte erst, als Taju seine Arme vom Gepard löste, um ihn nach Hause zu bringen. Doch er legte seine Arme wieder um das Tier. »Wir müssen ihn mitnehmen. Ich habe ihm zu trinken gebracht und es geht ihm schon besser. Er darf nicht sterben. Er braucht etwas zu essen.« Von seinem eigenen Hunger sprach Fayissa nicht.
»Wir können ihn nicht mitnehmen. Er ist gefährlich.«
»Wenn wir ihn hierlassen, stirbt er. Das darf nicht sein.« Er bemerkte ihr Zögern und fügte hinzu: »Ich werde mich auch immer um ihn kümmern.«
Fayissa legte all seine Sehnsucht nach einem eigenen Tier in den Blick.
»Und du wirst wirklich immer für ihn sorgen?«
Er nickte nachdrücklich. Seufzend nahm Taju das Gepardenjunge auf den Arm und trug es nach Hause, während Fayissa, jetzt hellwach und aufgeregt plappernd, neben ihr nach Hause hüpfte. Sie nannten den Gepard Butschu und fortan wollte Fayissa keinen Hund mehr.
Wieder verging eine Regenzeit, der Vater war fortgegangen und zurückgekommen. Wenn Fayissa jetzt morgens mit Wako aufbrach, folgte ihm Butschu. Fayissa hatte Wort gehalten und sich um den Gepard gekümmert, ihn gefüttert und erzogen. Unter dieser Fürsorge hatte er sich zu einem stattlichen Tier entwickelt und war Fayissa ein dankbarer, treuer Freund und der Familie ein Haustier geworden.
An diesem Tag störte ein Brummen die Stille der Savanne. Fayissa und Wako suchten mit Blicken die Gegend ab und sahen einen Wagen, der eine Staubwolke hinter sich herzog. Obwohl dieser Wagen nicht von Eseln gezogen wurde, war er schneller als die üblichen zweirädrigen Holzwagen, mit denen Waren auf den Markt gebracht wurden. Die Staubwolke senkte sich im Dorf. Fayissa und Wako, gefolgt von ihren Tieren, liefen dorthin, um sich den Wagen aus der Nähe anzusehen. Gemeinsam mit den anderen Kindern des Dorfes bildeten sie einen ehrfürchtigen Kreis um die geheimnisvolle Maschine, die sich ohne tierische Hilfe bewegte. Unter einer Staubschicht glänzte es weiß und die Räder waren größer als alle, die Fayissa je gesehen hatte. Einer der Jungen kletterte vorsichtig auf die Ladefläche des Autos. Die anderen folgten – im Nu war das Auto voll von Kindern. »Hier kann man viel Getreide transportieren!«
»Und Holz!«
»Und Tiere!«
»So ein Quatsch – Tiere laufen doch selber.«
Die Kinder strichen über die glänzenden Oberflächen, lachten und kicherten und konnten nicht verbergen, dass sie nicht nur vollkommen fasziniert, sondern auch ratlos waren: Wo kam dieses Gefährt her? Wozu brauchte man es? Wer transportierte so viel Mais oder Getreide? Die Boranas aus dem Dorf beluden ihre Esel, wenn sie auf den Markt im Nachbardorf gingen und ließen diese die Last tragen. Mehr als ein Esel tragen konnte, hatten sie ohnehin nicht. Nur einige reichere Händler verkauften Waren von zweirädrigen Holzwagen, vor die Esel oder Pferde gespannt wurden. Doch ein Gefährt, das nicht von Tieren gezogen wurde, hatte noch niemand gesehen. Fayissa schaute durch die Glasscheibe in das Führerhaus. Dort musste das Geheimnis des selbstfahrenden Wagens liegen. Er sah Hebel und Knöpfe, ein Lenkrad und drei Sitze. Er beschloss, dortzubleiben, bis das Fahrzeug wieder abfuhr, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Ein Junge begann zu hüpfen und versetzte das Auto in leichtes Schaukeln. Die anderen Kinder nahmen die Bewegung auf, anfangs vorsichtig und leise, aber zunehmend lachend und mit lautem Getrampel. Sie hatten sich eine Schaukel geschaffen und hüpften übermütig auf der Ladefläche. Ihr Spiel wurde jäh unterbrochen, als eine fremde Frauenstimme rief: »Genug gespielt. Runter von meinem Auto.«
Die Fremde trug ein langes, grau-weißes Gewand, ihr Haar war von einer Haube bedeckt, nur an Gesicht und Händen war ihre Haut sichtbar. Weiße Haut. Mit gesenkten Köpfen und leise tuschelnd kletterten die Kinder vom Wagen.
»Hast du gesehen, sie ist ganz weiß.«
»Und sie spricht eigenartig.«
Tatsächlich hörte sich ihre Aussprache merkwürdig an. Die Bedeutung ihrer Worte war jedoch völlig klar. Sie sollten von dem Auto verschwinden. Die Kinder zerstreuten sich – einige zogen sich zurück in die Savanne, andere – wie Fayissa – blieben in der Nähe des Autos unter Bäumen sitzen.
Die Frau bewegte sich zur Hütte seiner Eltern, vor der sein Vater auf einem Stein saß. Sie nahm neben ihm Platz und sprach mit ihm, als sei es das Normalste von der Welt. Fayissa war verwirrt. Eine weiße Frau, die mitten am Tag mit einem Mann plauderte? Frauen hatten doch für so etwas keine Zeit. Kannte sein Vater diese Frau? Was wollte sie? Fayissa schlich ihr nach und ließ sich einige Meter von den Erwachsenen entfernt nieder. Sie sprach langsam mit seinem Vater, als überlegte sie jeden Satz zwei Mal, bevor sie ihn aussprach. Ihr Akzent klang jetzt noch stärker und Fayissa verstand nur Bruchstücke des Gesprächs. Sein Vater nickte manchmal, doch häufiger schüttelte er den Kopf oder zog skeptisch eine Augenbraue hoch. Die Frau sagte etwas von Bildung und einem besseren Leben, das mit Bildung zu erreichen sei. Ein besseres Leben? Ein anderes Leben?
»Hast du das gehört?«, fragte Fayissa Wako, der sich inzwischen neben ihm niedergelassen hatte. Seit Fayissa Butschu das Leben gerettet und ihn zu seinem Gefährten gemacht hatte, ließ Wako nicht mehr ständig heraushängen, dass er der Größere und Ältere war.
»Was?«
»Sie redet über Bildung und ein besseres Leben.«
»Wozu soll das gut sein? Wir haben ein gutes Leben«, antwortete Wako gelangweilt. Er erhob sich und ging fort.
Fayissa blieb sitzen und hörte seinen Vater zu der weißen Frau sagen: »Den dürren Nichtsnutz könnt ihr haben.«
Dabei zeigte sein Vater mit dem Finger in seine Richtung. Aber Fayissa brachte die beiden Dinge nicht zusammen – den ausgestreckten Finger und den Satz über den dürren Nichtsnutz. Erst später würde er dieser Bemerkung Bedeutung beimessen, ihr Ausmaß begreifen. Er blieb sitzen, kuschelte sich an Butschu und beobachtete weiter die Erwachsenen.
»Wie heißt er?«, fragte die Weiße.
»Fayissa.«
»Jemand, der heilt?«
»Ja.«
»Adane auf Amharisch. So werden wir ihn nennen. Mit einem amharischen Namen wird er es leichter haben.«
Sein Vater rief nach der Mutter, zu dritt sprachen sie weiter miteinander. Fayissa verstand nur einzelne Worte: Schule, Mitnehmen, Internat, gutes Leben. Taju schüttelte mehrfach heftig den Kopf und widersprach laut, was sonst selten geschah. Später würde Fayissa sich oft fragen, warum er nicht weggelaufen war. Warum er sich nicht mit Butschu irgendwo in der Savanne versteckt hatte, bis die weiße Frau wieder abgefahren war. Er tat es nicht, weil er sich nicht vorstellen konnte, was als Nächstes geschah. Nach langen Diskussionen zwischen den Erwachsenen setzte Taju sich zu ihm und wiederholte all die Worte, die er schon aufgeschnappt hatte. Jetzt erst begann Fayissa zu verstehen. Sein Vater hatte tatsächlich ihn gemeint, als er von dem dürren Nichtsnutz sprach. Die Weiße war eine Nonne und eine Lehrerin, sie wollte ihn mitnehmen in ihre Schule, in der es weitere Lehrerinnen gab und Jungen in seinem Alter. Dort sollte er wohnen und lernen, damit er später einmal ein besseres Leben haben würde. Fayissa schüttelte den Kopf, doch Taju redete ihm weiter gut zu. Er hielt sich an Butschu fest und schrie: »Nein!« Zuerst trotzig, doch zunehmend verzweifelt und schließlich nur noch schluchzend. Die Entscheidung war längst gefallen, das sah Fayissa an dem traurigen Blick seiner Mutter. Er klammerte sich fester an Butschu, als könnte der ihn retten. Seine Mutter legte einen Arm um seine Schulter und wiegte ihn in ihren Armen. »Es wird dir dort gefallen. Und du wirst uns besuchen kommen. Aber nun musst du dich verabschieden.«
Sie reichte ihm die Hand, gemeinsam standen sie auf. Vor seinem Vater hörte er auf zu weinen. Vielleicht aus Trotz, vielleicht aus Respekt. So genau wusste Fayissa es nicht. Der Vater legte ihm nur kurz die Hand auf die Schulter und verschwand hinter der Hütte.
Die weiße Frau stand einige Meter weiter weg und lächelte. Ihr Lächeln sollte ihn wohl ermutigen, aber Fayissa mochte das Lächeln nicht. Er mochte die Frau nicht und griff nach Tajus Hand. Die Mutter blieb dicht bei ihm, während er alle seine Geschwister und ihre Hunde umarmte. Zuletzt drückte er Butschu, der ihm zärtlich und vertraut das Gesicht und die Hände ableckte. Fayissa klammerte sich an ihn, als könnte er so das Unvermeidliche aufhalten. Seine Mutter stimmte ein Lied an. Ihre Stimme zitterte, aber sie blickte Fayissa aufmunternd an.
Die weiße Frau verlor schließlich die Geduld. Wenn sie noch vor Einbruch der Dunkelheit ankommen wollten, müssten sie jetzt losfahren. „Steig ins Auto“, befahl sie, doch Fayissa schüttelte den Kopf. Kurzerhand nahm sie ihn auf den Arm und trug ihn zum Auto. Taju sang lauter und Fayissas Schwestern stimmten ein.
Wieder weinte er und sah die neidischen Blicke der anderen Kinder nur verschwommen. Er durfte mit dem Wagen fahren, der sich von allein bewegte, aber es interessierte ihn nicht mehr. Die weiße Frau ließ sich nicht beirren, setzte ihn in das Auto und warf die Tür zu. Fayissa versuchte, sie wieder zu öffnen, aber es gelang ihm nicht. So starrte er durch die Scheibe seine Mutter an und sah in ihren Augen Tränen. Er erinnerte sich an den Morgen nach Kabales Hochzeit und die Tränen in ihrem Auge. »Es ist nichts«, hatte sie gesagt. Doch das stimmte nicht, damals nicht und jetzt nicht, das sah Fayissa deutlich. Taju war genauso unglücklich wie er. Warum tat sie nichts? Der Vater hatte entschieden und Taju und Fayissa blickten einander nur traurig an.
Die weiße Frau schob einen Schlüssel in eine Öffnung und drehte ihn. Plötzlich erkannte Fayissa das Brummen wieder, das ihn Stunden zuvor auf das Auto aufmerksam gemacht hatte, das sich jetzt in Bewegung setzte. Für einen Moment hörte Fayissa auf zu schluchzen, und starrte die weiße Frau an, die ein Auto in Bewegung setzen konnte. Was würde sie noch tun? Doch dann sah er wieder aus dem Fenster und weinte laut, während Taju und seine Geschwister immer kleiner wurden. Butschu lief neben dem Auto her. Fayissa presste Gesicht und Hand an die Scheibe. Konnte Butschu ihn retten? Doch weil Fayissa ihn nur durch Tränen hindurch anstarrte, gab Butschu auf. Durch das hintere Fenster sah Fayissa auch ihn immer kleiner werden. Flüsternd verabschiedete er sich von Butschu, den Giraffen, Zebras und Löwen, mit denen er sein Leben bisher verbracht hatte. Würde er das alles je wiedersehen?
Unter Nonnen
Die Stadt Yabelo lag nur etwa achtzig Kilometer von Fayissas Heimatdorf entfernt, doch für Fayissa wurde es eine beschwerliche Reise ans Ende der Welt. In der Savanne gab es keine Straßen und der Geländewagen holperte eine Ewigkeit über staubige Wege. Fayissas Tränen trockneten und spannten als trockene Schmutzspuren auf seiner Haut, während er aus dem Fenster sah und versuchte, sich den Weg einzuprägen. Doch nachdem sie mehrere Dörfer durchquert hatten, die seinem Heimatdorf ähnelten, gab er auf. Er würde nie wieder nach Hause finden. Er wäre für immer dieser Frau ausgeliefert, die sich inzwischen als Schwester Malina vorgestellt hatte. »Deine Eltern haben dich Fayissa genannt, stimmts?«
Er kniff die Lippen zusammen. Wenn sie wusste, wie er hieß, musste er nicht antworten.
»Wir werden dich Adane nennen. Es bedeutet dasselbe. Auf amharisch. In der Schule wird nur amharisch gesprochen. Und englisch. Du wirst das alles sehr schnell lernen. Ebenso wie lesen und schreiben.«
Fayissa sah aus dem Seitenfenster. Ich heiße Fayissa, flüsterte er lautlos gegen die Scheibe.
»In der Schule gibt es noch andere Jungs. Es wird dir gefallen. Und du wirst Jesus Christus kennenlernen, dem wir alles verdanken.«
Woher konnte sie wissen, was ihm gefiel? Er wollte keine anderen Kinder kennenlernen. Schon jetzt sehnte er sich nach seinen Geschwistern, nach Butschu und nach Taju. Mit der Frau, die ihn dort weggerissen hatte, würde er jedenfalls nicht sprechen. Er hatte Mühe, seine Augen offen zu halten und erst, als sie ihm eine Wasserflasche reichte, bemerkte er seinen Durst. Er bedankte sich und trank gierig. Dann schlief er gegen seinen Willen ein.
Er erwachte, als Schwester Malina leicht an seiner Schulter rüttelte. »Adane, wach auf. Wir sind da.«
Verwirrt sah er sich um. Draußen herrschte die kurze Stunde der Dämmerung, die sich rasch in Dunkelheit wandelte und in der er zu Hause oft von seiner Mutter gefunden wurde, wenn er mitten im Spiel in der Savanne eingeschlafen war. Erst beim Anblick der weißen Frau fiel ihm alles wieder ein: sein Vater, der ihn einen dünnen Nichtsnutz genannt hatte, der neue Name, die Abreise aus seinem Dorf, die holprige Fahrt. Hier war also das Ende der Welt.
Im letzten Licht des Tages sah Fayissa zwei weiße Häuser vor dem Auto aufragen: eckig, aus Stein, mit zwei Etagen und verglasten Fenstern. Dahinter stand ein rundes Gebäude, von dessen Dach aus sich ein Kreuz in die Höhe reckte. Eine kleinere Version des Kreuzes hatte Fayissa schon bei Schwester Malina gesehen, die es als Anhänger an einer Kette um den Hals trug. Vergeblich suchte Fayissa die Umgebung nach Hütten ab, in denen man schlafen konnte.
Schwester Malina stieg aus, kam um das Auto herum, öffnete auch seine Tür und bedeutete ihm auszusteigen. Er zögerte und krallte sich mit einer Hand am Autositz fest. Aus einem der Häuser trat eine weiße Frau, die genauso aussah wie Schwester Malina. Sie trug das gleiche grau-weiße Kleid, die gleiche Haube, die ihr Haar verdeckte und sogar die gleiche Kette mit dem Kreuz um den Hals. Nur ihr Gesicht war freundlicher, das sah Fayissa, als sie näherkam. Sie winkte ihm zu, ehe sie mit Schwester Malina in einer fremden Sprache einige Worte wechselte. Dann reichte sie ihm lächelnd die Hand und überschüttete ihn mit einem Schwall fremder Worte. Der Klang ihrer Stimme erinnerte ihn an seine Schwester Kabale. Er nahm ihre Hand, löste sich langsam vom Autositz und stieg aus.
»Bei Schwester Breta bist du in guten Händen«, sagte Schwester Malina. »Sie wird dir etwas zu essen geben, dich waschen und dir dein Bett zeigen.« Ihr Blick wanderte von Fayissa zu Schwester Breta und wieder zu ihm. »Mit ihr wirst du schnell amharisch lernen.«
Fayissa hielt sich an der Hand von Schwester Breta fest und nickte. Wenn er eine andere Sprache lernen musste, um sich mit der freundlichen Frau zu verständigen, dann würde er das tun. Gemeinsam betraten sie eines der beiden Häuser und liefen über einen langen Gang in ein Zimmer mit Tischen und Stühlen. Irgendwo im Haus lärmten Kinder. Fayissa zog die Schultern hoch und senkte den Kopf. Er wollte keine anderen Kinder treffen. Er hatte genug Freunde in seinem Dorf. Schwester Breta zeigte auf einen Stuhl und bedeutete ihm zu warten. Sie verließ den Raum und er sah sich um. An einer Wand hing das Kreuz, dem er heute schon häufiger begegnet war. Von der Wand gegenüber blickte ein weißer Mann mit langen Haaren und gefalteten Händen auf ihn herunter. Er sah ihn direkt an. Unheimlich. Fayissa legte sich die flachen Hände auf die Augen und öffnete einen kleinen Schlitz zwischen zwei Fingern, durch den er vorsichtig zu dem Mann an der Wand spähte. Der schaute ihn immer noch an und Fayissa schloss die Finger wieder. Wer war dieser Mann? Warum beobachtete er ihn? Fayissa nahm die Hände erst von den Augen, als er Schwester Breta zurückkommen hörte. Sie stellte eine Tasse Tee und einen Teller vor ihn auf den Tisch. Er betrachtete das hellbraune Etwas mit einem dunklen Rand auf dem Teller. Breta zeigte darauf und sagte: »Brot.«
Dann führte sie eine Hand zum Mund, um ihm zu zeigen, dass er davon essen sollte. Er wiederholte »Brot« und schob sich ein Stück in den Mund. »Galatom«, murmelte er. Danke. In seiner Muttersprache. In Gedanken wiederholte er das Wort »Brot«, während sein Gaumen testete, ob er Brot mochte. Es war trocken und krümelig und schmeckte säuerlich-salzig. Fayissa kaute so lange, bis das Brot in seinem Mund zu Brei wurde. Er war sich noch immer nicht sicher, ob er es mochte, aber er war hungrig und schluckte alles hinunter. Irgendwo im Haus hörte er wieder Kinder rufen und lachen. Waren sie inzwischen nähergekommen? Hoffentlich nicht. Als Schwester Breta ihn mit einer Geste fragte, ob er ein zweites Stück Brot wollte, nickte er. Solange er hier mit ihr saß, fühlte er sich sicher.
Sie gab ihm ein zweites Stück Brot, sah ihm beim Essen zu und stellte Fragen, die er nicht verstand. Zum Zeichen, dass er zuhörte, nickte er vorsichtig. Sie lächelte ihm zu und strich ihm über den Kopf. Er hielt inne und wollte den Moment mit ihr in die Länge ziehen. Wenn er schon nicht bei seiner Mutter und seinen Geschwistern sein durfte, wollte er wenigstens so lange wie möglich mit Schwester Breta zusammen sein. Das letzte Stück Brot kaute er noch langsamer und den Tee trank er in kleinen Schlucken, bis es im Haus immer stiller wurde. Dann erst klopfte er mit einer Hand auf seinen Bauch – er war satt.
Breta nahm ihn an die Hand, führte ihn den Gang entlang und eine Treppe hinauf. Er klammerte sich an ihre Hand, ohne Schwester Breta würde er sich verlaufen. Sie redete die ganze Zeit leise und beruhigend auf ihn ein. Gemeinsam betraten sie einen Raum, in dem es dunkel war. Fayissa hörte ein Klicken und dann wurde der Raum erleuchtet. Er zeigte fragend auf das Licht. Sie nickte und berührte einen Schalter. Es klickte und das Licht erlosch. Es klickte wieder und es wurde hell. Jetzt erst wurde ihm bewusst, dass es überall im Haus hell war, obwohl nirgends Feuer zu sehen war. Hier gab es Licht, wenn man auf einen Knopf drückte. Vielleicht war hier gar nicht das Ende der Welt, sondern eine andere Welt? Eine Welt, in der es sogar drinnen regnete. Denn genau das geschah jetzt. Schwester Breta drehte an einem Knopf und dann kam von der Decke Wasser. Wie ein Regen. Fayissa stand außerhalb des Wasserkegels und rührte sich nicht. Er starrte erst das Wasser und dann Schwester Breta an. Sie drehte den Knopf wieder zurück. Der Regen stoppte. Sie drehte und wieder plätscherte es von der Decke. Aus. An. Aus. »Dusche«, sagte sie und zeigte nach oben, dorthin, wo das Wasser herkam. Fayissa wiederholte das Wort und streckte seine Hand dem Wasserhahn entgegen. Er wollte selbst Regen machen. Schwester Breta überließ ihm den Knopf. Als ihn die ersten Wasserstrahlen trafen, kniff er die Augen zusammen und zog die Schultern hoch. Doch das Wasser war warm und floss angenehm über seinen Körper. Langsam entspannte er sich und öffnete die Augen. Ein Haus, in dem es warmen Regen gab, das würde Wako ihm niemals glauben.
Schwester Breta schob die Ärmel ihres Kleides nach oben, hockte sich so hin, dass sie selbst nicht nass wurde, und winkte ihn zu sich. Mit einem Stück Seife schrubbte sie seinen Körper. Glitschig fuhr die Seife über Arme, Beine, Rücken und Bauch. Besonders am Bauch kitzelte es und er quietschte und lachte. Schwester Breta lächelte und zeigte auf die Schmutzbäche, die im Abfluss verschwanden. Fayissa sah dem Schmutzwasser nach. In diesem Haus gab es nicht nur Regen, es war auch dafür gesorgt, dass dieser keine Pfützen und keinen Schlamm hinterließ. Schwester Breta sah ihn zufrieden an und Fayissa reckte sich stolz zu seiner vollen Größe. Er hatte etwas richtig gemacht und war nun ganz sauber. Der Schmutz war fortgespült.
Sie gingen durch das Haus, in dem keine Kinder mehr zu hören waren. Schwester Breta flüsterte nur noch mit ihm. Vor einer Zimmertür blieb sie stehen und legte einen Finger an die Lippen. Jetzt trug sie ein Licht in ihrer Hand, auch dieses Licht war kein Feuer, sondern leuchtete aus einem kleinen Kästchen. Morgen wollte Fayissa sich das alles genauer ansehen. Er folgte Schwester Breta in das Zimmer, wo sie auf ein Bett wies. Die Merkwürdigkeiten nahmen kein Ende: Wieso hatten sie ein Bett auf ein anderes gestellt? Würde das nicht hinunterfallen? Fragend sah er zu Breta, die beruhigend nickte und auf das untere Lager wies. Oben seufzte ein Kind im Schlaf und Fayissa dachte an zu Hause, an seine Geschwister und die Wärme, mit der sie ihn umgaben. Und an Taju, die ihnen am Abend ein Lied zum Einschlafen sang. Seine Augen füllten sich mit Tränen und er drückte sein Gesicht an Schwester Bretas Rock. Er wollte nicht in dieses Bett. Er wollte nach Hause. Breta löste sein Gesicht von ihrem Rock, kniete sich neben ihn und flüsterte ihm etwas zu. Er starrte sie an, als könnte er sie dann besser verstehen, aber es half nichts. Er verstand sie nicht, er war ganz allein, weit fort von allen, die er liebte. Diese Frau war eine Fremde, alles hier war fremd. So fremd, dass er nicht einmal wagte, laut zu weinen. Sie nahm ihn auf den Arm, flüsterte »Schschsch« und wiegte ihn, ehe sie ihn ins Bett legte und die Decke über ihn breitete. »Gute Nacht, Adane.«
Zögernd wiederholte er: »Gute Nacht? Adane?« Bei dem letzten Wort zeigte er auf sich.
Schwester Breta nickte und sagte noch einmal: »Gute Nacht.«
Fayissa begriff den Sinn ihrer Worte. Diese Frau war gut zu ihm, sie tat jetzt das, was sonst Taju getan hatte. Er fühlte sich getröstet. Der Trost und seine Müdigkeit schickten ihn sofort in einen tiefen Schlaf.
Nachdem Fayissa-Adane in die Welt des elektrischen Lichts, des fließenden Wassers und der amharischen Sprache eingetreten war und friedlich schlief, betrat er an diesem Abend ohne sein Zutun noch eine andere Welt. Die der Daten und Registrierungen, des Vermessen- und Gewogenwerdens. In dem zweiten Gebäude der Schule der Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Jesus saß Schwester Malina im Büro und trug ihren Neuzugang vom 30. August 1961 in ein Buch ein. Name, Vatersname, Name des Großvaters. So setzten sich hier die Namen der Kinder zusammen. Sie schrieb seinen amharischen Namen in das Buch. Bevor sie die Spalte Alter ausfüllte, zögerte sie. Mit Bleistift schrieb sie: Fünf und setzte ein Fragezeichen dahinter. Vielleicht war er gerade noch vier Jahre alt. Vielleicht schon knapp sechs. Auf alle Fälle war er alt genug, etwas zu lernen. Deshalb war Schwester Malina hier – um die Kinder zu nähren, zu bilden und zu Jesus Christus zu führen. Dieser Aufgabe hatten sie und ihre Mitschwestern sich verschrieben, dafür arbeiteten sie weit weg von ihrer norwegischen Heimat. Unermüdlich fuhren sie und andere Schwestern durch das Land, beseelt von dem Auftrag, Savannenkinder aus einem Leben in Armut und Wildnis zu retten. Tausende von Kindern führte die Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Jesus in den 1960er und 1970er Jahren in die moderne Welt der Bildung. Einer von ihnen war Adane Wondimu Hapthyimer.
Ein lautes Klopfen an der Zimmertür weckte Fayissa am nächsten Morgen. Vor der Tür rief eine Frauenstimme etwas. Fayissa verstand sie nicht. Blieb das jetzt immer so? Tageslicht drang durch einen Vorhang gefiltert ins Zimmer. Es war ein großes Fenster, wie Fayissa noch keines gesehen hatte. Zu Hause kam das Licht nur durch eine kleine Öffnung in die Hütte, in der es deshalb immer dunkel war. Und niemals würden bei seiner Familie zwei Betten übereinandergestapelt sein. Er starrte auf die Matratze über ihm, die sich auf das Gestell presste. Würde das nicht einstürzen?
Fayissa schaute sich im Zimmer um. In der Mitte stand ein Tisch mit vier Stühlen, neben der Tür ein Schrank und auf der anderen Seite ein weiteres doppeltes Bett, das unten leer war. Oben regte sich ein Körper, ein Junge setzte sich gähnend auf. Fayissa zog sich die Decke über den Kopf und spähte durch einen winzigen Spalt hinüber. Der Junge stieg auf einer Leiter von seinem Bett. Unten angekommen gähnte er mit weit offenem Mund und ließ dabei eine Lücke in der oberen Reihe seiner Zähne sehen. Auch Fayissas Bett knarrte und wackelte. Der Junge über ihm kletterte ebenfalls hinunter. Er hatte dichte, krause Locken auf dem Kopf. Die beiden trafen sich in der Mitte des Zimmers und warfen sich ein »Guten Morgen« zu. Beinahe hätte Fayissa ihren Gruß erwidert, denn sie sprachen in seiner Muttersprache miteinander. Mit einem Seufzen konnte er sich gerade noch zurückhalten und hoffte mit angehaltenem Atem, die Jungen würden ihn nicht bemerken. Doch der mit der Zahnlücke zeigte mit einer Bewegung seines Kinns auf Fayissas Bett. »Ein Neuer.«
»Ich habe nichts gehört. Du?«
»Es muss spät gewesen sein.«
»Lassen wir ihn. Er wird sich noch früh genug gewöhnen.«
Vorsichtig atmete Fayissa aus. Die Jungs zogen sich während ihrer Unterhaltung die gleichen roten kurzen Hosen und rot-braune Hemden an. Dabei waren sie gerade ein bisschen größer als Fayissa und mussten sich noch gar nicht bedecken. Aber wahrscheinlich galt auch das hier nicht. Würde er selbst ebenfalls solche Sachen bekommen? Als beide Jungen angezogen waren, stieß der mit der Zahnlücke den anderen in die Seite. »Bett machen.«
Der Lockenkopf antwortete mit einem resignierten »Pfh« und wandte sich dem Bett zu. Wieder ächzte und knarrte es. Auch der Zahnlückenjunge stieg noch einmal die Leiter hinauf, blieb auf einer oberen Sprosse stehen, beugte sich hinüber und zog und zerrte an seiner Decke, bis diese flach auf der Matratze lag. Zuletzt strich er sie mit der Hand glatt und kletterte hinab. Zur gleichen Zeit ächzte Fayissas Bett noch einmal, dann standen die beiden Jungen wieder in der Mitte des Zimmers.
»Frühstück?«
»Frühstück.«
Die Tür knarrte und klappte, Fayissa war allein. Er wartete einige Sekunden, ehe er seinen Kopf unter der Decke hervorstreckte. Vom Gang her schallten die Stimmen weiterer Kinder zu ihm. Ob da noch mehr Kinder dabei waren, die seine Sprache sprachen?
Kurze Zeit später stand eine Schwester im Zimmer. Im ersten Moment glaubte er, es sei Schwester Breta. Aber als sie den Mund öffnete, erkannte er Schwester Malina. Sie klatschte in die Hände und sagte: »Guten Morgen, Adane. Aufstehen. Mitkommen zum Messen und Wiegen.«
Adane? Fayissa. Er wäre gern liegengeblieben, doch er stand auf.
»Hier machen wir übrigens das Bett jeden Tag ordentlich. Heute zeige ich es dir und ab morgen machst du es selbst.« Sie nahm die Decke und schüttelte sie aus, ehe sie sie zurück auf das Bett legte. Offensichtlich tat sie das Gleiche wie vorhin der Junge, nur schneller und gründlicher. Ebenso wie er strich sie zuletzt mit der flachen Hand die Decke glatt.
Schwester Malina ging voraus und Fayissa hatte Mühe, mit ihr Schritt zu halten. Trotz der Dunkelheit gestern Abend war es angenehmer gewesen, diesen Flur an der Hand von Schwester Breta entlangzugehen. Rechts und links des Ganges waren Türen, eine von ihnen öffnete sich eben in dem Moment, in dem Fayissa vorbeiging. Er erhaschte einen Blick auf Doppelstockbetten und einen Tisch mit vier Stühlen. Das Zimmer sah aus wie das, in dem er geschlafen hatte. Zwei Jungen liefen aus dem Raum und stoppten vor Fayissa, der ihre mitleidigen und neugierigen Blicke auffing, ehe er die Augen niederschlug. Auch diese Jungs waren bekleidet und plötzlich war es Fayissa unangenehm, nackt zu sein. Schwester Malina sagte etwas zu den Kindern, das wie ein Befehl klang. Die Antwort der Jungs schien Zustimmung zu sein. Er hätte gern gewusst, ob diese Jungen auch seine Muttersprache konnten, aber er musste sich beeilen, um Schwester Malina nicht zu verlieren. Die war schon am Ende des Gangs angelangt und stieg die Treppe hinab. Fayissa folgte ihr. Irgendwo dort unten musste der Raum sein, in dem er gestern Abend gegessen hatte, denn er erinnerte sich daran, dass er mit Schwester Breta später die Treppe hinaufgegangen war. War es diese Treppe gewesen?
Unten roch es nach gekochter Milch und er hörte die lauten Stimmen vieler Kinder und das Klappern von Geschirr. Er hatte Hunger, doch Schwester Malina hatte offenbar andere Pläne, als ihn zum Frühstück zu bringen. Sie traten ins Freie. Er hatte die Häuser zwar gestern im Dämmerlicht schon gesehen, aber jetzt erst wurde ihm bewusst, dass hier auch die Zimmer übereinandergestapelt waren. Helle Mauern umschlossen zwei Reihen großer Fenster, diese Häuser waren aus anderem Material gebaut als die Hütten in seinem Dorf. Kein Reisig, kein Tierfell waren zum Bau dieses Hauses genutzt worden. Er würde sich das genauer ansehen. Später, wenn er nicht mehr hinter Schwester Malina hinterherlaufen musste. Denn kaum hatte sie sich vergewissert, dass er noch da war, eilte sie schon wieder voraus, zu dem anderen Gebäude. »Das ist unsere Schule, dort wirst du ab morgen lernen. So wie alle Kinder.«
Er nickte, aber Schwester Malina bemerkte das nicht. Es war keine Frage gewesen. Auch im zweiten Haus führte ein langer Gang durch das Untergeschoss und eine Treppe nach oben. Schwester Malina zeigte nach rechts, ohne auf ihrem Weg innezuhalten. »Unsere Klassenzimmer. Ich zeige dir morgen, in welches du gehen wirst.«