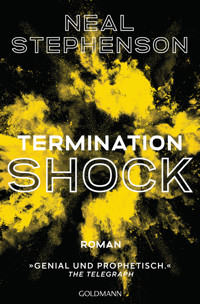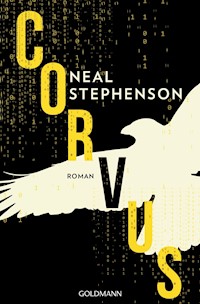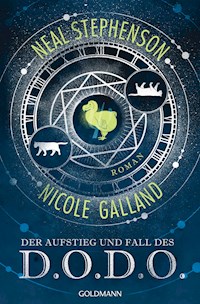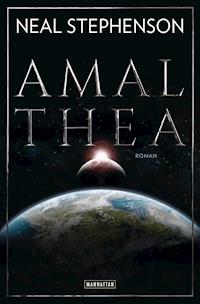14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Visionär und rasend schnell erzählt: Das zentrale Werk des Cyberpunks jetzt in neuer Übersetzung. Hiro Protagonist war mal Programmierer, aber seit auch hier die Konzerne alles gleichgeschaltet haben, zieht er jeden Bullshit-Job vor: Pizza-Auslieferer für die Mafia. Oder Information Broker für die ehemalige CIA. Wichtiger als die echte Welt ist für ihn ohnehin das Metaverse, ein virtueller Ort, an dem sich die Menschen mit ihren selbst gestalteten Avataren treffen. Dort begegnet er auch zum ersten Mal der Droge »Snow Crash«. Das Besondere: Snow Crash ist ein Computervirus, der auch Menschen befallen kann. Zusammen mit seiner Partnerin Y. T. ermittelt Hiro – und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die bis in die menschliche Vorgeschichte zurückreicht. Für Leser*innen von William Gibson, Richard Morgan und Fans von Cyberpunk 2077.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 789
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Neal Stephenson
Snow Crash
Roman
Über dieses Buch
Hiro Protagonist war mal Programmierer, aber seit auch hier die Konzerne alles gleichgeschaltet haben, zieht er jeden Bullshit-Job vor: Pizza-Auslieferer für die Mafia. Oder Information Broker für die ehemalige CIA.
Wichtiger als die echte Welt ist für ihn ohnehin das Metaverse, ein virtueller Ort, an dem sich die Menschen mit ihren selbst gestalteten Avataren treffen. Dort begegnet er auch zum ersten Mal der Droge »Snow Crash«. Das Besondere: Snow Crash ist ein Computervirus, der auch Menschen befallen kann. Zusammen mit seiner Partnerin Y. T. ermittelt Hiro – und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die bis in die menschliche Vorgeschichte zurückreicht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Über Neal Stephenson
Neal Stephenson studierte Physik und Geografie, bevor er sich als Schriftsteller und Technologie-Berater selbständig machte. Seit »Snow Crash« (1992) gilt Stephenson als einer der originellsten SF-Autoren, der für alle größeren SF-Preise nominiert war (und einige davon gewonnen hat). Er lebt und arbeitet in Seattle.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de oder www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Snow Crash« bei Bantam Books.
© 1992 Neal Stephenson
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Die Abbildungen in den Kapiteln 28 und 33 stammen aus »The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind« by Julian Jaynes. Copyright © 1976 Julian Jaynes. Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Houghton Mifflin Company.
Covergestaltung und -abbildung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Bildern von Adobestock/danielegay und knssr
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491338-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
Dank
Schnee, der …2. a. alles Schneeähnliche b. weiße Rasterpunkte auf einem Fernsehbildschirm, die auf gestörten Empfang zurückzuführen sind
Crash, der … 2. a. Zerbrechen oder Zerschellen … 3. jäher drastischer Rückgang, Börsencrash. … 4. b. plötzliche Störung eines Computerprogramms o. Betriebssystems.
American Heritage Dictionary
Virus, das o. der … [lat. virus schleimige Flüssigkeit, Gift, abstoßender Geruch o. Geschmack] 1. Gift, wie es ein giftiges Tier absondert. 2.Med.a. krankmachendes Prinzip o. giftige Substanz, insbesondere eine, die durch Impfung o. auf anderem Wege in den Körper von Tieren o. Menschen gelangen u. dort dieselbe Erkrankung auslösen kann. … 3.übertragen moralisches o. intellektuelles Gift; schädlicher Einfluss.
Oxford English Dictionary
1
Der Deliverator gehört einem Eliteorden an, einer geheiligten Subkategorie. Er ist motiviert bis in die Haarspitzen. Gerade bereitet er sich auf die dritte Mission des Abends vor. Seine Uniform ist schwarz wie Aktivkohle, so schwarz, dass sie das Licht förmlich aus der Luft saugt. Kugeln würden von dem Gewebe aus Arachnofasern abprallen wie ein Zaunkönig, der gegen eine Verandatür kracht, überschüssiger Schweiß jedoch weht sanft hindurch wie eine laue Brise durch einen frisch napalmbombardierten Wald. Dort, wo an seinem Körper Knochen hervorstehen, ist der Anzug mit gesintertem Panzergel gepolstert. Fühlt sich an wie grobkörniger Wackelpudding, schützt wie ein Stapel Telefonbücher.
Als er den Job bekam, gab man ihm eine Waffe. Der Deliverator wird niemals bar bezahlt, trotzdem könnte es jemand auf ihn abgesehen haben – auf sein Auto oder auf seine Ladung. Die Pistole ist winzig, stromlinienförmig, federleicht, eine Waffe, wie sie ein Modedesigner tragen würde. Sie feuert winzige Pfeile ab, fünfmal so schnell wie ein SR-71-Spionagejet, und wenn man sie benutzt hat, steckt man sie zum Aufladen in den Zigarettenanzünder, denn sie funktioniert elektrisch.
Der Deliverator zog diese Waffe nie aus Wut oder aus Angst. Zog sie überhaupt nur einmal. Ein paar Punks in Gila Highlands, einer dieser reichen Burbclaves, hatten sich was bestellt und wollten nicht dafür bezahlen. Dachten, sie könnten den Deliverator mit einem Baseballschläger beeindrucken. Doch der Deliverator zückte seine Waffe, zielte mit dem Laserding auf den erhobenen Schläger, einen Louisville Slugger, und drückte ab. Der Rückstoß war so gewaltig, als wäre das Teil in seiner Hand hochgegangen. Das mittlere Drittel des Baseballschlägers verwandelte sich in eine kurzlebige Säule aus brennenden Sägespänen, die in alle Richtungen davonstoben wie ein explodierender Stern. Danach hielt der Punk nur noch den verkohlten Griff in der Hand, darüber kräuselte sich milchiger Rauch in den Himmel. Glotzte dämlich aus der Wäsche. Hat nichts vom Deliverator bekommen außer Ärger.
Seitdem lässt der Deliverator die Pistole im Handschuhfach, verlässt sich stattdessen auf ein zusammengehöriges Paar Samuraischwerter, die ohnehin schon immer die Waffen seiner Wahl gewesen sind. Die Punks in Gila Highlands hatten keine Angst vor der Pistole, also war der Deliverator gezwungen gewesen, sie zu benutzen. Schwerter jedoch bedürfen keiner Vorführung.
In den Batterien seines Autos steckt genügend Energiepotenzial, um ein Pfund Speck in den Asteroidengürtel zu schießen. Doch im Gegensatz zu einer Mommybox oder einem Burbbeater entlädt das Auto des Deliverators seine Energie durch klaffende, funkelnde, glanzpolierte Schließmuskeln. Wenn er aufs Gas steigt, brennt die Luft. Willst du was über Kontaktflächen hören? Deine Reifen haben winzige Kontaktflächen, berühren den Asphalt an vier mickrigen Punkten, gerade mal so groß wie deine Zunge. Das Auto des Deliverators hat massige Haftreifen mit Kontaktflächen so lang und breit wie die Schenkel einer fetten Braut. Der Deliverator ist auf Tuchfühlung mit der Straße, geht derbe ab wie ’n echter Scheißtag, bremst so scharf wie ’ne Betonwand.
Warum ist der Deliverator so ausgestattet? Weil sich die Leute auf ihn verlassen. Er ist ein Vorbild. Das ist Amerika. Die Leute tun und lassen, was sie verdammt nochmal wollen. Hast du ’n Problem damit? Es ist nämlich ihr beschissenes Recht. Außerdem haben sie Waffen, und niemand kann sie aufhalten. Deshalb hat dieses Land eine der miesesten Volkswirtschaften der Welt. Denn letzten Endes – jedenfalls was die Handelsbilanz angeht – ist es doch so: Wenn erst einmal all unser technologisches Knowhow in andere Länder abgeflossen ist, wenn sich alles ausgeglichen hat, man in Bolivien Autos und in Tadschikistan Mikrowellen baut und sie hier bei uns verkauft, wenn unsere Überlegenheit bei den natürlichen Ressourcen völlig bedeutungslos geworden ist, weil gigantische Schiffe und Zeppeline aus Hongkong ganz North Dakota für ein paar Cent bis nach Neuseeland schleppen könnten, wenn die unsichtbare Hand erst einmal sämtliche historischen Ungleichheiten gepackt und sie in einer dicken Schicht von etwas, das ein pakistanischer Ziegelbrenner womöglich Wohlstand nennen würde, über den gesamten Erdball gekleistert hat – weißt du was? Dann gibt es nur noch vier Dinge, in denen wir besser sind als alle anderen:
Musik
Filme
Microcode (Software)
Superschneller Pizzaservice
Früher hat der Deliverator Software programmiert. Ab und zu tut er das auch heute noch. Doch wäre das Leben eine ziemlich tolerante, von wohlmeinenden Doktoren der Pädagogik geführte Grundschule, dann würde auf dem Zeugnis des Deliverators stehen: »Hiro ist bemerkenswert intelligent und kreativ, aber er sollte dringend an seiner Kooperationsfähigkeit arbeiten.«
Deshalb hat er jetzt diesen neuen Job. Einen, der keine Intelligenz erfordert. Und keine Kreativität. Aber eben auch keine Kooperation. Es gibt nur eine Regel: Der Deliverator steht dafür gerade, dass du deine Pizza in dreißig Minuten hast, oder du kriegst sie umsonst, darfst den Fahrer abknallen, dir sein Auto schnappen und auf Schadenersatz klagen. Der Deliverator macht den Job jetzt seit sechs Monaten, ein langes und erfülltes Berufsleben für seine Verhältnisse, und er hat noch nie länger als einundzwanzig Minuten gebraucht, um eine Pizza auszuliefern.
Klar, früher haben die Kunden ständig um Lieferzeiten gestritten, ellenlange Diskussionen angezettelt, für die etliche Pizzafahrerjahre draufgegangen sind: Eigenheimbesitzer, rotgesichtig und verschwitzt von ihren eigenen Lügen, Typen, die nach Old Spice und Jobstress stanken, die im gelben Lichtschein ihres Hausflurs mit der Seiko wedelten und auf die Uhr über der Spüle zeigten, ich schwör’s, könnt ihr Jungs denn keine Uhr lesen?
Aber das ist längst Geschichte. Pizzaausliefern ist heute eine Großindustrie, hochorganisiert. Die Leute waren vier Jahre lang auf der CosaNostra Pizza University, um es zu studieren. Konnten keinen Satz Englisch schreiben, als sie kamen – aus Abchasien, Ruanda, Guanajuato, Süd-Jersey –, und als sie wieder rausmarschierten, wussten sie mehr über Pizza als ein Beduine über Sand. Hatten Diagramme über die Häufigkeit von Lieferzeitstreitigkeiten an der Haustür angefertigt. Hatten ihre Pizzaboten verwanzt, um alles aufzunehmen und später zu analysieren: die rhetorischen Strategien, die stimmbasierten Stress-Histogramme, die spezifische Grammatik all dieser weißen Burbclave-Bewohner aus der Mittelschicht, Typ Choleriker, die bar jeder Logik beschlossen hatten, genau hier und jetzt wie einst General Custer die Stellung zu halten, im letzten Gefecht gegen alles, was in ihrem Leben abgeschmackt und geisttötend war. Sie logen über den Zeitpunkt ihres Anrufs oder glaubten sogar selbst, was sie sagten, um sich eine Gratispizza zu sichern; nein, sie verdienten diese Gratispizza, verdienten sie ebenso wie Leben, Freiheit und das Streben nach weiß der Geier was, das war nun mal ihr scheißunveräußerliches Recht. Man hatte Psychologen zu den Leuten nach Hause geschickt, ihnen neue Fernseher geschenkt, damit sie an anonymen Umfragen teilnahmen, sie an Lügendetektoren angeschlossen, ihre Hirnströme gemessen, während man ihnen flimmrige, kryptische Videos von Pornoqueens, nächtlichen Autounfällen und Sammy Davis, Jr. zeigte, und sie anschließend in lieblich duftende Zimmer mit malvenfarbenen Tapeten geführt und ihnen derart verstörende Fragen über Ethik gestellt, dass nicht einmal ein Jesuit sie hätte beantworten können, ohne sich einer klitzekleinen lässlichen Sünde schuldig zu machen.
Schlussendlich gelangten die Forscher von der CosaNostra Pizza University jedoch zu dem Ergebnis, dass all dies schlicht in der Natur des Menschen lag und man nicht das Geringste daran ändern könne, also verfielen sie auf eine kostengünstige technische Lösung: die Smartbox. Der heutige Pizzakarton ist ein hochstabiles geriffeltes Kunststoffgehäuse mit einem leuchtenden LED-Display an der Seite, das dem Deliverator verrät, wie viele handelsbilanzverzerrende Minuten seit dem schicksalhaften Telefonanruf verstrichen sind. Sind randvoll mit Speicherchips und solchem Kram, die Dinger. Die Pizzen stecken, eine über der anderen, in Fächern hinter dem Kopf des Fahrers. Jede Pizza gleitet in einen solchen Steckplatz wie eine Platine in einen Rechner und rastet klickend ein, worauf sich die Smartbox in den Bordcomputer des Lieferautos einloggt. Die Adresse des Anrufers ist bereits aus seiner Telefonnummer ermittelt und in den eingebauten RAM der Box geladen worden. Von dort aus wird sie zum Bordsystem übertragen, das die optimale Strecke berechnet und sie auf ein HUD projiziert, eine durchsichtige, bunt leuchtende Straßenkarte, die sich über die Windschutzscheibe spannt, so dass der Deliverator nicht einmal nach unten schauen muss.
Wenn die Dreißigminutenfrist abgelaufen ist, wird die Katastrophenmeldung augenblicklich an die Firmenzentrale von CosaNostra Pizza gesendet, wo man sie umgehend an Onkel Enzo persönlich weiterleitet – den sizilianischen Colonel Sanders, den Andy Griffith von Bensonhurst, die rasiermesserschwingende Ausgeburt der Albträume eines jeden Deliverators, Capo und Galionsfigur von CosaNostra Pizza Incorporated –, der dann binnen fünf Minuten zum Telefon greift, den Kunden anruft und sich überschwänglich bei ihm entschuldigt. Tags darauf wird Onkel Enzo mit seinem Düsenhelikopter im Vorgarten des Kunden landen, um sich noch etwas leidenschaftlicher zu entschuldigen und ihm eine Reise nach Italien zu schenken – alles, was er dafür tun muss, ist einen Haufen von Erklärungen unterschreiben, die ihn zu einer Person des öffentlichen Interesses und einem Werbeträger für CosaNostra Pizza machen und damit im Grunde seinem Privatleben, wie er es kannte, ein jähes Ende setzen. Wenn die ganze Sache schließlich vorüber ist, wird ihn das vage Gefühl beschleichen, er schulde der Mafia einen Gefallen.
Was mit dem Fahrer in solchen Fällen geschieht, weiß der Deliverator nicht genau, aber er hat Gerüchte gehört. Die meisten Liefertouren finden in den Abendstunden statt, die Onkel Enzo als seine Freizeit erachtet. Und wie wärst du gelaunt, wenn du dein Abendessen im trauten Familienkreis unterbrechen müsstest, um irgendeinen renitenten Schwachkopf in irgendeiner Burbclave anzurufen und ihm wegen einer verspäteten Pizza in den Arsch zu kriechen? Onkel Enzo hat sich gewiss nicht die letzten fünfzig Jahre für seine Familie und sein Land abgerackert, um in einem Alter, in dem die meisten anderen längst Golf oder mit ihren Enkelinnen Hoppereiter spielen, triefnass aus der Wanne zu steigen, sich hinzuknien und irgendeinem sechzehnjährigen Skatepunk die Füße zu küssen, dessen Scheißsalamipizza einunddreißig Minuten unterwegs war. O Gott. Allein bei dem Gedanken atmet der Deliverator ein wenig flacher.
Aber er würde nicht für CosaNostra fahren, wenn es anders liefe als genau so. Und weißt du auch, warum? Weil es nun mal was hat, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Du fühlst dich wie ein Kamikazeflieger. Glasklar im Kopf. Andere Leute – Verkäufer, Burgerwender, Softwareingenieure, die ganze Palette sinnloser Berufe, die unser Leben in Amerika ausmachen –, all diese Leute vertrauen auf die gute alte Konkurrenz. Wende deine Burger oder säubere deine Subroutinen gefälligst schneller und besser, als dein Klassenkamerad von der Highschool zwei Blocks weiter seine Burger wendet oder seine Subroutinen säubert, denn wir stehen in Konkurrenz mit diesen Typen, und der Kunde merkt so was.
Was für eine beschissene Tretmühle. CosaNostra Pizza hat keine Konkurrenz. Konkurrenz widerspricht dem Mafiaethos. Du strengst dich nicht an, weil du mit einer identischen Klitsche ein paar Häuser weiter konkurrierst. Du strengst dich an, weil alles auf dem Spiel steht. Dein guter Name, deine Ehre, deine Familie, dein Leben. Diese Burgerwender haben vielleicht eine höhere Lebenserwartung, na und? Was für ein Leben ist das schon? Und genau das ist der Grund, wieso niemand, nicht einmal die Japaner, schneller Pizza ausliefern als CosaNostra. Der Deliverator ist stolz darauf, die Uniform zu tragen, stolz darauf, das Auto zu fahren, stolz darauf, die Gartenwege unzähliger Burbclave-Eigenheime hochzumarschieren, eine martialische Erscheinung in Ninjaschwarz, eine Pizza auf der Schulter, deren rote LEDs stolze Lieferzeiten in die Nacht lodern: 12:32 oder 15:15 oder, ganz selten einmal, 20:43.
Der Deliverator bekommt CosaNostra Pizza #3569 im Valley zugeteilt. Südkalifornien weiß nicht, ob es sich noch abhetzen oder lieber gleich den Strick nehmen soll. Gibt einfach nicht genügend Straßen für all die vielen Menschen. Fairlanes Inc. baut ständig neue. Müssen dafür haufenweise Stadtviertel plattmachen, aber diese Neubaugebiete aus den Siebzigern und Achtzigern taugen nun mal zu nichts anderem, als plattgewalzt zu werden, oder? Keine Gehsteige, keine Schulen, kein Garnichts. Nicht mal eine eigene Polizeitruppe – keinerlei Grenzkontrollen –, unerwünschte Personen können einfach reinspazieren, ohne durchsucht oder zumindest schikaniert zu werden. Wer was auf sich hält, wohnt in einer Burbclave. Einem Stadtstaat mit eigener Verfassung, eigenen Grenzen, Gesetzen, Cops, allem Drum und Dran.
Früher war der Deliverator eine Zeitlang Corporal bei den staatlichen Sicherheitskräften der Farms of Merryvale. Wurde gefeuert, weil er sein Schwert gezogen hat und auf einen Typen losgegangen ist, den er für einen Einbrecher hielt. Hat es ihm direkt durchs Hemd gejagt, die flache Seite der Klinge seitlich am Hals entlanggleiten lassen und den Brecher an der verzogenen, blasenschlagenden Kunststoffverkleidung jenes Hauses aufge- spießt, in das der Kerl einsteigen wollte. Hielt das für eine ziemlich einwandfreie Festnahme. Haben ihn aber trotzdem gefeuert, weil sich der Einbrecher als Sohn des Vizekanzlers der Farms of Merryvale entpuppte. Natürlich hatten sie eine hübsche Ausrede, die Schlitzohren: Meinten, ein neunzig Zentimeter langes Samuraischwert entspräche nun mal nicht dem Waffenprotokoll. Meinten, er habe gegen die RAMS verstoßen, die Richtlinien zum Aufgreifen mutmaßlicher Straftäter. Meinten, der Verdächtige habe ein psychisches Trauma erlitten. Fürchte sich jetzt vor Buttermessern; müsse sich die Marmelade jetzt mit der Rückseite seines Teelöffels aufs Brot schmieren. Meinten, der Deliverator habe ihnen eine saftige Schmerzensgeldforderung eingebrockt.
Der Deliverator hatte sich Geld leihen müssen, um sie zu bezahlen. Von der Mafia. Also ist er jetzt in ihrer Datenbank – Netzhautmuster, DNA, Fingerabdrücke, Fußabdrücke, Handflächenabdrücke, Handgelenkabdrücke, Abdrücke von so gut wie jeder verfluchten Körperstelle, die irgendwelche Falten hat –, alles haben die Dreckskerle durch Tinte gerollt, auf Papier gestempelt, digitalisiert und in ihrem Computer gespeichert. Aber es ist nun mal ihr Geld – klar, dass sie aufpassen müssen, wem sie es leihen. Und als er sich dann auf die Stelle als Deliverator bewarb, nahmen sie ihn mit Kusshand, weil sie ihn kannten. Um den Kredit zu kriegen, hatte er persönlich beim stellvertretenden Vizecapo des Valleys vorsprechen müssen, der ihn später für den Lieferjob empfahl. Und jetzt kommt es ihm so vor, als gehöre er schon zur Familie. Einer verdammt furchteinflößenden, verkorksten, gewalttätigen Familie.
CosaNostra Pizza #3569 liegt in der Vista Road kurz hinter dem Kings Park Mall. Die Vista Road gehörte früher einmal dem Staat Kalifornien und heißt heute Fairlanes Inc. Rte. CSV-5. Ihr größter Konkurrent ist ein einstiger U. S. Highway, der jetzt Cruiseways gehört und Cruiseways Inc. Rte. Cal-12 heißt. Ein Stück weiter oben im Valley kreuzen sich die beiden rivalisierenden Highways sogar. Früher ist es dort zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, und die Kreuzung wurde wegen Heckenschützenfeuer zeitweise gesperrt. Schließlich hat eine große Baufirma die gesamte Kreuzung gekauft und zu einer Drive-Thru-Mall umgebaut. Heute führen alle Straßen in ein Parksystem – kein Parkplatz, kein Parkhaus, sondern ein richtiges System – und sind kaum mehr auseinanderzuhalten. Um über die Kreuzung zu gelangen, muss man seinen Weg durch dieses Parksystem finden, gewunden und verschlungen wie der Ho-Chi-Minh-Pfad. CSV-5 hat besseren Durchsatz, doch Cal.12 hat den besseren Belag. Das ist typisch – Fairlanes-Straßen bringen einen rascher ans Ziel, sind also etwas für Fahrer vom Typ A, während man bei Cruiseways mehr Wert auf das Fahrvergnügen legt, für Fahrer vom Typ B.
Der Deliverator ist wie ein Typ-A mit Tollwut. Rast zielgenau auf seine Homebase zu, CosaNostra Pizza #3569, kachelt mit hundertzwanzig Sachen über die linke Spur der CSV-5. Sein Auto ist eine unsichtbare schwarze Raute, kaum mehr als ein dunkler Fleck, der den Tunnel aus Neonlogos reflektiert – den Loglo. Eine Reihe grelloranger Lichter wogt und züngelt quer über die Front, dort, wo sich der Kühlergrill befinden würde, wäre dies ein luftgekühltes Fahrzeug. Die orangefarbenen Lichter sehen aus wie Benzinfeuer, das durch die Heckscheiben der anderen Fahrer dringt, von ihren Rückspiegeln abprallt und sich wie eine lodernde Maske über ihre Augen legt, es bohrt sich bis in ihr Unterbewusstsein und beschwört die schreckliche Angst herauf, bei vollem Bewusstsein unter einem explodierenden Gastank eingeklemmt zu sein, weckt in ihnen das unbändige Verlangen, Platz zu machen und den Deliverator in seinem schwarzen Streitwagen voll feuriger Pepperonipizza überholen zu lassen.
Der Loglo über ihm, »CSV-5« in paarigen Kondensstreifen, ist ein riesiges Gebilde aus elektrischem Licht. Es besteht aus unzähligen kleinen Leuchtzellen, und jede einzelne davon wurde in Manhattan von Lichtdesignern gestaltet, die mit dem Entwurf eines einzigen Loglo mehr verdienen als ein Deliverator in seinem ganzen Leben. Trotz aller Bemühungen, sich von anderen abzusetzen, fließen sämtliche Schriftzüge ineinander, besonders bei hundertzwanzig Stundenkilometern. Trotzdem ist CosaNostra Pizza #3569 nicht zu übersehen dank der Werbetafel, die selbst nach den größenwahnsinnigen heutigen Maßstäben echt hoch und breit ist. Im Grunde ist das gedrungene Gebäude kaum mehr als ein niedriger Sockel für die gewaltigen Pfeiler aus Aramidfasern, die das Reklameschild ins Markenzeichenfirmament emporrecken. Marca Registrada, Baby.
Das Schild ist ein Klassiker, ein alter Hut, keine Ausgeburt irgendeiner kurzlebigen Mafia-Werbekampagne. Ein Statement, ein Denkmal, errichtet für die Ewigkeit. Schlicht und würdevoll. Es zeigt Onkel Enzo in einem seiner schicken italienischen Anzüge. Die glitzernden Nadelstreifen winden sich wie gespannte Sehnen. Das Einstecktuch ist hell erleuchtet. Seine Frisur sitzt perfekt, die Haare sind mit irgendeinem Zeug nach hinten geklatscht, das nie wieder rausgeht, jede Strähne kerzengerade, makellos gestutzt von Onkel Enzos Vetter, Art dem Barbier, der die weltweit zweitgrößte Kette von Billigfriseursalons betreibt. Da steht er also, Onkel Enzo, nicht direkt lächelnd, doch mit einem onkelhaften Funkeln in den Augen, nicht wie ein Model, sondern genau so, wie dein Onkel nun mal dastehen würde, darunter die Worte:
DIE MAFIA
Werden Sie ein Freund der Familie!
Mit freundlicher Unterstützung der Unsere-Sache-Stiftung
Die Werbetafel dient dem Deliverator als Polarstern. Er weiß: Wenn er an die Stelle auf dem CSV-5 kommt, wo die untere Ecke der Tafel von den pseudogotischen Buntglasbögen der örtlichen Franchise von Reverend Waynes Himmelspforte verdeckt wird, muss er auf eine der rechten Spuren schwenken, wo Schwachmaten und Mommyboxes ziellos herumschleichen und jede Einfahrt einer vorbeifliegenden Franchise derart unschlüssig beäugen, als wüssten sie nicht, ob es sich um eine Versuchung oder eine Drohung handelt.
Haarscharf schneidet er eine Mommybox – einen Familien-Minivan –, jagt am Buy ’n’ Fly nebenan vorüber und donnert in die Einfahrt von CosaNostra Pizza #3569. Die dicken, fetten Kontaktflächen beschweren sich, kreischen kurz auf, krallen sich aber verbissen in den patentierten Fairlanes-Inc.-Asphalt mit maximaler Bodenhaftung und leiten den Wagen in die Fahrrinne. In der Rinne warten keine anderen Deliverators, und das ist gut, verspricht raschen Umsatz, eine High-Speed-Übergabe, lass die Pizza rüberwachsen, Alter. Als er knirschend zum Stehen kommt, klappt die elektromechanische Luke seines Wagens bereits hoch, gibt die leeren Pizzaschlitze frei, während sich die Tür klickend zusammenfaltet wie ein Käferflügel. Die Steckplätze warten. Warten auf die heiße Pizza.
Warten und warten. Der Deliverator hupt. Das ist nicht der vorgeschriebene Ablauf.
Das Fenster fährt zur Seite. Das sollte niemals passieren. Schlag nach im Ringordner der CosaNostra Pizza University, vergleich alle Einträge und Querverweise zu Fenster, Abholrinne, Zuteiler, und du findest sämtliche Abläufe, die mit diesem Fenster zu tun haben – und es sollte sich niemals öffnen. Außer, es ist etwas schiefgelaufen.
Das Fenster fährt beiseite, und – halt dich fest – Rauch quillt heraus. Der Deliverator hört ein seltsam misstönendes Fiepen über dem Heavy-Metal-Orkan aus seiner Anlage und begreift, dass es die Sirene eines Feueralarms ist, die aus dem Inneren der Franchise schrillt.
Mute-Taste. Bedrückende Stille – seine Trommelfelle erschlaffen –, die Scheibe bebt vom Kreischen des Rauchmelders. Der Wagen knurrt im Leerlauf, wartet. Die Luke ist zu lange offen, Schadstoffe aus der Luft setzen sich an den elektrischen Kontakten hinten in den Pizzafächern ab, er wird sie früher als geplant reinigen müssen, alles läuft genau so, wie es laut Handbuch nicht laufen sollte – dem allmächtigen Ringordner, der den Takt des Pizzauniversums vorgibt.
Drinnen rennt ein Abchase mit footballförmigem Gesicht kopflos hin und her, einen aufgeschlagenen Ringordner in den Händen, den er auf seinen vorspringenden Hüftspeck stützt, damit er nicht zusammenklappt; sein Gang erinnert an einen Mann, der ein rohes Ei auf einem Esslöffel balanciert. Er brüllt etwas auf Abchasisch – sämtliche Betreiber von CosaNostra-Pizzaläden in diesem Teils des Valleys sind abchasische Einwanderer.
Es sieht nicht nach einem ernsten Feuer aus. In den Farms of Merryvale hat der Deliverator mal einen richtigen Brand erlebt, und da konnte man vor lauter Rauch nichts mehr erkennen. Da war nur noch Rauch und nichts als Rauch, der überall hervorquoll, und am Boden hier und da orange Blitze, wie Wetterleuchten in aufgetürmten Wolken. Das hier ist nicht diese Art von Feuer. Es ist die Art von Feuer, die gerade so viel Qualm freisetzt, dass der Rauchmelder anspringt. Und wegen diesem Scheiß verliert er Zeit.
Der Deliverator hält die Huptaste gedrückt. Der abchasische Geschäftsführer kommt ans Fenster. Er sollte die Sprechanlage benutzen, um mit Fahrern zu reden, jedes seiner Worte wird direkt ins Wageninnere übertragen, aber nein, er muss es ihm ja ins Gesicht sagen, als wäre der Deliverator irgend so ein beschissener Ochsenkutscher. Er ist krebsrot im Gesicht, schwitzt, verdreht die Augen, während er verzweifelt nach den englischen Wörtern ringt.
»Feuer, aber nur kleines«, sagt er.
Der Deliverator antwortet nicht. Denn er weiß, dass alles per Video mitgeschnitten wird; Material, das dann in Echtzeit an die CosaNostra Pizza University geht, wo man es in einem der Pizzamanagement-Labore analysieren und den dortigen Studierenden vorführen wird – darunter womöglich sogar jemandem, der diesen Mann ersetzen wird, wenn man ihn feuert, als Musterbeispiel dafür, wie man sich sein Leben verpfuscht.
»Neuer Mitarbeiter – hat Abendessen in Mikrowelle gestellt – hatte Alufolie drum – Bumm!«, sagt der Geschäftsführer.
Abchasien war mal Teil der Scheißsowjetunion. Ein neuer Einwanderer aus Abchasien, der probiert, eine Mikrowelle zu bedienen, ist wie ein Tiefseeröhrenwurm, der sich an Hirnchirurgie versucht. Wo kriegen sie diese Typen bloß her? Gibt es denn keine Amerikaner mehr, die eine Scheißpizza backen können?
»Schieb mir einfach ’ne Mafiatorte rüber«, sagt der Deliverator.
Das Wort Mafiatorte katapultiert den Typen zurück ins jetzige Jahrhundert. Er reißt sich zusammen. Er rammt das Fenster zu, erstickt endlich das nervtötende Geheul des Rauchmelders.
Ein japanischer Roboterarm schiebt die Pizza heraus und direkt in den obersten Schlitz. Die Luke schließt sich, um sie zu schützen.
Als der Deliverator aus der Rinne rollt, Geschwindigkeit aufnimmt, die Adresse checkt, die quer über die Windschutzscheibe flackert, überlegt, ob er rechts oder links abbiegen muss, geschieht es. Die Stereoanlage setzt erneut aus – auf Anweisung des Bordcomputers. Die Cockpitleuchten blinken rot. Rot! Ein pulsierender Warnton schrillt. Die LED-Anzeige der Windschutzscheibe, identisch mit der auf der Pizzaschachtel, lodert auf: 20:00.
Sie haben dem Deliverator gerade eine zwanzig Minuten alte Pizza gegeben. Er schielt auf die Adresse; sie ist knapp zwanzig Kilometer entfernt.
2
Dem Deliverator entfährt ein ungewollter Schrei, und er steigt aufs Gas. Sein Bauch sagt ihm, er soll zurückfahren und den Geschäftsführer umbringen, seine Schwerter aus dem Kofferraum holen, wie ein Ninja durch das kleine Schiebefenster hechten, ihn im chaotischen Durcheinander seiner mikrowellenverseuchten Lieferklitsche aufspüren und im Endkampf einer fulminanten Pizzapokalypse hinrichten. Aber das sagt ihm sein Bauchgefühl auch jedes Mal, wenn ihn jemand auf dem Freeway schneidet, und er hat es – bisher jedenfalls – noch nie getan.
Er kann das schaffen. Das ist machbar. Er dreht das orangeglühende Warnlicht auf maximale Leuchtkraft und schaltet die Scheinwerfer auf Autoflash. Killt den Warnton, switcht die Anlage auf Taxiscan, das den gesamten Taxifunk nach relevanten Verkehrsmeldungen absucht. Versteht nicht ein verdammtes Wort. Es gibt diese Kassetten zu kaufen, Lernen-beim-Fahren-Tapes, mit denen man sich Taxilinga draufschaffen kann. Ein absolutes Muss, um in der Branche einen Job zu landen. Die Sprache, so heißt es, basiere auf dem Englischen, doch nicht eins von hundert Wörtern sei wiederzuerkennen. Trotzdem bekommt man wenigstens eine leise Ahnung. Wenn es auf der Strecke irgendwelche Schwierigkeiten gab, würden sie darüber in Taxilinga quatschen, ihn warnen, und er würde eine Ausweichroute nehmen, damit er ja nicht
er packt das Lenkrad
in einen Stau gerät
seine Augen weiten sich, er spürt, wie der Druck sie rückwarts in den Schädel treibt
oder hinter einem Wohnmobil hängenbleibt
seine Blase ist zum Bersten voll
und die Pizza
o Gott o Gott
zu spät ausliefert
Auf seiner Windschutzscheibe steht 22:06; doch alles, was er sieht, alles, woran er denken kann, ist 30:01.
Die Taxifahrer quasseln im Radio vor sich hin. Taxilinga ist ein honigsüßer Singsang, durchsetzt von harten fremdländischen Lauten, wie weiche Butter gespickt mit Glasscherben. Er hört immer wieder »Fahrgast«. Ständig palavern sie über ihre beschissenen Fahrgäste. Na und?
Wenn du deinen Fahrgast
zu spät
ablieferst, kriegst du eben weniger Trinkgeld. Oh, wie furchtbar.
Wie immer fetter Stau an der Kreuzung CSV-5 und Oahu Road. Der einzige Weg, ihn zu umfahren, führt durch die Mews at Windsor Heights.
MAWHs haben alle den gleichen Grundriss. Wenn sie eine neue Burbclave baut, plättet die MAWH Development Corporation jede Gebirgskette und leitet selbst die größten Flüsse um, sollten diese ihr ergonomisch auf maximale Verkehrssicherheit optimiertes Straßenraster auch nur im Geringsten gefährden. Ein Deliverator findet sich in jeder Mews-at-Windsor-Heights-Siedlung auf der Welt zurecht, von Fairbanks über Jaroslawl bis zur Sonderwirtschaftszone von Shenzhen. Doch nur jemand, der jedes Haus einer MAWH schon ein paarmal mit Pizza beliefert hat, kommt hinter ihre kleinen Geheimnisse. Der Deliverator ist einer dieser Jemande. Er weiß, dass es in einer standardmäßigen MAWH nur einen Garten gibt – einen einzigen –, der dich davon abhält, auf der einen Seite hineinzujagen, pfeilgerade durch die Burbclave hindurch und auf der anderen Seite wieder hinaus. Wer zu zimperlich ist, auf Rasen zu fahren, kann bis zu zehn Minuten kreuz und quer durch eine MAWH gurken. Aber wenn du die Eier hast, durch diesen einen Garten zu pflügen, kannst du ungehindert mittendurch brettern.
Der Deliverator kennt diesen Garten. Er hat schon mehrere Pizzen an das dazugehörige Haus geliefert. Hat ihn sich angesehen, genau studiert, sich die Lage des Schuppens und des Picknicktisches eingeprägt, findet sie selbst im Dunkeln, weiß, dass, sollte dieser Fall je eintreten – eine Dreiundzwanzigminutenpizza, etliche Kilometer zu fahren und ein Stau auf der Kreuzung CSV-5 und Oahu –, er jederzeit in die Mews at Windsor Heights fahren könnte (wegen seines elektronischen Lieferantenvisums würde sich das Tor automatisch öffnen), den Heritage Boulevard entlangrasen, durch die Kurve in den Strawbridge Place schlittern (das Sackgassenschild geflissentlich ignorierend, ebenso die Höchstgeschwindigkeit und das Spielende-Kinder-Piktogramm, in einer MAWH allgegenwärtig), die Temposchwellen mit seinen riesigen Gürtelreifen in den Boden rammen, um anschließend die Auffahrt des Hauses Strawbridge Circle Nummer 15 hochzukacheln, scharf links um den Geräteschuppen zu schlittern, durch den Garten des Mayapple Place Nummer 84 zu rasen und, ohne den Picknicktisch zu erwischen (knifflig), über die Hauseinfahrt wieder raus auf die Mayapple zu rauschen, die ihn auf die Bellewoode Valley Road bringen würde und dann schnurgerade bis zum Ausgang der Burbclave. Gut möglich, dass die MAWH-Sicherheitspolizei dort auf ihn wartet, doch ihre RDV, die Reifen-Deflations-Vorrichtung, weist nur in eine Richtung – sie kann Autos fernhalten, nicht aber an der Ausfahrt hindern.
Dieser Wagen ist so scheißschnell – ein Cop, der gerade in seinen Donut beißt, wenn der Deliverator auf den Heritage Boulevard fährt, könnte den Bissen nicht mal ganz runterwürgen, bevor er auf der anderen Seite wieder raus auf die Oahu donnert.
Klonk. Noch mehr rote Lampen flackern auf der Windschutzscheibe: Die Außensicherung seines Lieferautos ist verletzt worden.
Nein. Nicht das noch.
Jemand verfolgt ihn. Kurz hinter seinem linken Kotflügel. Jemand auf einem Skateboard jagt direkt hinter ihm über den Highway, gerade als er seine Zielvektoren auf den Heritage Boulevard ausrichtet.
Abgelenkt wie er war, hat sich der Deliverator poonen – also harpunieren – lassen. Ein fetter, runder, gepolsterter Elektromagnet an einem Arachnofaserseil. Das Ding, das eben mit einem dumpfen Schlag aufs Heck des Deliveratorautos geknallt ist und jetzt festhängt. Drei Meter hinter ihm surft der Besitzer dieses verfluchten Teils, hält ihn zum Narren, skatet hinter ihm über den Asphalt wie ein Wasserskiläufer hinter einem Rennboot.
Im Rückspiegel flackert etwas orange und blau. Der Schmarotzer ist nicht nur ein Rotzgör auf Spritztour. Der orange-blaue Overall, bauschig und überall dick mit gesintertem Panzergel gepolstert, ist die Dienstkleidung eines Kouriers. Eines Kouriers von RadiKS, Radikal Kourier Systems. Ähnlich wie ein Fahrradkurier, aber hundertmal so lästig, weil sie nicht aus eigener Kraft durch die Gegend strampeln – sie kletten sich an dich und nehmen dir die Fahrt.
Logisch. Der Deliverator hatte es eilig, ist mit blitzenden Lichtern und heulenden Kontaktflächen losgeschossen. War das heißeste Teil auf der Straße. Natürlich hat der Kourier genau ihn ausgewählt, um sich dranzuhängen.
Aber kein Grund zur Sorge. Mit der Abkürzung durch die MAWH bleibt ihm genügend Zeit. Er überholt ein langsameres Auto in der Mittelspur, schert dann abrupt vor ihm wieder ein. Der Kourier wird sich entpoonen müssen, um nicht seitlich in den langsameren Wagen geschleudert zu werden.
Geschafft. Der Kourier ist nicht mehr drei Meter hinter ihm – er ist direkt am Wagen, glotzt durch seine Heckscheibe. Er hat das Manöver erwartet und seine Leine eingerollt, die in einem Griff mit motorbetriebener Spule endet, und surft jetzt knapp hinter dem Pizzaauto, die Vorderräder des Skateboards direkt unter der hinteren Stoßstange.
Eine orange-blau behandschuhte Hand langt zu ihm nach vorn, ein durchsichtiger Klebestreifen darüber, und schlägt klatschend ans Seitenfenster auf der Fahrerseite. Der Deliverator ist gerade gestickert worden. Der Aufkleber ist dreißig Zentimeter breit, und darauf steht, in großen orangefarbenen Buchstaben und spiegelverkehrt, damit er es von innen lesen kann:
Oh, wie billig
Um ein Haar verpasst er die Abzweigung in die Mews at Windsor Heights. Er muss in die Eisen gehen, auf eine Lücke warten und über die Randspur schwenken, um in die Burbclave einzubiegen. Der Grenzposten ist hell erleuchtet, die Zollbeamten stehen bereit, um sämtliche Einreisenden zu filzen – sogar einer vollständigen Leibesvisitation samt Körperöffnungen zu unterziehen, wenn es sich um die falschen Leute handelt –, doch wie durch Zauberhand schwingt das Tor auf, als das Sicherheitssystem bemerkt, dass es sich um ein CosaNostra-Pizzamobil handelt, muss nur rasch was abliefern, Sir. Und während er durchfährt, sieht er, dass der Kourier – diese Zecke an seinem Arsch – den Grenzern zuwinkt. Was für ein Arschloch! Als würde der ständig hier vorbeikommen!
Und wahrscheinlich stimmt das sogar. Wahrscheinlich holt er dauernd wichtiges Zeugs für wichtige MAWH-Leute hier ab und bringt es in andere FOQNEs, Franchisemäßig Organisierte Quasi-Nationale Entitäten, muss ständig durch den Zoll. Das ist der Job eines Kouriers. Trotzdem.
Er fährt zu langsam, hat seinen ganzen Schwung verloren, sein Timing ist im Arsch. Wo ist der Kourier? Ah, hat seine Leine weiter abgespult, surft wieder hinter ihm her. Aber der Deliverator hat eine Riesenüberraschung für den Wichser. Schafft er es auch, auf seinem beschissenen Skateboard zu bleiben, während er mit hundert Sachen über die plattgewalzten Trümmer des Plastikdreirads irgendeines Kindes geschleift wird? Finden wir es raus.
Der Kourier lehnt sich nach hinten – der Deliverator schielt in den Rückspiegel, kann einfach nicht anders –, lehnt sich zurück wie ein Wasserskiläufer, stößt sich vom Board ab und schwenkt neben den Wagen, rast nun neben ihm den Heritage Boulevard entlang, und klatsch, pappt noch ein Sticker auf dem Wagen, diesmal an der Frontscheibe! Darauf steht
Nicht übel, Flitzkacke
Der Deliverator hat von diesen Aufklebern gehört. Man braucht Stunden, um sie wieder abzukriegen. Muss den Wagen zur Autopflege bringen, Billionen von Dollars hinblättern. Der Deliverator nimmt sich zwei Dinge vor: Er wird diesen Abschaum abschütteln, koste es, was es wolle, und er wird diese Scheißpizza ausliefern, und das alles in den nächsten
24:23
fünf Minuten und siebenunddreißig Sekunden.
Hier ist es – er muss sich mehr auf die Straße konzentrieren –, er schlittert ohne Vorwarnung in die Nebenstraße, hofft, den Kourier damit gegen das Straßenschild an der Kreuzung zu klatschen. Klappt nicht. Die Schlauen unter ihnen achten auf deine Vorderreifen, sehen, wenn du abbiegst, lassen sich nicht austricksen. Strawbridge Place runter! Kommt ihm viel länger vor, als er ihn in Erinnerung hatte – kein Wunder, wenn man in Eile ist. Er sieht das Funkeln der Autos vor sich, Autos, die seitlich an der Straße stehen, im Wendekreis parken, wie es scheint. Und da ist das Haus. Zweigeschossig, hellblaue Vinylfassade, Garage nebendran. Er macht diese Einfahrt zum Fixstern seines Universums, verbannt den Kourier aus seinem Kopf, versucht, nicht an Onkel Enzo zu denken und daran, was der womöglich gerade macht – ob er vielleicht ein Bad nimmt, auf dem Scheißhaus hockt, mit irgendeiner Schauspielerin vögelt oder einer seiner sechsundzwanzig Enkelinnen sizilianische Volkslieder beibringt.
Die Böschung der Auffahrt rammt ihm seine Stoßdämpfer zur Hälfte in den Motorraum, aber dazu sind Stoßdämpfer ja nun mal da. Er weicht dem Wagen in der Auffahrt aus – haben wohl Besuch heute Abend, wusste gar nicht, dass die einen Lexus fahren –, brettert durch die Hecke, in den Garten neben dem Haus, hält Ausschau nach dem Schuppen, diesem Schuppen, in den er unter keinen Umständen reinrasen darf
er ist nicht da, sie müssen ihn abgerissen haben
also zum nächsten Problem, dem Picknicktisch im Garten nebenan
aber halt mal, da ist ein Zaun, wann haben die da einen Zaun aufgestellt?
Kein Zeit, um in die Eisen zu gehen. Er muss Fahrt aufnehmen, ihn niederwalzen, ohne seinen ganzen Schwung zu verlieren. Ist ja nur ein einszwanzig hohes Holzteil.
Der Zaun klappt problemlos weg, der Deliverator büßt höchstens zehn Prozent seiner Geschwindigkeit ein. Doch wie seltsam, irgendwie sah das Ding wie ein alter Zaun aus, ist er vielleicht irgendwo falsch abgebogen, geht es ihm noch durch den Kopf, während er schon abhebt und in hohem Bogen in einen leeren Gartenpool katapultiert wird.
Wäre er voller Wasser gewesen, wäre es wohl halb so schlimm gewesen, womöglich hätte man das Auto retten können und er würde CosaNostra Pizza keinen neuen Wagen schulden. Aber nein, er kracht wie eine Stuka in die gegenüberliegende Beckenwand, es klingt mehr nach Explosion als nach Aufprall. Der Airbag bläht sich, sinkt nur Sekunden später aber wieder herab wie ein Vorhang und führt ihm das ganze Elend seines neuen Lebens jäh vor Augen: Er sitzt fest, in einem Schrottauto im leeren Swimmingpool einer MAWH, die Sirenen der Burbclave-Polizei nähern sich, und hinter seinem Kopf steckt, drohend wie die Klinge einer Guillotine, eine Pizza, auf der 25:17 steht.
»Wo muss die hin?«, fragt jemand. Eine Frau.
Er sieht hoch durch den verzogenen Rahmen der Scheibe, nun umsäumt mit einem filigranen Muster aus gesprungenem Sicherheitsglas. Es ist der Kourier.
Der Kourier ist kein Mann, er ist eine junge Frau. Ein gottverfluchter Teenager! Sie hat keinen Kratzer abbekommen, ist völlig unversehrt. Ist einfach hinter ihm in den Pool geskatet und pendelt jetzt im Schwimmbad hin und her, fast bis hoch zur Kante, wo sie kehrtmacht, sich hinabschwingt und quer hindurch und auf der anderen Seite wieder hochrollt. In der rechten Hand hält sie ihre Poon, der Elektromagnet ist bis zum Griff aufgespult, so dass das Ding aussieht wie eine seltsam weitwinklige intergalaktische Strahlenwaffe. Ihre Brust funkelt wie die eines Generals – sie ist mit Hunderten kleiner Bänder und Orden dekoriert, nur dass es keine Abzeichen sind, sondern Barcodes. Ein Barcode mit ID-Nummer, der ihr Zugang zu etlichen Firmen, Schnellstraßen oder FOQNEs verschafft.
»Yo!«, sagt sie. »Wo muss die Pizza hin?«
Er ist ein toter Mann, und sie macht sich einen Spaß draus?
»White Columns. Oglethorpe Circle 5«, sagt er.
»Schaff ich. Mach die Klappe auf.«
Sein Herz schwillt auf das Doppelte seiner vorherigen Größe an. Tränen wallen in seinen Augen auf. Vielleicht übersteht er die Sache doch lebend. Er drückt einen Knopf, und die Klappe öffnet sich.
Auf ihrer nächsten Runde um den Beckengrund zerrt der Kourier die Pizza aus ihrem Steckplatz. Der Deliverator zuckt schmerzverzerrt zusammen, stellt sich vor, wie der knoblauchsatte Belag wie eine Ziehharmonika gegen die Rückwand des Behälters knautscht. Dann klemmt sie ihn sich hochkant unter den Arm. Der Anblick ist für den Deliverator schier unerträglich.
Aber sie wird sie ausliefern. Für hässliche, zermatschte oder kalte Pizzen muss sich Onkel Enzo nicht entschuldigen, nur für verspätete.
»Hey«, sagt er. »Nimm das hier.«
Der Deliverator reckt seinen schwarzuniformierten Arm aus dem zersplitterten Fenster. Im trüben Dämmerlicht der Gartenlaterne glimmt ein weißes Rechteck auf: eine Visitenkarte. Bei seiner nächsten Umrundung schnappt der Kourier sie ihm aus der Hand und liest. Darauf steht
Auf der Rückseite steht ein Wust aus Zahlen und Buchstaben, die erklären sollen, wie man ihn erreichen kann: Eine Telefonnummer, ein internationaler Voice-Phone-Ortungscode, ein Postfach, seine Adresse in einem halben Dutzend elektronischer Kommunikationsnetze – und eine Adresse im Metaverse.
»Bescheuerter Name«, sagt sie und steckt die Karte in eine der hundert kleinen Taschen ihres Overalls.
»Aber du wirst ihn nie vergessen«, sagt Hiro.
»Wenn du ein Hacker bist …«
»Warum fahr ich dann Pizza aus?«
»Genau.«
»Weil ich freiberuflicher Hacker bin. Hör zu, wie immer du auch heißt – du hast was gut bei mir.«
»Ich heiß Y. T.«, sagt sie, stößt sich mehrmals mit dem Fuß von Poolboden ab, nimmt Schub auf. Dann rast sie wie aus der Kanone geschossen über den Beckenrand und ist verschwunden. Dank der Smartwheels ihres Skateboards, unzählige kleine Speichen, die ein- und ausfahren, um sich der Bodenbeschaffenheit anzupassen, gleitet sie über den Rasen wie ein Klecks Butter über heißes Teflon.
Hiro, der seit dreißig Sekunden nicht mehr der Deliverator ist, steigt aus, holt seine Schwerter aus dem Kofferraum, schnallt sie sich um und macht sich bereit für eine rasante nächtliche Flucht durch MAWH-Gebiet. Die Grenze zu den Oakwood Estates ist nur wenige Minuten entfernt, er hat den Grundriss im Kopf (grob jedenfalls), und er weiß, wie diese Burbclave-Cops ticken, weil er selbst mal einer war. Die Chancen stehen also gut, dass er es schafft. Aber es dürfte interessant werden.
Über ihm, in dem Haus, zu dem der Pool gehört, ist Licht angegangen, und Kinder spähen aus ihren Schlafzimmerfenstern zu ihm herab, warm und kuschlig in ihren Little-Crips- und Ninja-Floßkrieger-Schlafanzügen, die entweder feuerfest oder nicht krebserregend sein können, aber nie beides zugleich. Ihr Dad kommt aus der Hintertür, sich eine Jacke überstreifend. Es ist eine nette Familie, eine sichere Familie in einem Haus voller Licht, genau wie die Familie, zu der auch er bis vor dreißig Sekunden noch gehört hat.
3
Hiro Protagonist und sein Mitbewohner Vitali Tschernobyl chillen in ihrer Wohnung, einem geräumigen neun mal sechs Meter großen Lagerraum in einem U-Stor-It in Inglewood, Kalifornien. Der Boden besteht aus Betonplatten, Wellblechwände trennen ihn von den Nachbarräumen, und – ein Zeichen von Rang und Luxus – ein metallenes Rolltor mit Nordwestausrichtung verwöhnt sie in Stunden wie diesen mit ein paar rotgleißenden Strahlen, wenn die Sonne über dem LAX untergeht. Hin und wieder rollt eine 777 oder eine Suchoi/Kawasaki-Überschalltransportmaschine vor die Sonne und verdeckt mit ihrem Seitenruder den Sonnenuntergang oder verhunzt den roten Schimmer mit ihren Abgasen, deren parallele, gewundene Strahlen ein scheckiges Muster an die Wand werfen.
Aber man kann schlimmer wohnen. Viel schlimmer, selbst hier, in diesem U-Stor-It. Nur große Wohneinheiten wie diese haben eine eigene Tür. In die meisten anderen gelangt man nur über eine gemeinsame Laderampe, die in ein Labyrinth breiter Wellblechgänge und Frachtaufzüge führt. Das sind die Elendsviertel, fünf oder zehn Quadratmeter große Verschläge, wo die Angehörigen des Yanoama-Stammes ihre Bohnen kochen und über Haufen brennender Lotteriescheine büschelweise Cocablätter garen. Es wird gemunkelt, dass früher einmal, als das U-Stor-It tatsächlich noch seinem eigentlichen Zweck diente (sprich Kaliforniern mit zu viel Zeug zusätzlichen Stauraum bereitzustellen), ein paar Geschäftsleute ins Büro marschiert wären, mit gefälschten Ausweisen mehrere Drei-mal-drei-Meter-Abteile gemietet und sie bis oben hin mit Fässern voll giftigem Chemiemüll gefüllt hätten, damit sich die U-Stor-It Corporation darum kümmerte. Diesen Gerüchten zufolge ließ U-Stor-It die betreffenden Abteile einfach mit Vorhängeschlössern sichern und schrieb sie ab. Noch heute, so behaupten die Einwanderer, würden einige der Einheiten vom Geist dieser toxischen Hinterlassenschaft heimgesucht. Jedenfalls erzählen sie das ihren Kindern, um sie davon abzuhalten, in verschlossene Abteile einzubrechen.
Niemand hat je versucht, in Hiros und Vitalis Abteil einzubrechen, weil es dort schlichtweg nichts zu holen gibt und keiner von beiden zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens wichtig genug ist, um ermordet, entführt oder verhört zu werden. Hiro besitzt ein Paar hübsche japanische Schwerter, die er aber stets auf dem Rücken trägt, und allein der Versuch, ihm solch aberwitzig gefährliche Waffen zu entwenden, würde den Möchtegerndieb mit einer ganzen Reihe inhärenter Gefahren und Widersprüche konfrontieren, denn: Ringt man um den Besitz eines Schwertes, gewinnt stets derjenige mit dem Griff in der Hand. Außerdem hat Hiro einen ziemlich guten Computer, den er in der Regel mitnimmt, wenn er irgendwo hingeht. Vitali hat nichts außer einer halben Stange Lucky Strikes, einer elektrischen Gitarre und einem fiesen Kater.
Im Augenblick liegt Vitali Tschernobyl der Länge nach auf einem Futon, ruht sich aus, und Hiro Protagonist hockt im Schneidersitz vor einem niedrigen Tisch, Nippon-Style, bestehend aus einer Frachtpalette auf Hohlblocksteinen.
Als die Sonne untergeht, weicht ihr rotes Glühen dem Schein der vielen Neonlogos des umliegenden Franchise-Ghettos, das die natürliche Umgebung dieses Lagerhauses bildet. Das Licht, das Loglo genannt wird, erfüllt die dämmrigen Ecken des Abteils mit billigen, übersatten Farben.
Hiro hat cappuccinofarbene Haut und stachlige, abgeschnittene Dreadlocks. Zwar bedeckt sein Haar nicht mehr ganz so viel Kopfhaut wie früher, aber er ist immer noch jung, weder kahl noch im Geringsten schütter, und der leicht zurückweichende Haaransatz bringt seine hohen Wangenknochen nur besser zur Geltung. Er trägt eine glänzende Brille, die sich halb um seinen Kopf schmiegt; in den Bügeln dieser Brille befinden sich kleine Ohrhörer, die in seiner Ohrmuschel stecken.
Diese Ohrhörer sind mit eingebauter Geräuschunterdrückung versehen. Am besten funktioniert sie bei gleichbleibendem Lärm. Wenn die Jumbojets auf der Rollbahn gegenüber zum Startanlauf beschleunigen, wird ihr Donnern zu einem tiefen, schwingenden Summton gedämpft. Doch wenn Vitali Tschernobyl ein experimentelles Gitarrensolo runterdrischt, schmerzt es Hiro dennoch in den Ohren.
Die Brille wirft einen fahlen Dunstschleier über seine Augen, und in ihren Gläsern spiegelt sich die verzerrte Weitwinkelansicht eines prächtig erleuchteten Boulevards, der sich in ein unendliches Dunkel erstreckt. Dieser Boulevard existiert nicht in der Wirklichkeit; er ist die computergenerierte Ansicht einer imaginären Umgebung.
Darunter kann man Hiros Augen erkennen, die asiatisch aussehen. Er hat sie von seiner Mutter, die Koreanerin ist, aber aus Japan kommt. In allem anderen ähnelt er eher seinem Vater, der Afrikaner war, aber aus Texas kam, im Grunde jedoch in der Army zu Hause gewesen war – damals, bevor sie in eine Reihe rivalisierender Organisationen wie General Jims Verteidigungssystem und Admiral Bobs nationalem Sicherheitsdienst zerfiel.
Auf seiner Frachtpalette befinden sich vier Gegenstände: eine Flasche teures Bier aus der Puget-Sound-Gegend, die sich Hiro eigentlich nicht leisten kann; ein langes Schwert, das man in Japan katana nennt, und ein kurzes, das dort wakizashi heißt – Hiros Vater hatte sie in Japan erbeutet, nachdem der Zweite Weltkrieg atomar wurde –, und ein Computer.
Der Computer ist ein schlichter schwarzer Klotz. Zwar hängt er nicht an einem Stromkabel, aber aus einer Klappe an der Rückseite kommt ein dünner durchsichtiger Plastikschlauch, der sich quer über Palette und Boden windet und in einer dilettantisch montierten Glasfasersteckdose über dem Kopf des schlafenden Vitali Tschernobyl endet.
Im Inneren des Plastikschlauchs verläuft ein haardünnes Glasfaserkabel. Durch dieses Kabel fließen Unmengen von Daten zwischen Hiros Computer und dem Rest der Welt hin und her. Um dieselbe Menge an Informationen auf Papier zu übermitteln, müssten die beiden dafür sorgen, dass alle paar Minuten eine 747-Frachtmaschine randvoll mit Telefonbüchern und Lexika im Sturzflug in ihr Abteil jagt, bis in alle Ewigkeit.
Im Grunde kann sich Hiro auch den Computer nicht leisten, aber er braucht ihn nun mal. Er gehört zu seinem Handwerkszeug. In der weltweiten Hacker-Community gilt Hiro als talentierter Freigeist – ein Leben, das ihm bis vor fünf Jahren noch furchtbar romantisch vorgekommen ist. Im kargen Tageslicht des Erwachsenseins, das nach den frühen Zwanzigern etwa so ernüchternd ist wie ein Sonntagmorgen nach einer Samstagnacht, steht ihm nun jedoch vor Augen, worauf es wirklich hinausläuft: Er ist pleite und arbeitslos. Und vor ein paar Wochen hat auch noch seine Karriere als Pizzafahrer – der einzige sinnlose Scheißjob, der ihm je Spaß gemacht hat – ein abruptes Ende genommen. Seitdem hat er sich verstärkt auf seinen Reserve-Notfalljob verlegt: freiberuflicher Informant für die CIC, die Central Intelligence Corporation aus Langley, Virginia.
Das Geschäftsmodell ist simpel. Hiro sammelt Informationen. Egal, ob Klatsch und Tratsch, ein Videoschnipsel, ein Tonbandausschnitt, etwas auf einer Datendisk, die Kopie eines Schriftstücks. Ja, es kann sogar ein Witz über den jüngsten, auf allen Kanälen breitgetretenen Skandal sein.
Er lädt sie in die CIC-Datenbank hoch – die sogenannte Bibliothek, ehemals die Kongressbibliothek, aber keiner nennt sie mehr so. Die meisten Leute wissen kaum noch, was das Wort »Kongress« wirklich bedeutet. Und selbst der Begriff »Bibliothek« wird zunehmend vager. Früher bezeichnete man damit ein Gebäude voller zumeist alter Bücher. Erst begann man, auch Videokassetten, Schallplatten und Zeitschriften einzubeziehen. Dann wurden sämtliche Informationen in maschinenlesbare Form konvertiert, sprich: Einsen und Nullen. Es wurde immer mehr Material, immer aktueller, die Suchoptionen immer raffinierter, bis irgendwann der Punkt erreicht war, an dem kein wesentlicher Unterschied mehr bestand zwischen der Kongressbibliothek und der Central Intelligence Agency. Zufälligerweise geschah dies just in dem Moment, als die Regierung ohnehin zusammenbrach. Also fusionierten die beiden und legten einen dicken fetten Börsengang aufs Parkett.
Millionen anderer CIC-Informanten laden gleichzeitig mit Hiro Millionen Datenschnipsel hoch. Die Kunden der CIC, meist Großkonzerne und Staatsoberhäupter, durchstöbern die Bibliothek nach nützlichen Informationen, und wenn sie etwas gebrauchen können, das Hiro dort eingestellt hat, kriegt Hiro Geld.
Vor einem Jahr hat er die komplette Rohfassung eines Drehbuchs hochgeladen, das er aus dem Papierkorb eines Filmagenten in Burbank geklaut hatte. Ein halbes Dutzend Studios wollten es lesen. Von dem Coup konnte er ein halbes Jahr leben und in Urlaub fahren.
Doch die Zeiten sind magerer geworden. Auf schmerzliche Weise hatte er lernen müssen, dass neunundneunzig Prozent der Informationen in der Bibliothek niemals genutzt werden. Nur ein Beispiel: Nachdem ihn ein Kourier auf Vitali Tschernobyl aufmerksam gemacht hatte, brachte er mehrere arbeitsreiche Wochen damit zu, alles über ein neues Musikphänomen zusammenzutragen – den Aufstieg ukrainischer Nuclear-Fuzz-Grunge-Kollektive in L.A. Legte ein umfassendes Dossier zu diesem Trend in der Bibliothek an, mitsamt Videoclips und Audiomaterial und allem Drum und Dran. Doch kein Plattenlabel, Manager oder Rockkritiker hat sich jemals die Mühe gemacht, es abzurufen.
Die Oberseite des Computers ist spiegelglatt – abgesehen von einer Fischaugenlinse, einer glänzenden Glaskuppel mit leicht violetter optischer Beschichtung. Wann immer Hiro das Gerät einschaltet, fährt diese Linse hoch und rastet klickend ein, die Grundfläche bündig mit der Oberfläche des Computers. Der Loglo aus der Nachbarschaft spiegelt sich verzerrt in ihrem Glas.
Hiro findet die Linse erotisch. Was wohl auch damit zu tun hat, dass er seit einigen Wochen niemanden mehr ordentlich flachgelegt hat. Aber es steckt mehr dahinter. Hiros Vater, lange Jahre in Japan stationiert, war wie besessen von Kameras. Und von seinen Aufenthalten in Fernost brachte er etliche Fotoapparate mit, in viele Schichten dick verpackt, so dass Hiro, wenn er beim Auspacken zusah, stets das Gefühl hatte, einem exquisiten Striptease beizuwohnen, während die Apparate ganz allmählich aus all dem schwarzen Leder und Nylon, dem Gewirr aus Riemen und Reißverschlüssen zum Vorschein kamen. Und schließlich, wenn das Objektiv enthüllt war, diese glasgewordene reine Geometrie, so machtvoll und verletzlich zugleich, dachte Hiro stets, wie sehr das alles einem zarten Vortasten und Liebkosen glich, durch Röcke und Dessous und äußere und innere Schamlippen hindurch … Er kam sich dabei nackt und schwach und mutig vor.
Die Linse überblickt das halbe Universum – jene Hälfte, die oberhalb des Computers liegt, wozu auch der größte Teil von Hiro gehört. Auf diese Weise weiß sie in der Regel stets, wo Hiro ist und aus welcher Richtung er hineinblickt.
Tief im Inneren des Computers befinden sich drei Laser – ein roter, ein grüner und ein blauer. Sie sind leistungsfähig genug, um grelles Licht zu produzieren, nicht aber so stark, dass sie sich durch die Rückseite der Augäpfel brennen, dir das Hirn grillen, die Stirnlappen rösten, den halben Kortex weglasern. Wie wir alle in der Grundschule gelernt haben, lässt sich mit diesen drei Farben des Lichts, in verschiedenen Intensitäten kombiniert, jeder beliebige Farbton erzeugen, den Hiros Augen wahrzunehmen in der Lage sind.
Aus dem Inneren des Rechners bricht ein gebündelter Lichtstrahl empor und verteilt sich durch die Fischaugenlinse in alle Richtungen. Mit Hilfe elektrischer Spiegel wird er auf das Glas von Hiros Brille projiziert, wo er hin und her rast, so wie der Elektronenstrahl eines Fernsehers den Schirm einer Bildröhre bemalt. Das so entstandene Bild schwebt vor Hiros Augen in der Luft, zwischen ihm und der Wirklichkeit.
Indem vor beiden Augen ein leicht versetztes Bild entworfen wird, entsteht der Eindruck von Dreidimensionalität. Wenn man es zweiundsiebzig Mal pro Sekunde verändert, lässt es sich in Bewegung versetzen. Stellt man dieses bewegte, dreidimensionale Bild mit einer vertikalen Auflösung von 2K Pixeln dar, wird es so scharf, wie es das menschliche Auge überhaupt wahrnehmen kann, und wenn man dann auch noch digitalen Stereosound durch die kleinen Ohrstöpsel jagt, erhalten die bewegten 3-D-Bilder einen vollendet realistischen Soundtrack.
Also ist Hiro eigentlich gar nicht hier. Er ist in einem computergenerierten Universum, das ihm sein Rechner auf die Brille malt und in seine Kopfhörer pumpt. Hacker nennen diesen imaginären Ort das Metaverse. Hiro verbringt eine Menge Zeit im Metaverse. Ist um Längen besser als im Scheiß-U-Stor-It.
Hiro nähert sich der Street. Sie ist der Broadway, die Champs-Élysées des Metaverse. Die grell erleuchtete Prachtstraße spiegelt sich stark verkleinert und verkehrt herum in seinen Brillengläsern. Sie existiert nicht wirklich. Und dennoch flanieren hier gerade Millionen Menschen auf und ab.
Die Ausmaße der Street sind in einem Protokoll festgelegt, in Stein gemeißelt von den Computergrafik-Ninjameistern der Global Multimedia Protocol Group der Association for Computing Machinery. Die Street erweckt den Eindruck eines glanzvollen Boulevards, der über den gesamten Äquator einer riesigen schwarzen Kugel mit einem Radius von knapp über zehntausend Kilometern verläuft. Dies ergibt einen Umfang von 65536 Kilometern, was den der Erde um einiges übertrifft.
Die Zahl 65536 wird den meisten Menschen ziemlich kryptisch vorkommen, nicht aber einem Hacker, der sie leichter erkennt als das Geburtsdatum seiner Mutter, handelt es sich doch um eine Potenz von 2–216, um genau zu sein –, und sogar der Exponent 16 entspricht 24, und 4 entspricht 22. Zusammen mit 256, 32768 und 2147483648 bildet 65536 einen der Grundsteine des Hacker-Universums, in dem 2 die einzige wirklich wichtige Zahl darstellt: die Anzahl von Ziffern, die ein Computer erkennen kann. Eine dieser Ziffern ist 0, und die andere ist 1. Jede Zahl, die sich erzeugen lässt, indem man die 2 zwanghaft mit sich selbst multipliziert und gelegentlich eine 1 abzieht, wird einem Hacker sofort vertraut vorkommen.
Genau wie überall in der sogenannten Realität wird auch hier ständig gebaut. Baufirmen dürfen ihre eigenen kleinen, von der Street abzweigenden Straßen bauen. Sie können Gebäude, Parks und Werbetafeln errichten, ebenso wie alles Mögliche, was es in der Realität nicht gibt, zum Beispiel gewaltige, am Himmel schwebende Lichtshows, spezielle Stadtviertel, in denen die Gesetze der dreidimensionalen Raumzeit aufgehoben sind, oder rechtsfreie Kampfzonen, wo Leute hingehen können, um sich gegenseitig zu jagen und zu töten.
Der einzige Unterschied ist: Da die Street in Wirklichkeit nicht existiert – sie ist nur ein Computergrafik-Protokoll, das jemand irgendwo auf einen Zettel gekritzelt hat –, wird auch nichts von alldem physisch gebaut. Es sind lediglich Programme, die der Öffentlichkeit über das weltweite Glasfasernetzwerk zugänglich gemacht werden. Wenn Hiro ins Metaverse geht, die Street entlangspäht, Gebäude und Neontafeln sieht, die sich scheinbar endlos in die Dunkelheit erstrecken, bis sie hinter dem gekrümmten Horizont verschwinden, starrt er in Wahrheit auf die graphischen Darstellungen – die Benutzeroberflächen – unzähliger von Großunternehmen entwickelter Programme. Um all das auf der Street zu platzieren, mussten sie die Erlaubnis der Global Multimedia Protocol Group einholen, sich ein Grundstück kaufen, einen Bebauungsplan einreichen, alle möglichen Genehmigungen besorgen, Gutachter bestechen, das volle Programm. Das gesamte Geld, das diese Firmen dafür zahlen, fließt in einen von der GMPG verwalteten Treuhandfonds, aus dessen Mitteln die Entwicklung und Erweiterung der Hard- und Software finanziert wird, welche die Existenz der Street überhaupt ermöglichen.
Hiro besitzt ein Haus ganz in der Nähe des belebtesten Straßenabschnitts. Nach Street-Maßstäben ist es ein sehr altes Viertel. Vor rund zehn Jahren, als das Street-Protokoll geschrieben wurde, schmissen Hiro und einige seiner Kumpels ihr Geld zusammen, kauften eine der ersten Baulizenzen und errichteten sich ein kleines Hackerviertel. Zu jener Zeit war es nur ein Flickenteppich kleiner Lichter in der endlosen Finsternis. Und auch die Street war kaum mehr als eine Perlenschnur aus Straßenlampen rings um ein schwarzes Rund im Nichts.
Das Viertel hat sich seither kaum verändert, die Street allerdings schon. Dass sie so früh hier waren, verschaffte Hiros Freunden einen Vorsprung vor dem Rest der Branche. Einige von ihnen wurden sogar sehr reich damit.
Und so besitzt Hiro ein schönes großes Haus im Metaverse, muss sich in der Realität aber ein Neun-mal- Sechser-Abteil in einem Lagerschuppen teilen. Das richtige Gespür für Immobiliendeals erstreckt sich nicht immer über Welten.
Himmel und Boden sind schwarz wie ein Computerbildschirm, der noch kein Signal empfangen hat; im Metaverse herrscht immer Nacht, und die Street ist immer grell erleuchtet, so schreiend bunt wie ein Las Vegas jenseits aller Grenzen von Physik und Geld. Doch die Bewohner von Hiros Viertel sind ausgezeichnete Programmierer, also ist hier alles sehr geschmackvoll. Die Häuser sehen aus wie echte Häuser. Es gibt einige Frank-Lloyd-Wright-Kopien und edle viktorianische Villen.
Deshalb ist es immer ein Schock, raus auf die Street zu treten, wo alles meilenweit in die Höhe ragt. Aber das ist nun mal Downtown, das am dichtesten bebaute Gebiet des Metaverse. Wenn man ein paar hundert Kilometer in irgendeine Richtung fährt, nimmt die Bebauung stetig ab, bis nur noch ein schmales Band von Straßenlampen übrig bleibt, die weiße Lichtpfützen auf den schwarzsamtigen Boden werfen. Downtown jedoch gleicht einem Dutzend übereinandergestapelter und neongespickter Manhattans.
In der echten Welt – Planet Erde, Wirklichkeit – leben zwischen sechs und zehn Milliarden Menschen. Die meisten von ihnen klatschen den ganzen Tag Lehmziegel zusammen oder zerlegen ihre Kalaschnikows. Etwa eine Milliarde von ihnen hat das Geld, sich einen Computer zu leisten; diese Leute besitzen mehr Geld als alle anderen zusammengenommen. Doch nur rund ein Viertel dieser einen Milliarde potenzieller Computerbesitzer macht sich tatsächlich die Mühe, einen zu kaufen, und nur ein weiteres Viertel davon verfügt über einen Rechner, der leistungsfähig genug ist, um das Street-Protokoll zu verarbeiten. Das ergibt etwa sechzig Millionen Menschen, die jederzeit auf der Street sein können. Nimmt man weitere rund sechzig Millionen hinzu, die es sich eigentlich nicht leisten können, aber trotzdem hingehen, indem sie öffentliche Rechner nutzen oder die von Schule, Uni oder Arbeitgeber, so sind auf der Street zu jedem beliebigen Zeitpunkt etwa doppelt so viele Menschen unterwegs wie in ganz New York City wohnen.
Aus diesem Grund ist es hier auch so verdammt verbaut. Setz ein Haus oder ein Reklameschild an die Street, und die hundert Millionen reichsten, hippesten, bestvernetzten Leute der Welt werden es jeden Tag sehen.
Sie ist hundert Meter breit, und mittendrin verläuft eine schmale einspurige Bahntrasse. Die darauf verkehrende Einschienenbahn – die Monorail – ist eine Öffentliche-Nahverkehrs-Software, die es den Usern erlaubt, schnell und problemlos von einem Abschnitt der Street zum nächsten zu gelangen. Viele Leute fahren damit einfach hin und her und bewundern die Sehenswürdigkeiten. Vor zehn Jahren, als Hiro die Street zum ersten Mal sah, war die Monorail noch nicht programmiert; seine Kumpels und er mussten sich Auto- und Motorradsoftware schreiben, um durch die Gegend zu fahren. Sie holten ihre Software aus der Garage und rasten damit durch die schwarze Wüste der elektronischen Nacht.
4
Y. T. hat schon oft das Vergnügen gehabt, mit anzusehen, wie ein heißer Clint sich bei einer unerlaubten Nachtfahrt die süße Fresse in einem leeren Burbclave-Pool aufreißt, doch bisher immer auf einem Skateboard – nie, nie in einem Auto. Die Landschaft der abendlichen Vorstädte birgt so manch bizarre Schönheit, man muss nur richtig hinsehen.
Zurück aufs Paddel. Es jagt auf einem Satz RadiKS Mark IV Smartwheels über den Rasen. Nachdem im Thrasher folgende Anzeige erschienen war, hatte sie aufgerüstet und sich diese stacheligen Wunderrädern zugelegt:
EIN KLUMPEN DOSENFLEISCH, GESPICKT MIT ROLLSPLITT
wird dir aus dem Spiegel entgegenstarren, wenn du auf einem miesen Board mit trägen, feststehenden Rollen surfst und dabei mit einem Auspuff, einem alten Reifen, gefrorener Hundekacke, einem überfahrenen Tier, einer Antriebswelle, Bahnschwelle oder einem ohnmächtigen Fußgänger Bekanntschaft machst.
Wenn du das für unwahrscheinlich hältst, skatest du zu oft durch leere Malls. All diese Hindernisse und noch einige mehr fanden sich letztens auf einem nur anderthalb Kilometer langen Abschnitt der New Jersey Turnpike. Jeder Thrasher, der versucht hätte, diesen Vard auf einem Nullachtfünfzehn-Board langzugrooven, würde jetzt Hirngrütze niesen.
Hör nicht auf die sogenannten Puristen, die dir weismachen wollen, man könne über jedes Hindernis jumpen. Ein Profi-Kourier weiß: Wenn du