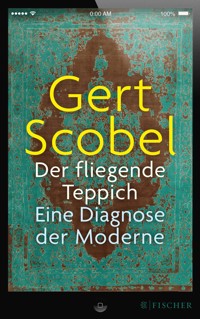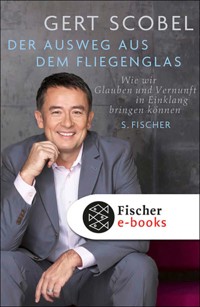
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Ausweg aus dem Fliegenglas – Gert Scobel zeigt Wege zwischen Glaube und Vernunft auf Für die meisten Menschen scheinen Glaube und Vernunft unvereinbare Gegensätze zu sein. Doch was, wenn man sich weder ausschließlich auf den Glauben noch auf die Vernunft verlassen kann oder will? In seinem ebenso gedankenreichen wie anregend-unterhaltsamen Buch Der Ausweg aus dem Fliegenglas zeigt der bekannte Wissenschaftsautor und Fernsehjournalist Gert Scobel, dass es sich lohnt, zwischen den Stühlen zu sitzen. Scobel gibt dem Leser die entscheidenden Mittel an die Hand, um sich in der Fülle der Theorien, Bücher und Meinungen zurechtzufinden. Mit Bezügen zu Philosophen wie Kant, Wittgenstein und Blumenberg sowie Theologen und Atheisten wie Dawkins navigiert er geschickt durch die komplexen Fragen von Religion und Aufklärung. So gelingt es ihm, der Fliege Auswege aus ihrem Glasgefängnis aufzuzeigen und neue Perspektiven auf die Wiederkehr der Religion in einer säkularen Welt zu eröffnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Gert Scobel
Der Ausweg aus dem Fliegenglas
Wie wir Glauben und Vernunft in Einklang bringen können
Impressum
Covergestaltung: Hißmann/Heilmann, Hamburg
Coverabbildung: Klaus Weddig
© 2010 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Alle Rechte vorbehalten
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400941-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
»Surely it is a [...]
Worum es in diesem Buch geht
Zum Anfang: Der Ausweg aus dem Fliegenglas
Erkenntnisgewinn auf offener See
Was bedeutet, »sich im Denken orientieren«?
Was ist Aufklärung?
Nebelbänke der Erkenntnis
Wittgenstein und der Ausweg aus dem Fliegenglas
Höhlenausgänge
Die glaubende und die denkende Fliege – die Möglichkeit des Aspektwechsels
Nova- und Fragilisierungseffekt
Religiöse Amusikalität und Vertikalspannungen
Teil I: Vernunft
1. Vernunft und die Grenzen der Erkenntnis
Die Suche nach »der« Vernunft und die Frage ihrer Einheit
Die Vielfalt »der« Vernunft oder was Vernunft ist
Vorurteile und das Fliegenglas der Vernunft
Über die Grenzen vernünftiger Erkenntnis
2. Sich mit der Vernunft orientieren
Vier einfache Fragen und das Katz-und-Maus-Prinzip
Vom Glauben an die Grammatik …
… über den Weg von Ähnlichkeit und Analogie …
… zur Erfindung des universalen Ägyptizismus
Noch einmal: vier einfache Grundfragen
3. Von der Methode, richtig zu denken, und was daraus folgt
Zwischenspiel: Was man von Lisa Simpson über Kant, die Religion und ihr Verhältnis zur Wissenschaft lernen kann
Teil II: Glauben
4. Glauben als Bedingung von Vernunft und Rationalität
Was bedeutet, sich im Glauben zu orientieren?
Epistemischer Respekt – für einen rationalen Umgang der Vernunft mit dem Glauben
Die Gleichursprünglichkeit von Vernunft und Glauben
Keine Vernunft ohne Glauben oder: Warum Zweifel nach dem Glauben kommen
Das Universalmedium Sinn: Über Himmel und Erde, Leben und Tod – und die Liebe
Über Religion und ihre angebliche Rückkehr
Und was folgt aus all dem für den Umgang mit Skeptikern?
5. Glauben im religiösen Sinn
Das Wesen des christlichen Glaubens – Ebeling und Tillich
Wetten, dass es anders ist als gedacht? – Pascal
Warum jeder glaubt und einen Gott hat – Luther
Und jetzt? – Ägyptizismus und Liebe in der Pausenzone
6. Gottesbeweise, die Gärtnerparabel oder wie Gott den Tod der tausend Qualifikationen stirbt (und möglicherweise dennoch überlebt)
Gottesbeweise – die drei Hauptformen
Die Unmöglichkeit positiver, aber auch negativer Gottesbeweise und ein Experiment
Das Gleichnis vom Gärtner oder der Tod der tausend Qualifikationen
Warum Tatsachen nur in ungefährer Annäherung Tatsachen sind
Warum wir Gott nicht loswerden (aber anders, als wir denken)
Der religiöse Blick
Was bleibt? Gottesbeweise und das Licht der Erlösung
7. Gott, Komplexität und die Aufgabe der Theologie
Gott, Komplexität und Russells Teekanne
Glauben, das System Religion oder die Täuschung über die Komplexität der Welt
Hegels gelehrte Unwissenheit, das Wissen der Religionen und der Tod
Das Projekt der Entmythologisierung und die Frage, was Theologie eigentlich ist
Muss man alles glauben, wenn man glaubt? Beispiel Leben nach dem Tod
Säkulare Religion
Zum Ende: Über das sagenhafte Drüben der Erlösung, das Lügen der Dichter und die Weisheit der Religion
»Surely it is a privilege to approach the end still believing in something«
Louise Glück, »Oktober«, in: Louise Glück, Averno. Gedichte, München 2007, S. 28
»Deux excès: Exclure la raison, n’admettre que la raison.«
Blaise Pascal, Pensées, Fragment 172, in: Blaise Pascal, Œuvres complètesII, édition présentée, établie et annotée par Michel Le Guern, Paris 2000, S. 604
Worum es in diesem Buch geht
Die Zeit, die wir haben – auch die zum Lesen –, ist begrenzt. Damit wären wir eigentlich bereits mitten im Thema, denn sowohl Glauben und Religion als auch Vernunft, Wissenschaften oder Philosophie haben auf eine ganz fundamentale Weise mit den Grenzen und Begrenztheiten des Lebens zu tun. Doch ich vermute, dass Sie zunächst viel lieber wissen wollen, worum es in diesem Buch geht. Also: Warum sollten Sie Zeit mit diesem Buch verbringen wollen?
Wenn ich noch einmal auf die Begrenztheiten zurückkommen darf: Endlichkeit, Krankheiten, Tod, Grenzen des Wachstums und der Globalisierung, die Krisen der Wirtschaft, aber auch die Grenzen unseres Verstehens und unserer Erkenntnis sowie die Beschränktheiten unserer politischen Systeme, die Rahmenbedingungen unserer Lebensweisen, unsere Bemühungen um Selbstbestimmung, Gerechtigkeit oder Zuwendung zueinander (Sie können diese Liste gerne um die Aspekte erweitern, mit denen Sie sich gerade beschäftigen): All das sind Themen, bei deren Durchdringung sich tiefgreifende Fragen auftun. Diese Fragen bewegen weltweit gläubige Menschen ebenso wie die, die religiös »unmusikalisch« sind oder aus mehr oder minder guten Gründen auch ohne Religion ein verantwortungsvolles Leben führen. Alle Menschen – und das schließt religiöse ebenso ein wie nichtreligiöse – versuchen notgedrungen, die Welt, in der sie – in der wir alle – leben, nicht nur besser zu verstehen, sondern auch besser zu machen (was oftmals schiefgeht). Dieses Bemühen eint uns – auch wenn es sich in den sogenannten Erstweltländern auf einer anderen Stufe des Kampfes um Überleben verwirklicht als in einem Land, in dem Hunger, Wassermangel, Krankheiten, politischer Terror oder Krieg dominieren. Trotz dieser Unterschiede versuchen wir alle bis in unsere alltäglichsten Verrichtungen hinein, möglichst gut mit der Komplexität des Lebens fertigzuwerden. Diese Komplexität ist kein Glaubensartikel. Sie umgibt uns faktisch immer, auch wenn wir sie häufig nicht wahrnehmen. In vielen Fällen überfordert sie uns auch. Dennoch müssen Gläubige wie Nichtgläubige mit ihr zurechtkommen.
Bildhaft gesprochen, befinden wir uns alle (und genaugenommen nicht nur Menschen, sondern alle Lebewesen auf diesem Planeten) in einem Boot. Unabhängig davon, ob wir den Ursprung als einen göttlichen Akt der Schöpfung, als ein singuläres Urknallgeschehen oder als eine ewige Abfolge sich wiederholender kosmologischer Prozesse der Ausdehnung und des Zusammenziehens verstehen wollen: Stets hat uns eine gemeinsame Geschichte der Evolution auf einem Himmelkörper zusammengeführt, auf dem wir durch das Universum navigieren. Je weiter man in der Zeit zurückgeht, umso eher wird man finden, dass es damals weder Vernunft noch Glauben (und irgendwann eben auch keine Menschen) gab. Beides, Glaube und Vernunft, ist erst in einem gemeinsamen Prozess der Entwicklung über Milliarden von Jahren hinweg entstanden, den man Evolution nennen kann, aber nicht muss. Je nach Vorliebe oder Weltanschauung kann man sowohl diesem Prozess als auch dem Boot, in dem wir durchs Universum segeln, verschiedene Namen geben – Namen, die durchaus auch nach der ursprünglichen Schiffstaufe geändert werden können.
Und noch eines verbindet uns: Gleich, ob Sie sich inmitten der Stürme des Lebens eher auf eine Religion – »Ihren« Glauben – oder auf den Verstand, auf Wissenschaft, klare Logik und Rationalität verlassen oder sogar versuchen, von beidem Gebrauch zu machen: Ein gewisses Gefühl des Zweifels, aber auch der Verlassenheit wird Sie in der Regel nicht ganz loslassen. Aus gutem Grund. Denn abgesehen von der bereits angesprochenen beunruhigenden Endlichkeit allen Daseins – selbst der überzeugteste Glauben an ein ewiges Leben kommt an der ihm vorausgehenden Tatsache des Todes nicht vorbei: Weder die Religionen noch die Erkenntnisse und Forschungsergebnisse der Wissenschaft (und auch nicht das Wachstum der Wirtschaft oder materieller Reichtum) können uns über die üblichen Versprechungen hinaus eine wirkliche Garantie dafür geben, dass unser Leben so, wie wir es jeweils gestalten, ein glücklich(er)es Leben wird. Die sprachliche Wand, die Versprechung und Versprechen (und manchmal auch Verbrechen) voneinander unterscheidet, ist hauchdünn. (Sie lernen solche Familienähnlichkeiten, aber auch die dazu gehörenden Unterschiede am leichtesten durch den spielerischen Gebrauch der Worte kennen, der die unterschiedlichen Möglichkeiten der grammatischen Verwendung deutlich macht. So heißt es im einen Fall »Jemandem etwas versprechen«, im anderen aber »sich versprechen«.)
Kurzum: Die entscheidende Frage lautet, welche Faktoren tatsächlich dazu beitragen, die Grundlage für ein gelungenes, glückliches Leben zu legen. Was befähigt uns, gut mit den vielfältigen Schwierigkeiten und der Komplexität des Lebens umzugehen? Welcher von den beiden Kandidaten – Glauben oder Vernunft – erweist sich dabei als der verlässlichere? Auf welchen sollte man setzen? Und wenn man alles auf einen der beiden Kandidaten setzt: worauf setzt man dann eigentlich? Was, wenn weder der Verstand bzw. die Vernunft noch der Glaube alleine es sind, auf die man sich verlassen kann (oder will)? Ist es nicht ohnehin klüger, sich mit dem Besten aus beiden Welten vertraut zu machen?
Genau dies ist der Hintergrund, vor dem das Buch die Frage nach dem Verhältnis von »Glauben« und »Vernunft« – von Religion und Wissenschaft bzw. säkularer Vernunft – stellt. Für die meisten Menschen scheinen zumindest im Westen Glauben und Vernunft diametral entgegengesetzte Welten zu sein, die sich nur in wenigen Punkten berühren. Es scheint also, als könne man nur der einen oder der anderen Seite angehören, ohne dass es einen mittleren Weg gibt.
Im amerikanischen Sprachgebrauch gibt es für eine solche Situation den Ausdruck »to sit on the fence«. Wörtlich übersetzt heißt das »auf dem Zaun sitzen«. Dieser Ausdruck kann sowohl bedeuten, dass man sich nicht entscheiden kann und völlig unschlüssig ist. Es kann aber auch gemeint sein, dass man keiner Partei alleine angehören will und sich stattdessen einen höheren Betrachtungs- oder Aussichtspunkt sucht – den erhöhten Zaun. Dieser ist immer da zu finden, wo die eine Welt an die andere stößt und Abgrenzungen erforderlich sind. Denn Zäune markieren Grenzen und Kampfzonen. Wer jedoch in der Lage ist, sich auch in einer angespannten Situation eine gute Übersicht zu verschaffen und nicht sofort auf eine Seite zu schlagen, wird bald schon feststellen, dass das Leben dies- und jenseits des Zaunes so unterschiedlich nicht ist. Auch Gläubige machen Gebrauch von der Vernunft, während selbst die rationalsten Menschen zugeben müssen, dass es am Ende all ihrer Zweifel etwas gibt, auf das sie sich verlassen müssen. Haben also diejenigen, die glauben, Glauben und Vernunft durchaus miteinander in Harmonie bringen zu können, am Ende recht? Oder verstehen sie im Grunde weder das eine noch das andere richtig und weichem dem Ernst der Lage aus, indem sie versuchen, keinem Lager anzugehören?
Die These dieses Buches ist, dass es sich lohnt, die Unannehmlichkeit des »Zwischen-den-Stühlen-Sitzens« auf sich zu nehmen und nach einer dritten Position Ausschau zu halten. Dieser mittlere Weg ist möglicherweise nicht nur der weisere, sondern auch der langfristig fruchtbarere. Aber ist solch ein Weg angesichts der heftig entflammten Diskussion um die Gottesfrage, den »neuen« Atheismus, die Evolutionslehre, den Fundamentalismus (auch in der christlichen Form) und all die anderen, zuweilen hochmoralischen Fragen, die in Richtung auf eine scharfe Auseinandersetzung zwischen Glauben und Vernunft weisen, überhaupt gangbar?
Selbst bei oberflächlicher Betrachtung wird man einräumen müssen, dass es neuerdings trotz aller Spannungen durchaus eine Annäherung zwischen Wissenschaft und Religion gibt – wobei sich eine solche Annäherung meist eher auf den (westlichen) Buddhismus als auf das Christentum bezieht. Die Entdeckung seltsamer Phänomene der Verschränkungen zwischen entferntesten Elementarteilchen in der Quantentheorie; neue, bislang nicht gelöste Fragen der Kosmologie und Astrophysik, die u.a. auf neuen Daten wie der Entdeckung dunkler Materie und Energie beruhen; aber auch die Entdeckung religiöser Gefühle als Gegenstand der neurowissenschaftlichen Forschung: All das deutet auf eine gewisse »Konvergenz« hin. Noch ist allerdings unklar, wie tragfähig und belastbar eine derartige Annäherung ist. Kann ein »aggiornamento«, wie es Papst Johannes XXIII. und das zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) anstrebten, tatsächlich gelingen, indem die Probleme klar angesprochen und an den Tag (it. giorno) gebracht werden, um sie auf diese Weise zu lösen und eine Angleichung des Glaubens an heutige Verhältnisse zu erreichen?
Im Westen herrscht derzeit überwiegend die Meinung vor, dass Religion und Wissenschaft bzw. die Welt des Glaubens und die Welt der Vernunft letztlich nicht miteinander vereinbar sind. Allein der Gottesbegriff bereitet zahllose Probleme. Hinzu kommen weitere, wissenschaftlich kaum zu belegende Annahmen über das Leben nach dem Tod, die Unsterblichkeit der Seele oder die Wiedergeburt, aber auch über die Abstammung und das Wesen des Menschen. Eine Annäherung zwischen Glauben und Vernunft wird für viele zusätzlich erschwert durch eine tendenziell autoritäre Haltung religiöser Führer, wenn es um Fragen der Macht und der Institution geht (etwa Frauen betreffend). Eine in überholten Formeln sich ergehende, unbewegliche Dogmatik erschwert die Diskussion. Mit den gewohnten dogmatischen Antworten ist man kaum in der Lage, den Fragen der Zeit auf Augenhöhe zu begegnen. Weitere Probleme belasten das Verhältnis: eine Geschichte des sexuellen Missbrauchs und des Missbrauchs von Autorität, der Umgang mit Homosexualität – ja generell mit Körperlichkeit und Sexualität – oder der Umgang mit der Vielfalt von Meinungen und Lebensformen innerhalb einer laizistischen, demokratischen und pluralistischen Gesellschaftsordnung.
Dieses Buch will zeigen, dass viele dieser Konflikte zwar faktisch existieren, in weiten Teilen jedoch auf irrigen Annahmen und Illusionen beruhen. Das betrifft sowohl Annahmen über die Struktur und Verlässlichkeit der Vernunft als auch den Kern religiösen Glaubens, der selbst von frommen Vertretern zuweilen nur höchst unzureichend und manchmal gar nicht verstanden wird. Insofern ist das Buch, das Sie in der Hand halten, eine Übersetzungshilfe. Es versucht, einige grundsätzliche Fragen von der Sprache des Glaubens in die Sprache der Vernunft und zurück zu übersetzen. Genau dieses Gemeinsame, das von der einen in die andere Sphäre oder Welt über-setzbar ist, bildet seinen Gegenstand. Allerdings gebe ich zu, dass dieses Buch weder ein erschöpfendes Wörterbuch noch eine streng wissenschaftliche Grammatik ist (die wie die meisten Grammatiken sehr technischer, rein akademischer Natur und daher schwer zu lesen wäre). Dennoch hilft dieses Buch ähnlich einem Sprach- und Reiseführer, sich in den behandelten Welten zurechtzufinden. Es erleichtert dem Leser, besser von der einen in die andere Welt zu übersetzen. Das ermöglicht zweierlei: zum einen statt an einer Ausweitung der Kampfzone zu arbeiten, den einen oder anderen Konflikt im Streit um Gott, Glauben und Vernunft lösen zu können. Zum anderen überwindet die Übersetzung die weitverbreitete Befangenheit des Kirchenpersonals, einzig und allein für die jeweilige Konfession zu sprechen. Es fällt auf, wie wenig der Klerus in der Lage ist, das, wofür er steht, auf eine verständliche Art und Weise zu erklären. Oft bleibt unklar, was ein Kleriker eigentlich wirklich glaubt. Tatsächlich ist Glaube mehr als konfessionelle Bindung, aber auch mehr als private Überzeugung. Wer das Verhältnis des Glaubens zum Wissen nicht durchdacht hat, wird diese und andere Fragen nicht erklären können und eine vernünftige Auskunft schuldig bleiben. Doch das setzt voraus, eine solche Auskunft überhaupt geben zu wollen und sich den Problemen des Übersetzens zu öffnen.
Vermutlich werden Sie dieses Buch umso weniger brauchen, je mehr Sie davon überzeugt sind, bereits alles zu wissen. In diesem Fall haben Sie vermutlich auch die Frage geklärt, ob Sie tatsächlich wissen oder nur zu wissen glauben. Zum Test können Sie für sich ja folgende Fragen beantworten:
Ist es vernünftig zu glauben?
Sind Religion und Vernunft miteinander vereinbar? Wenn ja – unter welchen Bedingungen?
Glauben Sie, dass Glauben und Vernunft einander stets widersprechen? Oder neigen Sie eher zu der Ansicht, dass man sie miteinander in Einklang, in Harmonie bringen kann? Können Sie diese Meinung begründen?
Falls Sie glauben – was genau verstehen Sie darunter? Und warum glauben Sie?
Und falls Sie im Gegenteil nicht glauben – was genau bedeutet das für Sie? Und was wäre das Gegenteil zu Ihrer Haltung?
Wissen Sie die Antwort auf diese Fragen, oder glauben Sie nur, dass Sie sie wissen? Können Sie sie überhaupt wissen? Wie sicher sind Sie sich?
Glauben Sie an die Kraft der Vernunft? Wenn ja – was genau verstehen Sie darunter? Ist Ihr Glaube vernünftig? Falls ja: Lässt er sich begründen? Woher wissen Sie, ob dieser Glaube an die Vernunft nicht trügt?
Können Sie die verschiedenen Verwendungen von Wörtern wie »Glauben« oder »Vernunft«, »wissen« und »glauben« klar voneinander unterscheiden?
Falls Sie eine oder mehrere dieser Fragen nicht beantworten können, lohnt sich vermutlich ein intensiverer Blick in dieses Buch.
Zum Anfang: Der Ausweg aus dem Fliegenglas
Erkenntnisgewinn auf offener See
Als ich das erste Mal von meinem Projekt erzählte, das Problem »Glauben und Vernunft« auf eine verständliche Weise darzustellen, etwas Klarheit zu schaffen und das Ganze in manchen Punkten einer Lösung zumindest näherzubringen, erntete ich skeptische Blicke. Vor allem die Theologen waren misstrauisch (und sind es vermutlich geblieben). Dieses Problem anzugehen ist in der Tat nicht ganz einfach. Selbst bei einem flüchtigen Blick in eine gut sortierte Bibliothek, die nicht nur repräsentative Literatur über Philosophie und Theologie bietet, sondern auch Bücher der Naturwissenschaften, Germanistik, Ideengeschichte, Erkenntnistheorie, Logik und einiger anderer verwandter Themen enthält, steht man buchstäblich in einem gigantischen Blätterwald. »Glaube und Vernunft« – das bringt nicht nur bei Google bei der deutschen Suche über eine Viertelmillion Einträge und im Englischen rund 700 000. Das Thema war ohne Übertreibung vermutlich das meistdiskutierte Thema des Abendlandes überhaupt. Denn im Grunde kann man die Geschichte der Philosophie und der sich entwickelnden Naturwissenschaften – und die Geschichte der Religionen und der Theologie ohnehin – über Jahrhunderte hinweg entlang dieses einen roten Fadens erzählen: als Geschichte der Auseinandersetzung und schließlich der Emanzipation »der Vernunft« vom »Glauben«. Immer wieder geht es bei diesem erbitterten Streit darum, zu klären, wo wir uns überhaupt befinden und was die verlässlichen Grundlagen unseres Lebens sind. Kurz: Wer sich im Denken kritisch orientieren möchte, gleich ob er Naturwissenschaftler, Gläubiger, Atheist, Philosoph oder Künstler ist, wird nicht umhinkommen, sich mit dieser für die Existenz des Menschen wesentlichen Frage zu befassen, ja, sie zumindest für sich selbst zu beantworten. Doch wer kann schon sagen, dabei auf einigermaßen sicherem Boden zu stehen? Das ist in der Tat viel schwieriger, als es auf den ersten Blick scheinen mag – stehen doch die Grundlagen selbst, der feste Boden, zur Disposition.
Der österreichische Philosoph, Ökonom und Mathematiker Otto Neurath (1882–1945), der in Wien geboren wurde, Mitglied des berühmten Wiener Kreises und ein Zeitgenosse von Ludwig Wittgenstein war, brachte die Lage sehr treffend auf den Punkt. »Wie Schiffer sind wir«, sagte er, »die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können.« Was Neurath damit ansprach, war der Umstand, dass nichts ohne Voraussetzungen funktioniert. Was immer wir anfangen, worüber auch immer wir nachdenken, was auch immer wir wahrnehmen, sehen oder fühlen: Es geschieht stets in einem Raum, der durch andere Menschen, durch eine Geschichte und die Evolution des Lebens bestimmt wurde, die uns an eben den Punkt gebracht haben, an dem wir stehen. Doch wie können wir herausfinden, wo wir stehen? Sicher, man könnte unter den Planken nachschauen. Doch das ist kein guter Gedanke, wenn man sich auf hoher See befindet. Wo auch immer man eine Planke herausreißt, muss man sie durch etwas anderes ersetzen; sonst gerät der gesamte Prozess in Gefahr. Mit einem Leck im Boot kommt man nicht weit.
Weder der Wissenschaftler noch der Philosoph oder Theologe (oder wer auch immer!) ist in der Lage, sich wie Baron von Münchhausen am eigenen Schopf aus der Situation zu ziehen, in der er steckt – mag der Morast auch noch so erstickend sein. Wir müssen unser Schiff auf hoher See umbauen. Aber wir können uns nicht aus der See hieven – denn auch dazu bräuchten wir wieder ein Schiff. So muss man immer auf etwas aufbauen, das uns vorausgeht; das jedem Erkennen, jedem Denken vorausgeht. Verfolgt man die Schritte in die Vergangenheit zurück, so werden sie sich nach Jahrtausenden und Jahrmillionen irgendwo dort verlieren, wo die ersten Fußabdrücke aufrecht gehender Primaten in der Lava eines erkaltenden Vulkans gefunden wurden. Afrika ist die eine Wiege aller Menschen – daran lassen neueste genetische Untersuchungen keinen Zweifel mehr (was die Sache, wenn man sie etwas entspannt und nicht gleich wörtlich nimmt, in eine gewisse Nähe zur Geschichte von Adam und Eva rückt).
Wie aber soll man auf hoher See in einem Schiff, das man nicht verlassen kann, Informationen über die fundamentalsten Dinge, über die Voraussetzungen von allem sammeln? Worauf kann man sich überhaupt berufen (wenn doch die Planken, auf denen man steht, nur wieder Teile eines Schiffes sind, das von den Menschen, die vor uns lebten, gebaut bzw. umgebaut wurde)? Auf Neuraths Schiff gibt es nichts Fundamentaleres als das Schiff selbst und den Ozean, der es umgibt. Es gibt nur eine Möglichkeit, weiterzukommen: Man bindet die eine Planke an die andere. Weniger bildhaft gesprochen: Man verknüpft Informationen und Gedanken so, dass das Ganze schwimmfähig bleibt. »Die Physik ist ein gutes Beispiel für diese Vorgehensweise«, schreibt Christopher von Bülow. »Die Physik erklärt uns z.B., woraus gewöhnliche physikalische Gegenstände bestehen: aus Molekülen, Atomen, Elementarteilchen, Quarks, Strings usw. In gewissem Sinne liefert sie uns ein ontologisches Fundament für die physikalischen Gegenstände, indem sie uns sagt, woraus diese bestehen. Aber sie sagt nicht: ›Wir haben herausgefunden, dass alle Materie aus Atomen (Elementarteilchen …) besteht; damit ist alles klar.‹ Denn was Atome sind, ist erst recht unklar.«[1] In einer meiner Sendungen über das CERN und die Entstehung des Universums fragte ich meine Gäste nach den neuesten, zuweilen abenteuerlich klingenden physikalischen Theorien – und vor allem nach unserem Verständnis von Materie. Die Kernfrage lautet: Was ist eigentlich Materie? Wissen wir das heute? Das Erstaunliche ist ja, dass wir erst seit einigen Jahren wissen, dass wir über Jahrhunderte hinweg lediglich nur einen kleinen Bruchteil dessen gesehen haben, was das gesamte Universum ausmacht. Dennoch dachten wir die ganze Zeit, das, was wir sähen, wäre alles. Nach dem derzeitigen Stand der kosmologischen Theorien trägt Materie nur rund 30 Prozent zur Gesamtbilanz bzw. zur Gesamtdichte des Universums bei. Die uns vertraute Materie, die aus Protonen, Neutronen und Elektronen besteht und aus der Galaxien, Sterne, Planeten, aber auch alle Lebewesen und wir Menschen entstanden sind, macht lediglich knappe fünf Prozent des gesamten Universums aus. Der größte Teil der Welt um uns herum ist also unsichtbar und wird daher Dunkle Materie bzw. Dunkle Energie genannt.
Meine Gäste waren sich schnell einig: Es gibt keine klare Definition von Materie. Wenn Physiker ehrlich sind, geben sie zu: Wir rechnen damit, wir gebrauchen Formeln, wir bauen Fahrzeuge und Atombeschleuniger und vieles mehr – aber wenn Sie uns genau fragen, was Materie, was Energie oder was Information wirklich sind, dann müssen wir passen. »Wirklich« bedeutet hier, dass sich jenseits der Irrtümer und Erkenntnisse von gestern ein neues Verständnis auftut. Doch auch dieses Modell wird nicht das letzte sein. Es gibt in diesem Sinn keinen sicheren Boden außerhalb unseres Schiffes. Genau das hatte Otto Neurath im Sinn. Wer eine Planke wegreißt, um zu sehen, woraus sie besteht, läuft Gefahr, dass in der Zeit, in der er sie im Labor untersucht, das gesamte Schiff voll Wasser läuft. Man kann einen Begriff daher nur durch einen anderen erklären oder »decken«. Die Möglichkeit, ein verbales Trockendock anzusteuern und die Sache ein für alle Mal zu reparieren, haben wir auf offener See nicht. Und es gibt auch kein weiteres Schiff jenseits von unserem, das wir benutzen könnten, um neue Planken zu holen und alles zu verbessern. All das werden wir nie haben. Auch fliegen können wir nicht. Aber brauchen wir nicht eine solche erhabene Perspektive, um navigieren zu können? Was heißt, »sich zu orientieren«? Wie soll das unter diesen Umständen möglich sein?
Was bedeutet, »sich im Denken orientieren«?
Frühe Zeichnungen des Menschen, Bilder der Himmelskörper, die (in der Tat lebensnotwendige) Aufgabe, den richtigen Zeitpunkt der Aussaat zu bestimmen oder auf hoher See, aber auch an Land richtig zu navigieren, begleitet den Menschen von Anfang an. Natürlich beschäftigte die Frage seit Beginn der Denkgeschichte auch die Philosophen – darunter Immanuel Kant, der sich mit dem Thema in einer kleinen Schrift befasste, die 1786 einige Jahre nach Abschluss der Kritik der reinen Vernunft erschien. Sich im Denken zu orientieren, fand Kant, dies überhaupt zu können, sei doch nicht nur die erste Aufgabe, sondern die Leistung der Philosophie, ja der Vernunft und jeder Form von Erkenntnis schlechthin. Dabei hatte Kant durchaus das Bild vom Schiff im Sinn. Denn sich zu orientieren bedeute, so Kant, »aus einer gegebenen Weltgegend (in deren vier wir den Horizont einteilen) die übrigen, namentlich den Ausgang zu finden«.[1] Zur Mittagszeit ist die Sonne im Süden, geographisch orientiere ich mich an Details des Himmels, auch nachts – und ansonsten gilt, dass man vom Gefühl Gebrauch machen muss, das mit dem einfachen Umstand der Wahrnehmung »eines Unterschiedes an meinem eigenen Subjekt, nämlich der rechten und linken Hand«. Doch ist alles Gefühl? Kant streitet das nicht ab, plädiert aber dafür, den Begriff der Orientierung zu erweitern und neben den subjektiven Unterscheidungen auch auf objektive Gegenstände (der Polarstern, den man »ins Auge nimmt«), auf Logik und die Möglichkeiten der mathematischen Orientierung im Raum zurückzugreifen. Doch dabei wird alles immer schwieriger. Denn auch die Vernunft hat ihre Voraussetzungen. Und sie hat nicht das Recht, wie Kant sagt, einfach einen subjektiven Grund, etwas, das ihr gut passt, vorauszusetzen, also anzunehmen und dabei so zu tun, als könne sie diese Annahmen »durch objektive Gründe wissen«. Irrtum und Überredung sind genau das: der Versuch, einen Grund für ein wahres Urteil für objektiv zu halten, obwohl er doch einzig und allein im Subjekt selber liegt. Diese Denkfigur machte Schule. Wie viele religiöse Sätze beanspruchen, objektiv gültig zu sein – und sind doch bei näherem Hinsehen nichts anderes als Privatmeinungen, die erst dann zu Wahrheiten werden, wenn es, wie Kant sagt, möglich ist, diese Überzeugungen so mitzuteilen, dass ihr Fürwahrhalten »für jedes Menschen Vernunft gültig befunden werden kann«.[2] Diese Übereinstimmung muss gerade stattfinden, »ungeachtet der Verschiedenheit der Subjekte unter einander«. Was Kant hier formulierte, wurde Jahrhunderte später von Jürgen Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Handelns ausbuchstabiert. Kants Idee hat bis heute Gültigkeit behalten. »Die Übereinstimmung der Menschen im Rechnen ist keine Übereinstimmung der Meinungen oder Überzeugungen«, bemerkt Wittgenstein in den Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik.[3] Es geht also nicht darum, subjektive Überzeugungen, innere Bilder oder Zustände irgendwie (wie eigentlich?) miteinander abzugleichen, einander anzupassen oder abzustimmen. Rechnen funktioniert nicht, weil wir innere Erleuchtungszustände haben, sondern weil wir auf eine bestimmte Art und Weise Regeln folgen und entsprechend handeln.
Liegt der Unterschied zwischen einem Menschen, der glaubt, und einem, der allein seiner Vernunft folgt, in seinem Handeln? Ja und Nein, also: nicht notwendigerweise. Denn beide, Glauben und Vernunft, können in einer Notsituation helfen. Und beide orientieren sich an Regeln. Kant wollte auf etwas anderes hinaus: auf den Status unserer Erkenntnis. Das »trügliche Fürwahrhalten« – er spricht von einer bloßen »Begebenheit in unserem Gemüt« – stellt eben keine wirkliche Erkenntnis dar. Wenn ich einen anderen Menschen zum Glauben oder zu einem anderen Glauben zu überreden versuche: Unter welchen Bedingungen und aufgrund welcher Erkenntnisse kann ein solcher Versuch gelingen? Gelingt er auch dann, wenn am Ende nichts außer meinem subjektiven Wollen und meiner eigenen Vorstellung, meiner Erfahrung von der Welt, der Grund des Überredens wäre? Dies ist eine schwache Grundlage. An späterer Stelle werde ich noch einmal ausführlicher auf die wichtige Unterscheidung zwischen Meinen, Glauben und Wissen zurückkommen. Sie ist sehr hilfreich, um derartige Fragen zu lösen, auch wenn sie leider nicht die Frage beantwortet, was Glauben im religiösen Sinne meint. Das tiefer gehende Problem besteht ja gerade darin, dass das religiöse Glauben nicht in ein Wissen überführt werden kann. Kant spricht in diesem Zusammenhang vom »doktrinalen Glauben«, dessen Kernsatz »die Lehre vom Dasein Gottes« ist.[4] Richtig verstanden sei dieser doktrinale Glauben »ein Ausdruck der Bescheidenheit in objektiver Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjektiver«.[5] Kant sagt also, dass religiöser Glaube sich in Bescheidenheit üben müsse, wenn es um die Behauptung geht, man könne die Existenz Gottes objektiv, also naturwissenschaftlich beweisen. Auf der subjektiven Seite, der Innensicht der Welt, sei Glaube jedoch ein festes Zutrauen. Alles andere würde bedeuten, mehr über eine andere Welt oder Weltursache zu behaupten, »als ich wirklich aufzeigen kann«. An dieser Stelle sei nur angedeutet, worauf nach Kant die innere Festigkeit des Glaubens hinausläuft: auf den »moralischen Glauben«. Wie im Brief des Paulus an die Römer argumentiert Kant, dass das Sittengesetz zwar allein aus der Kraft der Vernunft erkannt werden kann – aber dadurch noch nicht notwendig ausgeführt wird. Im Gegenteil: Wer sittlich handelt, wer als wahrer Mensch anderen Menschen begegnet, muss ja gerade, wie die christliche Tradition lehrt, damit rechnen, am Kreuz zu enden. Diese Möglichkeit wird, aus verständlichen Gründen, möglichst vermieden. Doch Kant nimmt diesen Hinweis auf das mögliche Scheitern dessen, der sittlich gut handelt, sehr ernst. Dies ist der pragmatische, harte und auch vor der Vernunft immer wieder bestehende Kern des Christentums. Wer gut handelt, dem wird es längst nicht gutgehen. »Da aber die sittliche Vorschrift zugleich meine Maxime ist (wie denn die Vernunft gebietet, daß sie sein soll), so werde ich unausbleiblich an ein Dasein Gottes und ein künftiges Leben glauben, und bin sicher, daß diesen Glauben nichts wankend machen könne, weil dadurch meine sittlichen Grundsätze selbst umgestürzt werden würden, denen ich nicht entsagen kann, ohne in meinen eigenen Augen verabscheuenswürdig zu sein.«[6] Der Philosoph, der wie kein anderer die Unmöglichkeit eines Gottesbeweises gleich welcher Form logisch glasklar bewiesen hat, wird hier zum Gläubigen –, um seine Sittlichkeit zu retten und sich selbst vor einem Ekel zu bewahren, den erst die Moderne mit Schriftstellern wie Jean-Paul Sartre oder Albert Camus vollends zu beschreiben in der Lage war. Doch dazu später. Denn zunächst geht es ja noch um die Klärung der Frage, was »sich im Denken orientieren« bedeutet. Die Orientierungsfrage verweist auf die Notwendigkeit der Aufklärung. Denn wer sich aufklärt, beginnt, sich im Denken zu orientieren.
Was ist Aufklärung?
Die Vernunft ist für Kant die treibende Kraft dieser Orientierung. Sie hat einerseits das Recht, aber eben auch die Pflicht, »sich im Denken, im unermeßlichen und für uns mit dicker Nacht erfülleten Raum des Übersinnlichen, lediglich durch ihr eigenes Bedürfnis zu orientieren«.[1] Übersinnliches lässt sich viel denken, sagt Kant. Daran hat sich bis heute nichts geändert, wobei ich einräume, dass es zu Kants Zeiten deutlich weniger Menschen gab, die der festen Ansicht waren, von Außerirdischen entführt und zu Experimenten missbraucht worden zu sein. Immerhin hat sich auch Kant wiederholt seine Gedanken über Außerirdische gemacht. »So möchte ich wohl alles das Meinige darauf verwetten«, notierte Kant, »daß es wenigstens in irgend einem von den Planeten, die wir sehen, Einwohner gebe.«[2]
Wenn man Übersinnliches, Absurdes, schlicht nicht zu Beweisendes in Hülle und Fülle behaupten kann: Wie kommt man dann weiter? Wie zu einer Klärung? Und was bedeutet es, sich, wie Kant sagt, in einem solchen Fall durch das eigene Bedürfnis zu orientieren? Liegt nicht gerade in diesem Wunsch die Anmaßung, der eigentliche Fehler der Vernunft begründet? Sicher: Ein strenger christlicher oder auch islamischer Fundamentalist würde das vermutlich so sehen und am Ende kaum durch ein vernünftiges Argument zu überzeugen sein. Die Literatur zur Frage, was es eigentlich bedeutet, sich überzeugen zu lassen, welche Wahrheitskriterien gelten und welche Maßstäbe und Voraussetzungen in einem kritischen und herrschaftsfreien Diskurs einzuhalten sind (Jürgen Habermas), umfasst inzwischen selbst ganze Abschnitte von Bibliotheken.
Am Ende aber geht es, welchen Standpunkt auch immer man einnimmt, um eben diese Emanzipation des eigenen Bedürfnisses, sagte Kant. Auch der Fundamentalist behauptet ja eben dies: dass man seinen Argumenten (und damit dem Glauben) Glauben schenken und sich von seinen scheinbar wichtigeren Bedürfnissen (die »in Wahrheit« Kräfte des Unglaubens, der Sünde, des getrübten Verstandes sind) emanzipieren müsse. Es geht also um die Frage der Wahrheit und um die Bemühung des Denkens, den »wahren« Bedürfnissen zu folgen. Doch sind diese nicht die Bedürfnisse des Denkens? Worin diese bestehen: Darauf hatte Kant 1784 in seiner Schrift »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?« eine inzwischen berühmt gewordene Antwort gegeben, nach der ein ganzes Zeitalter benannt worden ist. Kant beginnt seine Schrift gleich im ersten Satz mit einem Paukenschlag. »Aufklärung«, schreibt er, »ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Ist also der Wahlspruch der Aufklärung.«
Dieser Aufruf ist bis heute gültig. Wer sich orientieren will, wird davon Gebrauch machen müssen. Um das sapere aude voranzubringen, scheut Kant vor keiner Kritik. Er zeigt Mut, indem er kein Blatt vor den Mund nimmt. »Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Theil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben … Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurtheilt, etc., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nöthig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann.« Noch nicht einmal das ist heute nötig; das Internet bietet die Möglichkeit, zu surfen, Antworten zu finden, auch ohne zu denken.
Zurück zur Frage der Orientierung. »Den letzten Probierstein der Zulässigkeit eines Urteils«, befand Kant, sei eben »allein in der Vernunft zu suchen«, die der »Wegweiser oder Kompaß« ist, »wodurch der spekulative Denker sich auf seinen Vernunftstreitereien im Felde übersinnlicher Gegenstände orientieren, der Mensch von gemeiner doch (moralisch) gesunder Vernunft aber seinen Weg, so wohl in theoretischer als praktischer Absicht, dem ganzen Zwecke seiner Bestimmung völlig angemessen vorzeichnen kann; und dieser Vernunftglaube ist es auch, der jedem anderen Glauben, ja jeder Offenbarung, zum Grunde gelegt werden muß«. Zumal am Anfang ja nicht irgendein, sondern, wenn man der Offenbarung Glauben schenkt, Gottes Wort war – das dann von Glauben und Vernunft in gleicher Weise erkannt werden kann. Gleich zu Anfang des Briefes an die Römer, eines der ersten Zeugnisse der entstehenden christlichen Theologie, schreibt Paulus in der Übersetzung des Theologen Klaus Berger: »Gott, der Unsichtbare, hat die Welt geschaffen, und wenn man vernünftig nachdenkt, kann man von der Schöpfung, die man sieht, schließen und erkennen, daß er ewig, mächtig und göttlich ist. Die Menschen können sich also nicht herausreden« (oder wie Luther übersetzt: sie haben keine Entschuldigung).[3]
Nebelbänke der Erkenntnis
Kants Standpunkt ist messerscharf und klar: »Nehmt an, was euch nach sorgfältiger und aufrichtiger Prüfung am glaubwürdigsten scheint, es mögen nun Facta, es mögen Vernunftsgründe sein [wir würden heute sagen: gleich, ob es aufgrund von Fakten so scheint oder wegen besonders überzeugender Argumente, aufgrund eines »Diskurses«]; nur streitet der Vernunft nicht das, was sie zum höchsten Gut auf Erden macht, nämlich das Vorrecht ab, der letzte Probierstein der Wahrheit zu sein.«[1] Der Vorteil von Kants Zugang zur Frage nach den grundlegenden Urteilen und der Möglichkeit, am Ende zu wahren Aussagen zu kommen, besteht darin, eine Grenze von innen zu ziehen. Das, was »außerhalb« der Grenzen unserer Erkenntnis ist – Kant nennt es das »Ding an sich« –, können wir nicht erkennen. Wenn wir uns nicht von draußen, nicht von außerhalb oder aus der Sicht der »Welt an sich« sehen können, um zur Wahrheit zu gelangen, dann haben wir nur eine einzige Chance: Wir müssen uns erkennen, indem wir die Grenze von innen ziehen. Innerhalb unseres Erkenntnisvermögens, innerhalb unserer Sprache. Nur so können wir die eine und die andere Seite der Grenze und die Grenze selbst denken. Es ist etwas außerhalb dieser Grenze da, es zeigt sich, es »affiziert«, d.h. berührt uns. Aber es liegt außerhalb der Bedingtheiten unserer Erkenntnis.
Kant, der ein glänzender Stilist sein kann, beschreibt das Problem, auf das er mehrfach innerhalb seiner Kritik der reinen Vernunft stößt, so: »Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset und jeden Theil davon sorgfältig in Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen und jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ist eine Insel und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrheit (ein reizender Name), umgeben von einem weiten und stürmischen Oceane, dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo manche Nebelbank und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt und, indem es den auf Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann. Ehe wir uns aber auf dieses Meer wagen, um es nach allen Breiten zu durchsuchen und gewiß zu werden, ob etwas in ihnen zu hoffen sei, so wird es nützlich sein, zuvor noch einen Blick auf die Karte des Landes zu werfen, das wir eben verlassen wollen, und erstlich zu fragen, ob wir mit dem, was es in sich enthält, nicht allenfalls zufrieden sein könnten, oder auch aus Noth zufrieden sein müssen, wenn es sonst überall keinen Boden giebt, auf dem wir uns anbauen könnten.«[2]
Es gibt keinen anderen Boden als den, den wir haben. Dieser Ansatz Kants, zwischen Ozean, den Inseln des Archipels der reinen Vernunft und trügerischen Nebelbänken hin und her zu navigieren, sollte bis heute der bestimmende Denkweg im Westen bleiben. Otto Neuraths Metapher ist dafür der beste Beleg. Doch trotz der Unmöglichkeit, das Schiff zu verlassen, und trotz der Nebelbänke, die als Projektionsflächen für leere Hoffnungen dienen, gibt es etwas Unaussprechliches und Mystisches. Daran hielt Ludwig Wittgenstein mehr als 200 Jahre später fest. Es zeigt sich. Doch die Art und Weise, wie es sich zeigt, ist völlig unerwartet und anders, als die westliche Philosophie es sich erträumt hatte. Man kann weder auf Gott noch auf die metaphysischen Dinge, den Sinn oder die letzten Fragen (geschweige denn die Antworten) zeigen. Man kann sie in diesem Sinn nicht sehen wie Tische oder Stühle. Das Einzige, was man zeigen kann, sind die Beulen, die man sich beim Anrennen gegen jene Grenzfragen holt. Die Schmerzen, die den seelischen (oder sonstigen existentiellen) Blessuren folgen, sind echt. Das ist, in gewisser Weise, der Beweis dafür, dass es sich bei all dem nicht um Illusionen handelt. Die Nähe von Wittgensteins philosophischen Bemerkungen zu bestimmten religiösen Haltungen ist unübersehbar. Auch in den Religionen, die ein sogenanntes Bildverbot kennen – also an der Unbegreiflichkeit Gottes festhalten, so wie das Judentum und bestimmte Zweige des Christentums und des Islam –, gibt es ein Leiden an Gott. Er ist sozusagen als Anwesender im selben Raum; aber er ist unerkennbar. Doch so weit geht Wittgenstein nicht. Ihm reicht es, darauf aufmerksam zu machen, dass dort tatsächlich etwas ist – auch wenn es schwer, ja unmöglich ist zu sagen, was. »Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckungen irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen gegen die Grenzen der Sprache geholt hat«, schrieb Ludwig Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen. »Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckungen erkennen.«[3] Insofern ist es nur konsequent, dass Wittgenstein der Ansicht war, es gebe »nicht eine Methode der Philosophie, wohl aber gibt es Methoden, gleichsam verschiedene Therapien«.[4] Gibt es also eine Therapie, die uns weiterhilft?
Wittgenstein und der Ausweg aus dem Fliegenglas
Kant hatte eine innere Grenzziehung als Therapie vorgeschlagen. Die Vernunft, die wir in uns haben ebenso wie das Sittengesetz in uns sind die Probiersteine der Wahrheit. Kant plädierte dafür, damit aufzuhören, die Grenzen irgendwo dort draußen in einem windigen Ort der Ideen zu suchen. Stattdessen sollten wir suchen, wo wir gerade sind: Im Hier und Jetzt unserer (begrenzten) Möglichkeiten, innerhalb der Grenzen unserer Vernunft und unserer Sprache. Suchten die frühen Griechen bis hin zu den Metaphysikern des Mittelalters die Wahrheit oder Gott noch »dort draußen« und versuchten beides zu erkennen, als handele es sich um eine Art von magischem Gegenstand, einen Stein der Weisen, ein geheimnisvolles Bild, das nicht wie in Platos Höhlengleichnis ein bloßer Schatten auf der Wand wäre, sondern endlich die wahre Wirklichkeit selbst. Kant war nüchtern geworden. Wir sind in uns eingeschlossen, lautete seine Diagnose. Doch statt auf unserer Dummheit und unseren Vorurteilen zu beharren, sollten wir gemeinsam versuchen, uns unseres Verstandes zu bedienen. Und das bedeutet, nicht irgendwo in der Ferne, sondern in uns, im Denken nach den Grenzen suchen, indem wir unser eigenes Erkenntnisvermögen, unsere eigenen moralischen Möglichkeiten, unsere Hoffnungen, Sehnsüchte und Abgründe untersuchen. Das, so Kant, ist Aufklärung. Nicht anderen zu folgen, nicht bloßen Meinungen, Umfrageergebnissen, der Bild-Zeitung oder dem Fernsehen, sondern diesem radikalen eigenen Fragen. Sich orientieren heißt, selber zu denken, nicht denken zu lassen.
Doch wie findet man die Wahrheit, wenn es um eine Frage wie Glauben und Vernunft und demnach um eine existentielle, vielleicht Himmel und Hölle bedeutende Grenzziehung (so jedenfalls sah man es noch im Mittelalter und zuweilen auch noch in den heutigen Strafpredigten) geht? Und wie, wenn es um Gott, Gotteswahn, Fundamentalismus und die höchste Erkenntnis überhaupt geht? Wenn es auch um die Frage nach dem Menschen, nach dem Sinn seines Daseins, um Leben und Tod geht? Es sind diese Fragen, an denen sich immer wieder der religiöse Funke entzündet hat und dabei nicht selten die Vernunft auf dem Scheiterhaufen verbrannte.
Wittgenstein verfolgt Kants Weg weiter. Diesen Weg, der längst noch nicht zu Ende gegangen ist, nimmt der Titel »Ausweg aus dem Fliegenglas« auf. Er beruht auf einem Sprachbild Wittgensteins, in dem er andeutete, dass das Thema des Sich-Orientierens, des Zur-Wahrheit-Kommens, aber auch des Verhältnisses von Glauben und Vernunft etwas mit einer Art von Gefangenschaft zu tun hat. In seinem Buch Philosophische Untersuchungen, zwischen Bemerkungen, die damit zu tun haben, wie es überhaupt möglich ist, die Schmerzen anderer zu erkennen und zu wissen, dass sie Schmerzen haben und leiden, inmitten einer philosophischen Diskussion seelischer und körperlich bedrohlicher Zustände steht wie ein Fels in der Brandung dieser Satz: »Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.«
Ich weiß nicht, wie Sie es im Sommer handhaben, vor allem an warmen Sommerabenden, wenn man noch lange die Türen und Fenster geöffnet hat, aber doch, um zu lesen oder zusammenzusitzen, das Licht einschaltet. Unweigerlich kommen Motten und andere Insekten – und am nächsten Tag finden sich die Fliegen ein, die gegen die Scheiben prallen, hinter denen nun das Licht lockt, das mit einem Mal nicht mehr »drinnen«, sondern »draußen« ist. Die Umkehrung der Blickrichtung um das eigene Bedürfnis, endlich in die Freiheit zu entkommen, macht den größten Unterschied – nicht nur im Leben einer Fliege – aus. Meist habe ich in meinem Arbeitszimmer ein Glas stehen, mit dem ich Fliegen, Motten, seltener Schmetterlinge und Käfer, zuweilen aber auch Raupen und Spinnen einfange. Dann schiebe ich ein Blatt Papier zwischen Glas und Scheibe und bringe die Tiere nach draußen. Da ich es nicht immer sofort mache, muss die eine oder andere Fliege eine Zeit in ihrem Gefängnis verbringen. Das Gemeinste an diesem Gefängnis, das irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes aufgehoben werden muss, damit für die Fliege der Ausweg erkennbar und frei wird, ist, dass dieser Ausweg nicht als solcher erkennbar ist. Beim Fliegenglas – einer gläsernen Insektenfalle – gibt es durchaus einen Ausweg – den Weg nämlich, durch den die Fliege, angelockt vom Geruch von Früchten oder Zuckerwasser, hereingekommen ist. Einmal ins Innere des Glases gelangt, finden die gefangenen Insekten auf diesem Weg nicht mehr hinaus, weil sie aufgrund der gleichmäßigen Helle um sie herum vollständig die Orientierung verlieren.[1] Obwohl der Weg nach draußen also unverändert und unversperrt bleibt – es ist derselbe Weg, der in das Problem hineingeführt hat –, findet die Fliege nicht mehr hinaus. Sie kann den Weg nicht als Weg erkennen. Dies, scheint Wittgenstein sagen zu wollen, ist auch unser Problem. Je klarer die Scheibe ist, gegen die wir immer wieder angehen, d.h. je unsichtbarer die Grenzen sind, die uns umgeben, desto deutlicher wird zwar das lockende Draußen, das »Jenseits« der Grenze und unseres Eingeschlossen-Seins wahrgenommen. Doch dieses Jenseits erreichen wir nie, obwohl es Antrieb für weitere Ausbruchsversuche bleibt. Wir haben die Übersicht verloren, gerade weil wir es mit einer durchsichtigen Grenze zu tun haben, die uns gefangen hält. Wir stoßen mit dem Kopf immer wieder gegen ein Verhängnis, in das wir, ohne es zu merken, hineingeraten sind. Keine Mauer, keine undurchdringliche Wand, kein Beton, sondern ein durchsichtiges, transparentes Medium, das es zulässt, zu sehen und gesehen zu werden, ist unser Verhängnis. Es sei denn, wir finden den Ausweg. Für Wittgenstein besteht dieser Ausweg darin, die Übersicht zurückzugewinnen. Denn es ist möglich, »den vorhandenen Weg nach draußen durch richtige Sicht der Situation zu erkennen«.[2]
Höhlenausgänge
In seinem berühmten Buch Höhlenausgänge, das 1989 erschien, widmete der Philosoph Hans Blumenberg diesem Bild vom Fliegenglas ein eigenes Kapitel. Ziel seines Buches war es, all die Metaphern und Bilder zu deuten, die letztlich auf Platos berühmtes Höhlengleichnis zurückgingen, in dem wir als angekettete Lebenszeitgefangene einem ewigen Schattenspiel zuschauen müssen, das eine Quelle reinen Lichts hinter uns an die Wände der Höhle vor uns zeichnet, ein Licht, das wir nie direkt sehen können, weil wir gefesselt sind und uns nicht umdrehen können. Wie entrinnt man aus dieser Gefangenschaft? Wie kann man die Höhle verlassen, um, in Platos Sprache, endlich nicht nur Schein und Trug, sondern der Wahrheit, dem reinen Licht, der Welt der Ideen selbst zu begegnen, deren bloßer Abglanz die Wirklichkeit ist?
Wittgenstein war weit davon entfernt, ein idealistischer Platoniker zu sein. Wenn überhaupt, war er Mathematiker und Pragmatiker. Und er verstand etwas vom Leiden, gegen das er die Philosophie setzen wollte als Instanz oder Weg, der Fliege einen Ausweg aus ihrem durchsichtigen Gefängnis zu weisen. Hans Blumenberg macht darauf aufmerksam, dass Wittgenstein an zwei Vorläufer der Fliegenglasparabel anknüpft.[1] Ich selber vermute, dass es noch einen dritten Text gibt, den Wittgenstein gekannt haben könnte. Zum einen gibt es einen leider unvollständigen Brief, den der Jurist und Philosoph Paul Yorck von Wartenburg (1835–1897) an seinen Freund Wilhelm Dilthey schrieb, den Begründer der Geisteswissenschaften, aus denen er die Hermeneutik – die Lehre und Kunst vom Verstehen – und die sogenannte verstehende Psychologie entwickelte. Von Wartenburg schreibt 1893: »Wissenschaftlich bin ich noch immer tot. Ich spüre keine Lust, wissenschaftliche Bücher in die Hand zu nehmen. Das Denken bewegt sich im Zirkel und die Leute erscheinen mir wie Fliegen, die immer wieder an die Glasfenster stoßen, bei dem Versuch hinaus und weiter zu kommen.« Dass die Menschen an das Glasfenster stoßen, mag so klingen, als seien sie ungelenkig oder dumm. Doch das anzunehmen hieße, die Umstände des Lebens jenseits der durchsichtigen Grenze ganz und gar zu verkennen. Als Ludwig Wittgenstein, der aus einer reichen Familie stammte, nach den schrecklichen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges mit seiner Schwester über das Vorhaben sprach, Dorfschullehrer zu werden, entgegnete Hermine Wittgenstein ihm mit Unverständnis. Das sei ja so, als würde man ein Präzisionsinstrument dazu benutzen, grobe Holzkisten zu öffnen, sagte sie. Woraufhin der Philosoph, der seinen Entschluss bald in die Tat umsetzen sollte, antwortete: »Du erinnerst mich an einen Menschen, der aus einem geschlossenen Fenster schaut und sich die sonderbaren Bewegungen eines Passanten nicht erklären kann; er weiß nicht, welcher Sturm draußen wütet und daß dieser Mensch sich vielleicht nur mit Mühe auf den Beinen hält.«[2]
Noch ein zweiter, wenige Jahre später entstandener Text bereitet Wittgensteins Bild vom Fliegenglas vor. Diesmal ist es der Dichter Christian Morgenstern, der schrieb: »Wer sich an Kant hält, dem muß alle Metaphysik erscheinen wie das hartnäckige Surren einer großen Fliege an einem festgeschlossenen Fenster. Überall wird das Tier einen Durchlaß vermuten und nirgends gewährt die unerbittliche Scheibe etwas anderes als – Durchsicht.« Gerade weil die Dinge so klar, so transparent und einfach erscheinen, stellen sie nicht selten die größten Hindernisse für uns dar. Jeder Millimeter, den das Denkorgan mit seinem Lichtkreis der Erkenntnis abtastet, scheint ein Ausweg zu sein. Und doch stößt der Mensch, die denkende Fliege, ständig an die Glaswand. Die Fliege ist in ihrem durchsichtigen Gefängnis, dem Fliegenglas, gefangen: Sie erkennt nicht einmal die Grenzen, gegen die sie immer und immer wieder anfliegt.
Und noch ein dritter Text verweist in die Richtung von Wittgensteins Metapher, und ich schließe nicht aus, dass Wittgenstein ihn kannte. Schließlich hat ihn ein anderer Österreicher, der vor den Nazis floh, geschrieben: der Schriftsteller Robert Musil, der neun Jahre vor Wittgenstein geboren wurde (1880) und neun Jahre vor ihm starb (1942). Musil beschrieb in dem 1936 erschienenen Nachlaß zu Lebzeiten, wie sehr der Mensch der Fliege ähnelt oder, wie ich sagen würde, eine denkende Fliege ist.[3] »Fliegen stehen aufrecht, nehmen Haltung an«, schrieb Musil, »sammeln Kraft und Überlegung. Nach wenigen Sekunden sind sie entschlossen und beginnen, was sie vermögen, zu schwirren und sich abzuheben. Sie führen diese wütende Handlung so lange durch, bis die Erschöpfung sie zum Einhalten zwingt. Es folgt eine Atempause und ein neuer Versuch. Aber die Intervalle werden immer länger. Sie stehen da, und ich fühle, wie ratlos sie sind. Sie biegen sich vor und zurück auf ihren festgeschlungenen Beinchen, beugen sich in den Knien und stemmen sich empor, wie Menschen es machen, die auf alle Weise versuchen, eine schwere Last zu bewegen; tragischer als Arbeiter es tun, wahrer im sportlichen Ausdruck der äußersten Anstrengung als Laokoon. Und dann kommt der immer gleich seltsame Augenblick, wo das Bedürfnis einer gegenwärtigen Sekunde über alle mächtigen Dauergefühle des Daseins siegt. Es ist der Augenblick, wo ein Kletterer wegen des Schmerzes in den Fingern freiwillig den Griff der Hand öffnet, wo ein Verirrter im Schnee sich hinlegt wie ein Kind, wo ein Verfolgter mit brennenden Flanken steht. Sie halten sich nicht mehr mit aller Kraft ab von unten, sie sinken ein wenig ein und sind in diesem Augenblick ganz menschlich.« Auch wenn Musil die unbarmherzige Wirkung einer klebrigen Fliegenfalle beschreibt: Viel besser ist die durchsichtige, unsichtbare, gläserne Falle des Fliegenglases nicht. Im Grunde ist sie sogar noch menschenähnlicher. Denn wenn uns etwas als Gattung auszeichnet, dann unter anderem unsere Unfähigkeit, unsere eigenen Grenzen rechtzeitig zu erkennen. So stimmt es, was der Philosoph Hans Blumenberg über Wittgensteins Bild von der im Glas gefangenen Fliege schrieb: »Die Philosophie der Neuzeit ist auch dort, wo sie von Triumphen des menschlichen Geistes zu handeln scheint, weithin eine Beschreibung von Gefangenschaften.«[4]
Die glaubende und die denkende Fliege – die Möglichkeit des Aspektwechsels
Wenn man die bisherigen Gedanken zusammenfasst, ergibt sich ungefähr folgendes Bild: Wir befinden uns bei der Klärung der Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Vernunft gleichsam auf offener See. Wir können das Material, das wir brauchen, um unsere Theorien zu bauen oder zu verbessern, nicht von außen nehmen. Es gibt, in diesem Sinne, kein außen – sondern nur das Schiff, auf dem man sich befindet, und das offene Meer. Glaubende wie Nichtglaubende befinden sich insofern im selben Boot, auch wenn sie seine Existenz durchaus unterschiedlich verstehen. Ein Religiöser könnte das Schiff für etwas Vorläufiges, im Jenseits endgültig Überwundenes halten – der Atheist hingegen für das endgültige Optimum, das die menschliche Existenz zu erreichen in der Lage ist. Fakt ist: Solange sie über diese Frage nachdenken, finden sie sich im selben Schiff wieder, das sie nicht verlassen und nur dann verstehen, umbauen oder reparieren können, wenn sie die Planken, die sie an einer Stelle wegnehmen, mit anderem Material aus demselben Schiff ersetzen. Es gilt sozusagen der mentale Energieerhaltungssatz: Zwar geht keine Gedankenenergie im Gesamtsystem verloren. Doch wenn sie in die eine Richtung verlagert wird (wenn man ein starkes Argument für die Existenz Gottes aufbaut), dann muss diese Energie an anderer Stelle fehlen (zum Beispiel in der Stärke der Verlässlichkeit der Prämissen, die einen solchen Schluss erlauben, aber eben nicht universal einsichtig sind). Alles, was vorgestellt, gewusst, gedacht oder geglaubt werden kann, kann nur innerhalb des Systems gedacht und geglaubt werden. Externe Referenzen heranzuziehen (bildhaft gesprochen: andere Schiffe, die sich womöglich hinter einer Nebelbank in der Nähe befinden), ist nicht möglich. Wer sich auf ein klärendes Gespräch und den Prozess der klaren gedanklichen Argumentation einlässt, willigt damit ein, den Ort nicht zu verlassen. Dieser Ort ist das, was auf dem Schiff – dem »Raumschiff Erde« – der Fall ist. Und darüber kann man sich verständigen. In der US-Serie Twin Peaks, die der Regisseur David Lynch zusammen mit Mark Frost erfunden hat, gibt es eine Frau – die Log Lady –, die stets einen Holzscheit im Arm hat, der zur ihr spricht. So behauptet sie, dass an einem Tatort Eulen waren, weil ihr Scheit es ihr gesagt hat. Die meisten Bewohner des kleinen Städtchens halten die Log Lady jedoch für verrückt. Analog könnte man sich in der Regel darüber verständigen – so viel »gesunder Menschenverstand« sollte auch bei einer Diskussion über Glauben und Vernunft vorausgesetzt werden können –, dass Sträucher normalerweise nicht mit uns sprechen können. Daher können sie uns auch keine entscheidenden Hinweise in der Argumentation liefern, auf die wir uns dann aus gutem Grund und als Evidenzquelle beziehen könnten, indem wir etwa sagen: »Aber der Strauch hat es gesehen und mir dann gesagt, also muss es stimmen.«
Doch ist das nicht alles »nur« ein Bild? Tatsächlich besteht ein Teil der philosophischen (und auch der naturwissenschaftlichen) Methode darin, die zur Wirklichkeit passenden Bilder zu erfinden und diese dann zu benutzen, um mehr Übersicht zu gewinnen. Es gab Zeiten, in denen man das Weltall mit einer Uhr – dem damaligen Meisterstück der Mechanik – vergleichen konnte, die Gott aufgezogen hat, damit sie dann in vorbestimmter Weise ablaufen kann. Doch das bedeutet nicht, dass derartige Bilder für alle Zeiten Gültigkeit beanspruchen können. In Zeiten nichtlinearer Thermodynamik fällt es schwer, komplexe Prozesse etwa in der Biologie nach dem Muster eines mechanischen Uhrwerkes zu denken – oder die Quantengravitation nach der Mechanik des Falls und der schiefen Ebene. Wie alles hat eben auch der Gebrauch von Bildern Grenzen. »Wir haben eben ein Gleichnis gebraucht«, schreibt Wittgenstein in den Philosophischen Bemerkungen, »und nun tyrannisiert uns das Gleichnis. In der Sprache dieses Gleichnisses kann ich mich nicht außerhalb des Gleichnisses bewegen.«[1] Wittgenstein bezog sich im konkreten Fall, den er an dieser Stelle betrachtete, auf die Vorstellung, dass das Gedächtnis selbst wie ein Bild sei, das uns vor Augen steht, wenn wir uns erinnern. Doch seine Bemerkung bezieht sich weitaus universeller auf die Tyrannei bestimmter Idealvorstellungen. Sein Werk Tractatus logico-philosophicus steht selbst für einen solchen Irrtum. Seine Vorstellung, dass die Sprache stets eine kristalline, logische Struktur habe, erwies sich seinen eigenen weiteren Untersuchungen zufolge als falsch. Die reale Alltagssprache ist weitaus ambivalenter und unklarer, als Wittgenstein zunächst angenommen hatte. Aber aus eben diesem Grund ist sie auch vielfältiger nutzbar – etwa so wie ein Universalwerkzeug, das eben nicht nur dazu dient, die Mikroskope der Wissenschaftler zu polieren. »Es muß zu Unsinn führen, wenn man mit der Sprache dieses Gleichnis als Quelle unserer Erkenntnis, als Verifikation unserer Sätze, reden will. Es ist ja klar, daß die Ausdrucksweise vom Gedächtnis als einem Bild, nur ein Gleichnis ist; genau so wie die Ausdrucksweise, die die Vorstellungen ›Bilder der Gegenstände in unserem Geiste‹ (oder dergleichen) nennt.« Dies gilt auch für so weitverbreitete Bilder wie das der Zeit als eines Flusses. »Es ist merkwürdig, daß wir das Gefühl, daß das Phänomen uns entschlüpft, den ständigen Fluß der Erscheinungen im gewöhnlichen Leben nie spüren, sondern erst, wenn wir philosophieren. Das deutet darauf hin, daß es sich hier um einen Gedanken handelt, der uns durch eine falsche Verwendung unserer Sprache suggeriert wird.«[2] Viele Bilder und Gleichnisse sind Ergebnisse solcher (kollektiven und daher weitverbreiteten) sprachlichen Suggestionen. Doch was bedeutet das in Bezug auf Gott, auf das Jenseits, auf Glauben oder Wahrheit?
Ich werde später noch einmal auf Wittgensteins Untersuchungen des Glaubens und der Sprache des Glaubens eingehen. An dieser Stelle reicht es, darauf hinzuweisen, dass es Wittgenstein zufolge stets einen blinden Fleck in unserem Denken gibt – und nicht nur als physiologisch greifbares Phänomen im Auge bzw. im Gehirn. Den Fleck dennoch »sehen« zu können – ihn also zu erkennen, die Grenzen wahrzunehmen, die damit verbunden sind – bedeutet, den Gesichtskreis an der entscheidenden Stelle zu öffnen und eine »neue Dimension des Raumes« wahrzunehmen. Genau darum geht es Wittgenstein im Bild der Fliege, der man den Ausweg aus dem Fliegenglas weist. Die Lösung solcher für das Leben oft entscheidender Fragen und Probleme besteht häufig darin – und Wittgenstein ist sehr erfinderisch, wenn es um Beispiele etwa aus der Mathematik geht –, etwas zu sehen, was man bislang übersehen hatte. Man sieht sozusagen wie die Fliege hindurch, ohne die Grenze bzw. Begrenztheit wahrzunehmen. Dass man die Lösung nicht findet, liegt also nicht daran, dass sie von einem bösen Geist verborgen worden wäre oder jemand sich die Mühe gemacht hat, sie vor uns zu verstecken. Vielmehr erkennen wir nicht, weil sich uns diese Dimension, die Dimension der Lösung, noch nicht erschlossen hatte. Vielleicht hatte Paulus genau diesen Vorgang im Sinn, als er im 1. Korintherbrief davon sprach, dass alle Gaben, auch die prophetischen, alle Sprachkenntnisse und theologischen Erkenntnisse vergehen können, weil sie Stückwerk sind. Man sieht nicht das Ganze. Es bedarf erst einer entscheidenden Veränderung, eines Perspektiv- oder Blickwechsels, damit das Ganze des Fliegenglases in den Blick kommt und der Ausweg gesehen werden kann. »Wenn das Vollendete kommt, wird das Stückwerk abgetan«, schrieb Paulus.
Wittgenstein weist darauf hin, dass wir häufig irren und den Ausweg aus einem Problem nicht finden, weil »wir vom Ideal geblendet« sind und keine Übersicht haben.[3] »Hier ist es schwer, gleichsam den Kopf oben zu behalten, – zu sehen, daß wir bei den Dingen des alltäglichen bleiben müssen, um nicht auf Abwege zu geraten, wo es doch scheint, als müßten wir die letzten Feinheiten beschreiben, die wir doch wieder mit unseren Mitteln gar nicht beschreiben können. Es ist uns, als sollten wir ein zerstörtes Spinnennetz mit unseren Fingern in Ordnung bringen.«[4] Neuraths Schiffs-Metapher und das Fliegenglas kommen auf diese Weise zusammen: Wir haben die Lösung vor uns – und finden sie nicht, weil wir sie nicht sehen können. Und während wir suchen, können wir nicht an einen anderen Ort, um von da aus unser Schiff zu reparieren. Wir können aus dem Fliegenglas nicht heraus, um dort draußen die Lösung zu finden, die uns hilft, das Glas zu verlassen. Dabei sind es häufig die Gleichnisse, aber auch große Metaphern wie Gott, die in unsere Sprache aufgenommen sind. Doch sie »bewirken einen falschen Schein; der beunruhigt uns: ›Es ist doch nicht so!‹ – sagen wir. ›Aber es muß doch so sein!‹«[5] Kurzum: Wir missverstehen die Situation auf fundamentale Weise, weil wir in solchen Fällen nicht sehen, sondern der Sprache folgen. Wie die Fliege das Glas nicht sehen kann, an dem sie dennoch emporkrabbeln kann, so halten uns die Bilder und Gleichnisse gefangen, an denen sich unsere Gedanken und Theoriegebäude emporranken. »Und heraus konnten wir nicht, denn es lag in unserer Sprache, und sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen.«[6] Glas, Sprache: Beides ist so transparent, dass es den Anschein hat, als wäre es nicht da. Die Sprache ist das natürlichste Medium der Welt für ein Lebewesen, das nicht nur der Sprache fähig ist, sondern sie tagtäglich braucht, um zu überleben und sich selber immer wieder verständlich zu machen. Der Mensch lebt wie der Fisch im Wasser der Sprache, an das er sich optimal angepasst hat – und sieht es doch die meiste Zeit über nicht. »Das Ideal, in unseren Gedanken, sitzt unverrückbar fest. Du kannst nicht aus ihm heraustreten. Du mußt immer wieder zurück. Es gibt kein Draußen; draußen fehlt die Lebensluft.«[7]
Diese Situation trifft auf alle, auf Gläubige wie Ungläubige bzw. Nichtglaubende, in gleicher Weise zu. Wie die Fliege ihr Schlupfloch nicht findet, weil der Ausweg aus dem Fliegenglas genauso aussieht wie das Glas selbst und daher für sie unsichtbar ist, so kommen auch wir häufig nicht auf die Idee, die Brille, die unsere Welt und mit ihr unsere Fragen einfärbt, einfach abzunehmen. Fliege und Mensch befinden sich in einer ähnlichen Situation. Wittgenstein beschreibt das Dilemma, einen Ausweg zu finden, so: »Ein Mensch ist in einem Zimmer gefangen, wenn die Tür unversperrt ist, sie nach innen öffnet; er aber nicht auf die Idee kommt zu ziehen, statt gegen sie zu drücken.«[8]