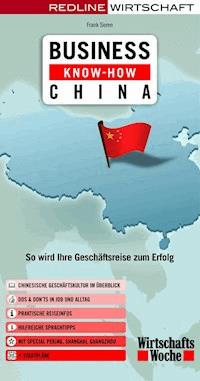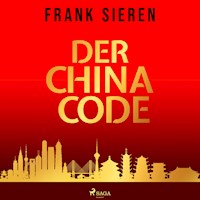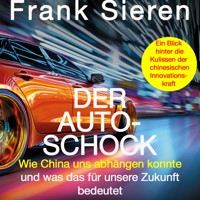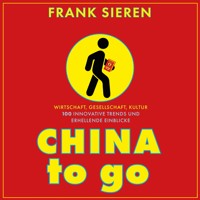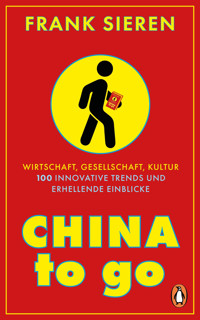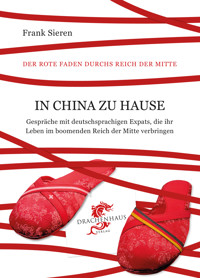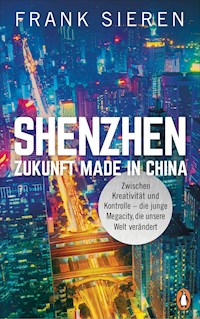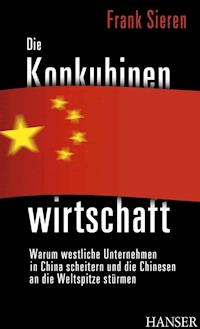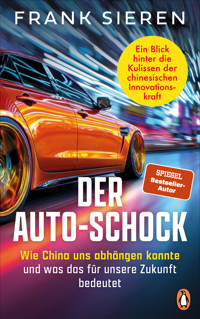
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was wir tun müssen, um mit Chinas Wirtschaft mitzuhalten – Einblicke eines China-Experten
Unsere Autobauer werden von China verdrängt - die wichtigste deutsche Industrie, viele Jahrzehnte globaler Taktgeber der Innovation. Die Folge: Massenentlassungen und Gewinneinbrüche. Frank Sieren, ausgezeichneter Kenner der chinesischen Wirtschaft, beschreibt wie es kommen konnte, dass der Marktanteil aller deutschen Wagen im chinesischen E-Auto-Markt bei unter fünf Prozent liegt und die meisten Stromer weltweit inzwischen aus China kommen – dem wichtigsten Autowachstumsmarkt der Welt. Ob Batterien, digitale Vernetzung oder Autonomes Fahren, die Chinesen sind nun besser als wir und bieten sehr günstige Preise. Das liegt auch an staatlichen Subventionen, aber vor allem an großer Innovationskraft. Sie steht für globale Machtverschiebungen: Die Zeiten der wirtschaftlichen und politischen Vorherrschaft des Westens sind vorbei. Frank Sieren fragt: Wie kommen wir aus der Krise wieder raus?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Was wir tun müssen, um mit Chinas Wirtschaft mitzuhalten – Einblicke eines China-Experten
Unsere Autobauer werden von China verdrängt – die wichtigste deutsche
Industrie, viele Jahrzehnte globaler Taktgeber der Innovation. Die Folge: Massenentlassungen und Gewinneinbrüche. Frank Sieren, ausgezeichneter Kenner der chinesischen Wirtschaft, beschreibt wie es passieren
konnte, dass der Marktanteil aller deutschen Wagen im chinesischen E-Auto-Markt bei unter fünf Prozent liegt und die meisten Stromer weltweit inzwischen aus China kommen – dem wichtigsten Autowachstumsmarkt der Welt. Ob Batterien, digitale Vernetzung oder Autonomes Fahren, die Chinesen sind nun besser als wir – zu sehr günstigen Preisen. Das liegt auch an staatlichen Subventionen, aber vor allem an wachsender Innovationskraft. Sie beschleunigt globale Machtverschiebungen: Die Zeiten der
wirtschaftlichen und politischen Vorherrschaft des Westens sind vorbei. Frank Sieren fragt: Wie kommen wir aus der Krise wieder raus?
Frank Sieren ist einer der führenden deutschen China-Experten. Der Journalist, Buchautor und Dokumentarfilmer lebt seit 1994 in Peking – länger als jeder andere westliche Wirtschaftsjournalist. Hautnah erlebt er den Aufstieg der neuen Weltmacht mit. Er hat im vergangenen Vierteljahrhundert als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung, die Wirtschaftswoche, die Zeit, das Handelsblatt, den Tagesspiegel, die Deutsche Welle und China.Table gearbeitet. Nun auch für Gabor Steingarts The Pioneer. Sieren hat bereits mehrere Bestseller veröffentlicht, darunter Zukunft? China! und Shenzhen. Zuletzt erschien von ihm China to go, ein Überblick über aktuelle Themen und Trends in 100 Artikeln.
www.penguin-verlag.de
FRANK SIEREN
DER AUTO-SCHOCK
Wie China uns abhängen konnte und was das für unsere Zukunft bedeutet Ein Blick hinter die Kulissen der chinesischen Innovationskraft
Bei der Bezeichnung »Dollar« handelt es sich in diesem Buch stets um US-Dollar.
Die verwendeten Quellen finden Sie unter: www.sieren.net
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Lektorat: Heike Gronemeier, München
Mitarbeit: Donata Hardenberg
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Umschlagabbildung: © Adobe Stock / red_orange_stock (Generiert mit KI)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33113-9V001
www.penguin-verlag.de
Für meinen Vater Rudolf Sieren (1932 – 2024), einen treuen Mercedes-Fahrer
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1:
AUDI – platter Primus
Wie das Unternehmen aus Ingolstadt in China vom Luxusprimus zum Ladenhüter wurde
Kapitel 2:
GEELY – Weltraumwellenwagen
Wie ein Kühlschrankproduzent Volvo-Besitzer, Satellitennetzbetreiber und größter Teilhaber von Mercedes wurde
Kapitel 3:
HAN – prima Performance
Warum dieses Modell von BYD nicht nur die Mercedes E-Klasse alt aussehen lässt
Kapitel 4:
BYD – blendende Batterieboliden
Wie ein Laptop-Batteriehersteller aus Shenzhen der weltgrößte E-Auto-Hersteller wurde und selbst Tesla abhängte
Kapitel 5:
LITHIUM – Ringen um rare Rohstoffe
Wie der Hunger nach Batterierohstoffen Reichtum, Neid und Leid in die Welt bringt
Kapitel 6:
JAECOO – Range Rovers Rückgrat
Warum neue Modelle erst Afrika und dann Deutschland erobern
Kapitel 7:
CHERY – waschechter Weltenbummler
Wie der zweitgrößte Hersteller Chinas zum führenden Autoexporteur des Landes wurde
Kapitel 8:
AITO – alles AutoAuto
Wie Autos lernen, ganz allein zu fahren
Kapitel 9:
HIMA – szeniger Zulieferer
Wie Huawei gleichzeitig BMW und Bosch überholt und nun auch noch Bentley Konkurrenz macht
Kapitel 10:
SERES – stressfester Seidenwurm
Wie ein Hinterwäldler Chinas Marktführer bei Premiumautos wurde
Kapitel 11:
XIAOMI – gigantisches Gadget
Wie der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt zum »Porsche-Killer« wurde
Kapitel 12:
PASSAGIERDROHNEN – lohnende Luftikusse
Wie ein Science-Fiction-Traum wahr wird und Autos fliegen lernen
Ausblick
Dank
Vorwort
»China wird ökonomisch aufsteigen, ohne dass das für uns zu Einbußen führt. Immer vorausgesetzt, dass wir in der Zwischenzeit nicht stillstehen, sondern dass unsere Wissenschaft, unsere Techniker und Ingenieure weiterhin neue Produkte erfinden und sie auch verkaufen.«
Altbundeskanzler Helmut Schmidt 2011
Dieses Buch dreht sich um unsere Zukunft. Um die Zukunft der wichtigsten Industrie Deutschlands, der Autoindustrie. Die ist leider düster, weil Chinas Autobauer so erfolgreich sind. Um es gleich vorwegzunehmen: Die größten Probleme sind nicht die staatlichen Subventionen oder der Technologieklau, sondern vielmehr die Innovationskraft pfiffiger chinesischer Ingenieure, die Offenheit der chinesischen Kunden für neue Technologien und ein Staat, der Unternehmen hilft, ihre Innovationskraft zu entfalten – eben nicht nur mit Zuschüssen.
Das sieht selbst das US-amerikanische Time Magazine inzwischen so: »Es ist zu kurz gegriffen, China zu beschuldigen, dass staatliche Subventionen Chinas Vormachtstellung bei den E-Autos geschaffen haben.«
Wir haben die Chinesen unterschätzt, müssen wir nüchtern feststellen. »Um die Autos der Zukunft zu sehen, schauen Sie sich Chinas E-Autos an«, resümiert der britische Economist. Chinas »superintelligente Tesla-Killer« seien »meilenweit voraus«. Leider »killen« sie nicht nur Tesla. Auch die deutschen Hersteller straucheln. 130 000 deutsche Arbeitsplätze sind in Gefahr, schätzt eine Studie der Deutschen Bank. Das ist erst einmal unser Fehler. Jahrzehntelang waren deutsche Autos global führend. Da waren die großen Zeiten der amerikanischen Autoindustrie längst vorbei. Am Ende konnten nicht einmal die Japaner den Deutschen das Wasser reichen. Zwar haben sich VW und Toyota abgewechselt im Wettbewerb um den Titel des größten Autoherstellers der Welt, aktuell ist Toyota stabil vorne. Doch Toyotas Lexus hat global nie so gut geklungen wie eine S-Klasse, ein 7er BMW oder ein Audi Q8, von Porsche ganz zu schweigen. Auch deshalb waren vierzig Jahre lang deutsche Premiumfahrzeuge unangefochten spitze in China, vor allem Audi. Aber auch BMW und Mercedes galten als die Krönung der chinesischen Autoträume. VW und nicht Toyota war über Jahrzehnte der Platzhirsch im chinesischen Markt, der VW Santana das erste Auto der neuen chinesischen Mittelschicht. Für angehende chinesische Autoingenieure war es ein Traum in Deutschland zu studieren.
Lange schien eines in Stein gemeißelt: Wir haben entwickelt und den Takt angegeben, die Chinesen haben umgesetzt. Dann jedoch haben chinesische Ingenieure mit einem langen Anlauf die schwierige Technologiestufe des Verbrennermotors einfach übersprungen und gleich auf preiswerte hochgradig vernetzte E-Autos gesetzt, autonom rollende Smartphones gewissermaßen. Als diese Autos vor einigen Jahren in China auf den Markt kamen, wurden deutsche Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit uninteressant, die niemand bei uns für möglich gehalten hat. Nun ist BYD der größte chinesische Autohersteller – nur mit E-Autos. Das an sich wäre ja noch nachvollziehbar. Denn in Europa führen europäische Hersteller, in den USA amerikanische und in Japan japanische. Aber BYD ist nun vor Tesla auch global der größte E-Auto-Hersteller. Und Stromer sind der neue Goldstandard der Autoindustrie. Während alle westlichen Hersteller straucheln – auch bei den Verbrennern –, konnte BYD 2024 bei den Verkäufen ein Plus von über vierzig Prozent erzielen.
Im ersten Halbjahr 2025 konnte BYD 1,2 Millionen E-Autos verkaufen. Ein Wachstum von noch einmal über dreißig Prozent. In ganz Europa hingegen wurden in diesem Zeitraum nur 1,5 Millionen Stromer losgeschlagen. Bei VW waren es rund 70 000 E-Autos im Monat. Bei BYD weit über 350 000. Die Aktie von VW ist in den vergangenen fünf Jahren um knapp fünfzig Prozent eingebrochen. Die von BYD um zehn Prozent gestiegen. BYD hat einen Börsenwert von rund 120 Milliarden Euro. Der von VW liegt bei 50 Milliarden.
Dass BYD führt, liegt vor allem noch an der Präsenz im chinesischen Markt. Denn knapp zwei Drittel der chinesischen E-Autos der Welt fahren in China. Mit großen Schritten erobert BYD nun aber den Weltmarkt, fasst trotz der Zölle auch in Europa und Deutschland Fuß. Inzwischen mit Erfolg. BYD hat Tesla in Europa überholt.
Im Mai 2025 lag der BYD Seal U bei den E-Autoverkäufen in Europa erstmals auf Platz drei hinter dem Tesla Y und dem Škoda Elroq, aber vor den VWs ID.4, ID.7 und ID.3. Der erste Audi kam auf Platz acht. BWM folgte auf Platz elf, Mercedes auf Platz zwanzig. Die Chinesen haben im Sommer 2025 bereits einen Marktanteil von 5,4 Prozent. »Pkw chinesischer Herkunft fahren mittlerweile in relevanter Zahl auf deutschen Straßen«, stellt der ADAC fest. Schon im Sommer 2024 konnten sich über siebzig Prozent der 19- bis 39-jährigen Deutschen vorstellen, ein chinesisches Auto zu kaufen. Kein Wunder: »Die meisten Modelle holen Bestnoten beim Euro-NCAP-Crash-Test«, so der ADAC im Sommer 2025. Die Akkutechnik sei »ausgereift«, die Reichweiten »passabel«. Die Verarbeitungsqualität »stünde manchem etablierten Konkurrenten gut zu Gesicht, von der meist guten Serienausstattung mal ganz abgesehen«. Von den 23 chinesischen Autos, die der ADAC bisher getestet hat, schneiden alle mit »gut« ab. Wenig überraschend also, dass der Blick sich auf China richtet.
Die chinesischen E-Autos sind in der Regel inzwischen viel billiger, innovativer, genauso sicher, besser designt und ausgestattet als die deutschen. Den Chinesen gelingt es zudem, ein neues Auto in der halben Zeit zu entwickeln. Bei den Batterien und beim KI-basierten autonomen Fahren, der zentralen Technologie am Beginn des 21. Jahrhunderts, sind sie bereits unangefochtener Weltmarktführer. Der Börsengang des chinesischen Batterieherstellers CATL im Mai 2025 in Hongkong war der bis dahin weltweit größte des Jahres. Das Unternehmen sammelte fast fünf Milliarden Dollar ein, die Aktie stieg am Ausgabetag um 18 Prozent.
Zu Technologien wie denen von CATL oder Huawei im Bereich autonomes Fahren haben deutsche oder europäische Ingenieure kaum noch etwas beizutragen. Nun bestimmen die Chinesen den Takt und die Richtung der globalen Autoinnovation. Genauer gesagt die chinesischen Kunden, die nach Autos verlangen, die den Bedürfnissen in den pulsierenden chinesischen Megastädten gerecht werden. Und so sind die deutschen Autohersteller binnen zwei, drei Jahren vom Treiber zum Getriebenen in der globalen Autoindustrie geworden.
Zwar hat VW im Juni mit dem ID. Buzz AD angeblich das »erste Serienfahrzeug« der autonomen Fahrstufe 4 vorgestellt und die Wirtschaftswoche hat daraus gleich eine Titelgeschichte gemacht: »Das deutsche Autowunder«. Doch wenn man genauer hinschaut, lassen sich keine Wunder finden. Getestet wird auf der Reeperbahn, statt in der Megametropole Shenzhen. Das Auto kommt erst 2026 auf den Markt. Und VW will bis 2030 10 000 Stück davon verkaufen. Derweil hatte Huawei, der fortschrittlichste Hersteller beim autonomen Fahren in China, 2024 schon rund 400 000 Autos im Markt, die jede Sekunde mit neuen Daten lernen. Sie fahren aus regulatorischen Gründen nur auf Stufe 3, schaffen aber faktisch schon Stufe 4.
Im ersten Halbjahr 2025 kamen in China noch einmal 200 000 autonome E-Autos dazu. Und das liegt nicht nur an Huawei. Die anderen chinesischen Anbieter sind nicht weit hinterher. Wenn Christian Senger, Leiter des Bereichs autonomes Fahren der VW-Transportsparte, gegenüber der Wirtschaftswoche davon spricht, es gäbe »eine realistische Chance«, dass VW in Europa für das autonome Fahren stehen könnte »wie Tempo für Taschentücher«, dann klingt das eher wie das Pfeifen im Keller. Klar ist: In China, dem größten und wichtigsten Wachstumsmarkt der Welt, werden es andere sein.
Über die Subventionen in China zu jammern, hilft wenig. Die gibt es, aber vor allem beim Ausrollen neuer Technologien. Beim Bau von Fabriken werden Steuernachlässe oder verbilligte Grundstücke vergeben. Die erhalten auch Ausländer. Die lokalen Player haben jedoch einen Heimvorteil. Subventionen für jedes E-Auto, die gezahlt werden, um die Autos für den Endkunden billiger zu machen, bekommen alle Hersteller, auch ausländische Produzenten. Die europäischen Autohersteller befürchten Vergeltungsmaßnahmen für ausländische Hersteller in China, wenn EU-Zölle auf chinesische Autos in Europa erhoben werden. »Wir brauchen mehr Freihandel statt neuer Handelshemmnisse«, fordert deshalb zum Beispiel Mercedes-CEO Ola Källenius im Oktober 2024. Ihm ist eine Lösung wichtig, »die sowohl der EU als auch China gerecht wird«. So lange solle es keine Zölle geben. Diese Position teilt die Mehrheit der deutschen Autoindustrie, auch die Bundesregierung stellt sich daher gegen Zölle. Brüssel sieht das anders und verhängt Zölle, angeblich um die Unternehmen schützen, die offensichtlich gar nicht geschützt werden wollen. Auch die Verbraucher wollen von Brüssel nicht geschützt werden. Sie kaufen gerne preiswerte Autos aus China.
Die Sorge der Deutschen darüber, was mit den Daten passiert, die die chinesischen Autos einsammeln, oder die Sorge, dass die Autos ferngesteuert und etwa plötzlich abgestellt werden könnten, bügeln wiederum die Chinesen selbstbewusst ab: Es ist das »Unbehagen eines alten Systems, das sich den Regeln eines neuen Spiels widersetzt«, schreibt die staatliche chinesische Zeitung Global Times. »Was ihnen wirklich Sorgen bereitet, ist sie nicht die ›Cybersicherheit‹ der E-Autos, sondern die Erosion ihrer Dominanz auf dem Weltmarkt.«
Dass die Chinesen mit den E-Autos der Welt auch noch maßgeblich helfen, den Kampf gegen den Klimawandel voranzutreiben, macht es Deutschland nicht einfacher. Denn das räumt inzwischen sogar der US-TV-Sender CNN ein: »Chinas Revolution in der Elektromobilität festigt die Vorherrschaft des Landes bei sauberen Technologien und seinen Anspruch auf die globale Führungsrolle beim Klimaschutz, während die Trump-Regierung gleichzeitig saubere Energie verteufelt.« Allerdings hat dieses grüne chinesische Projekt einen dunklen Fleck: Knapp sechzig Prozent des chinesischen Stroms wird mit Kohle erzeugt. Tendenz immerhin fallend, aber nicht nur wegen mehr Sonne, Wind oder Wasserenergie im Energiemix, sondern auch wegen russischen Gases. 2024 wurde Russland erstmals Chinas größter Gaslieferant. Das stößt auch den Europäern auf, denn damit unterläuft Peking die westlichen Sanktionen gegen Russland. Davon, dass nun nicht mehr BMW, Mercedes und VW Autos nach Russland liefern, sondern Russland nun Chinas größter Autoexportmarkt ist, ganz zu schweigen.
Unbestritten ist: Mit Chinas Innovationsschub geht eine Epoche zu Ende, die von deutschen Erfindern wie Rudolf Diesel, Gottfried Daimler, Wilhelm Maybach und Karl Benz Ende des 19. Jahrhunderts begründet wurde. Sie wurde mit Ferdinand Porsche fortgeführt, der sowohl mit Porsche eine global führende Luxusmarke kreiert als auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein Massenprodukt entwickelt hat, das den Namen Volkswagen verdiente: den Käfer. Seine Nachfolger schufen in den Siebzigern den Golf, der in Deutschland einer ganzen Generation ihren Namen gab: der »Generation Golf«.
Der Golf hatte allerdings weltweit schon erfolgreiche Wettbewerber. Den Toyota Corolla und den Honda Civic aus Japan ebenso wie den Ford Escort aus den USA. Doch es war kein Japaner und kein Amerikaner, es war der deutsche VW-Chef Karl Hahn, der in den Achtzigern mit Weitsicht und Durchsetzungskraft dafür gesorgt hat, dass Volkswagen der erste große ausländische Hersteller wurde, der in China produzierte und bald für Jahrzehnte die Marktführerschaft übernahm. 2003 kam fast jedes dritte Auto in China von VW.
Doch inzwischen brechen die Verkäufe in China, dem größten Markt der Deutschen, massiv ein, während der Markt selbst weiterwächst. Das wird in heftigen Gewinneinbrüchen der deutschen Autohersteller deutlich: 2024 machte VW ein Minus von 14 Prozent, bei Mercedes waren es minus dreißig Prozent und bei BMW minus 36 Prozent. Und der Boden bei diesem Absturz ist Mitte 2025 noch nicht in Sicht. Im ersten Halbjahr stagnieren die Verkäufe von BMW weltweit. In China gehen sie um 4,2 Prozent zurück.
Im Juni sogar um 4,7 Prozent. Bei Mercedes kommt es noch schlimmer: minus acht Prozent weltweit, in China minus 14 Prozent, ebenso bei den E-Autos. Bei VW sieht es vor allem bei dem neuen Goldstandard E-Autos schlecht aus: minus 34 Prozent. Bei Audi sogar minus 50 Prozent. VW muss nun zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Werk in China schließen. 2500 Arbeitsplätze sind betroffen. Dafür legt VW bei den Stromern in Europa um 47 Prozent zu – einstweilen, denn die Chinesen sind dort noch nicht richtig angekommen und Tesla schmiert ab. Insgesamt wachsen die weltweiten Verkäufe von VW jedoch nur um magere 1,3 Prozent. Bei den Autoverkäufen in China inklusive Verbrenner bricht VW im ersten Quartal noch einmal um sieben Prozent ein, schafft aber im zweiten immerhin ein Plus von 2,6 Prozent. Damit bleibt das erste Halbjahr im größten Wachstumsmarkt der Welt weiterhin negativ (minus 4,4 Prozent), in einem Markt, der insgesamt um gut zehn Prozent gewachsen ist. Der Gewinn von VW ist im ersten Quartal noch einmal um 39 Prozent eingebrochen.
Selbst die besten unserer Autos, von denen wir immer glaubten, sie spielten gewissermaßen außer Konkurrenz, bleiben nicht verschont: insgesamt minus 28 Prozent auch bei Porsche 2024, vor allem wegen China. Im ersten Halbjahr 2025 hat sich der Trend bestätigt: weltweit minus sechs Prozent. Noch mal minus 28 Prozent in China. Nur noch gut 21 000 Autos wurden dort verkauft. Der viel günstigere Wettbewerber Xiaomi hat im gleichen Zeitraum über 200 000 Stück verkauft. Bei der E-Mobilität, der Zukunft des Autos, spielten die Deutschen 2024 in China praktisch keine Rolle. BMW kam auf einen Marktanteil von 0,9 Prozent, Mercedes-Benz auf 0,3 Prozent, Audi auf 0,2 Prozent und der Anteil von Porsche war kaum noch messbar.
Dabei dominiert der chinesische Markt die E-Auto-Welt.
Während in Europa von Januar bis Mai 2025 beachtliche 1,6 Millionen Stromer verkauft wurden (plus 27 Prozent), mit dem stärksten Wachstum in Spanien und Italien, sind es in China inzwischen über eine Million – pro Monat.
China kommt im Zeitraum Januar bis Mai auf 4,4 Millionen, bei einem mit plus 33 Prozent leicht höheren Wachstum als dem der Europäer. Das Tesla-Land USA stagniert hingegen bei rund 700 000 Stück und da ist Kanada noch eingerechnet. China baut also seine Führung auf dem globalen E-Auto-Markt weiter aus.
Berauscht von ihrem langjährigen Erfolg sind die deutschen Autohersteller offenbar zu selbstsicher gewesen. Sie haben ihre Wettbewerber unterschätzt, und manche der deutschen Automanager unterschätzen sie noch immer, vor allem, wenn sie in Deutschland leben. Was für die Automanager gilt, stimmt auch für Deutschland insgesamt: Wir kennen die neuen Player kaum, die längst nicht mehr nur in China, sondern nun weltweit erfolgreich sind, zum Teil auch schon in Europa, wo chinesische E-Autos bereits 14 Prozent Marktanteil haben.
Wer kennt zum Beispiel Chery? Wer weiß, dass der Autohersteller 2024 bereits 1,4 Millionen Autos exportiert hat und schon in Europa produziert? Wer weiß, dass inzwischen das Herzstück der Plattform des Range Rover von Chery kommt? Oder dass Geely nicht nur Motoren für Mercedes baut, sondern dem Unternehmen auch knapp zehn Prozent von Mercedes gehören? Und dass Xiaomi den Rundenrekord für Viertürer auf der Nordschleife des Nürburgrings hält?
Die Geschichte der chinesischen Unternehmer hinter diesen Firmen kennen wir erst recht nicht. Wir wissen nicht, welche Ziele sie verfolgen, wo ihre Stärken liegen und wo ihre Schwächen. Nicht wenige sind Selfmade-Milliardäre, die sich aus armen Verhältnissen hochgearbeitet haben. Ihre Geschichten erzählen nicht nur davon, wie der Aufstieg gelingt, sie demonstrieren auch, wie man Krisen meistert. Sie zeigen, dass es nicht mehr nur den American Dream gibt, sondern auch den Chinese Dream. Doch wo ist der European Dream?
Wenn wir also wissen wollen, wie es um die Zukunft Deutschlands bestellt ist, müssen wir uns mit Firmen wie BYD, Geely, Chery, SAIC, BAIC, Xpeng, Seres, JAC, Nio oder Xiaomi beschäftigen, um nur einige zu nennen. Für dieses Buch habe ich mit Topmanagern und Gründern gesprochen, die mit kreativen Strategien Autos geschaffen haben, die die Welt noch nicht gesehen hat. Und die bereits an Verkehrskonzepten arbeiten, die für uns noch klingen, als kämen sie aus der Zukunft. Zum Beispiel autonome Autos, die vernetzt und sicherer fahren als der Mensch, oder fliegende Autos, die in China bereits für den Alltagsbetrieb zugelassen sind und am Himmel surren.
Wir haben lange geglaubt, die Chinesen würden sich auf Dauer damit begnügen, die Fabrik der Welt zu sein und das zu tun, was wir wollen. Schlimmer noch: Wir dachten lange, sie könnten nichts anderes. Wir haben die Klugheit und Zähigkeit ihrer Manager und Unternehmer ebenso unterschätzt wie die langfristige Strategie, die Peking etwa bei wichtigen Rohstoffen verfolgt – und das nicht einmal heimlich.
Wir haben es nicht für nötig gehalten, uns in die chinesische Perspektive hineinzuversetzen. Dabei hätte ein Blick in die Geschichte genügt, um zu begreifen, dass der für uns vermeintlich so überraschende Aufstieg der Chinesen nichts anderes ist als ein Wiederaufstieg. Die meisten der 22 Jahrhunderte, seit China als Nation existiert, war das »Reich der Mitte« eine innovative Weltmacht. Im 19. Jahrhundert jedoch waren die Chinesen zu überheblich geworden. Sie unterschätzten die industrielle Revolution in Europa. Die Folge: Chinas Wirtschaft war nicht mehr wettbewerbsfähig, soziale Unruhen nahmen zu. Der Kaiser musste Anfang des 20. Jahrhunderts abdanken, das Reich zerfiel und zerfleischte sich in Bürgerkriegen, bis Mao Zedong 1949 es wieder einte. Maos dann folgende brutale Kampagnen kosteten Millionen von Menschen das Leben. Zwar stieg China unter Mao zur fünften Atommacht der Welt auf, ein wirtschaftlicher Aufschwung aber blieb aus. Und so waren die meisten Chinesen erleichtert, als der Reformer Deng Xiaoping in den 1980er Jahren das Land schließlich wieder wirtschaftlich der Welt öffnete. Ein Wiederaufstieg begann, der in der Weltgeschichte einmalig ist. Noch nie wurden so viele Menschen so schnell aus der Armut befreit – 850 Millionen, so die Weltbank. Und bis heute haben die Chinesen vor allem ein Ziel: Sie möchten nach 150 Jahren Krise und dem folgenden Aufstieg wieder werden, was sie schon einmal waren: eine innovative Weltmacht. Dafür sind sie bereit, sehr hart zu arbeiten.
In vielem erinnert die Ignoranz der Chinesen im 19. Jahrhundert an die Europas und der USA gegenüber China im 21. Jahrhundert. Hoffentlich steht uns nicht eine genauso tiefe Krise bevor, wie sie die Chinesen durchstehen mussten. Hoffentlich lernen wir rechtzeitig aus der Geschichte, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns ein realistisches Bild von unseren neuen Wettbewerbern machen, die lange unsere Partner waren und es vielfach noch sind, nicht nur im Autobereich. Nur so können wir fundierte Strategien entwickeln, um weiter mitzuspielen.
Inzwischen gibt es rund 130 Autounternehmen in China, sie alle vorzustellen, würde Bände füllen. Manche habe ich nur am Rande gestreift, andere ausführlicher beschrieben, weil ihre Geschichte spannend und ihre Entwicklung relevant ist für unsere Zukunft in Deutschland und Europa.
Es geht dabei nicht nur um Autos oder andere Produkte, nicht nur um die Wirtschaftskraft Deutschlands. Es geht auch um unsere Werte: Denn nur, wenn wir wirtschaftlich stark sind, werden wir noch mit am Tisch sitzen, wenn die Spielregeln einer neuen multipolaren Weltordnung ausgehandelt werden, in der die Chinesen und der gesamte globale Süden eine große Rolle spielen. Eine Weltordnung, in der nicht mehr die Minderheit des Westens bestimmt, sondern die Mehrheit der Welt, unter Führung der stärksten Wirtschaftsmacht der Aufsteigerländer: China.
Früher hat uns dieser Tisch, an dem die Werte verhandelt wurden, quasi gehört, wir haben entschieden, wer daran Platz nehmen darf. Zuerst waren es die europäischen Kolonialmächte, die den Ton angaben, ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann die Amerikaner. Nach dem Zerfall der Sowjetunion träumte mancher schon vom Ende der Geschichte und meinte damit, dass die Welt nun einsichtig auf den westlichen Entwicklungsweg einschwenken würde. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Mehrheit der Welt möchte mehr Selbstbestimmung. Ein Prozess, der auch durch den Aufstieg der chinesischen Autoindustrie verstärkt wird. Denn wirtschaftliche Stärke lässt sich in politische Macht umwandeln.
Am Ende geht es also nicht nur um schnöde Autos. Sondern darum, wie groß der Gestaltungsspielraum ist, der uns noch bleibt, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie wir in Zukunft leben werden.
Frank Sieren
Peking im Juli 2025
Kapitel 1
AUDI – platter Primus
Wie das Unternehmen aus Ingolstadt in China vom Luxusprimus zum Ladenhüter wurde
Mit Audi verhält es sich ein wenig so, wie mit Ikarus in der griechischen Sage. Der war mit den Flügeln, die sein Vater Dädalus gebastelt hatte, zu nahe an die Sonne herangeflogen, wodurch das Wachs, das die Flügel zusammenhielt, schmolz. Ikarus stürzte ab, weil er zu hoch hinauswollte. Man könnte auch sagen: Hochmut kommt vor dem Fall.
Drei Jahrzehnte lang war Audi mit Abstand der erfolgreichste ausländische Premiumhersteller in China, insbesondere vor BMW und Mercedes Benz. Chinesische Autos konnten den Audis nicht das Wasser reichen. Doch innerhalb von nur zwei, drei Jahren hat sich das komplett gedreht. Inzwischen ist Audi auf Platz drei der deutschen Premiumhersteller zurückgefallen, die mittlerweile weit hinter ihren chinesischen Wettbewerbern rangieren. Die Chinesen bauen bessere, billigere und innovativere Autos, selbst im Premiumbereich.
Dabei war Audi von der Poleposition gestartet. Der Hersteller aus dem bayerischen Ingolstadt war der erste ausländische Premiumhersteller im Markt – eine Folge der 1988 begonnenen Kooperation mit dem chinesischen Staatskonzern First Automotive Works (FAW) im nordchinesischen Changchun. Seit 1996 produziert Audi in China Autos, beginnend mit dem Audi 100. Es war der Auftakt zu einer einzigartigen Erfolgsstory, die ihren Höhepunkt damit erreichte, dass die Ingolstädter 2015 ein Drittel ihrer Autos in China verkauften und über vierzig Prozent der Gewinne von dort kamen. 2024 jedoch brach die operative Umsatzrendite von Audi weltweit auf 4,6 Prozent ein. Das ist nicht einmal die Hälfte dessen, was Audi in den fetten Jahren 2011, 2012 oder 2013 eingefahren hat, vor allem in China. 2023 hatte die Rendite noch bei neun Prozent gelegen, ein Jahr später waren es nur noch sechs Prozent. »2025 wird nicht leichter werden, im Gegenteil«, prophezeite der Finanzvorstand der Volkswagen-Tochter, Jürgen Rittersberger, schon Ende März. Und das, obwohl bereits 7500 Stellen abgebaut werden und ein Werk in Brüssel geschlossen wurde. Die Zahlen für das erste Quartal 2025 sprechen Bände: minus sieben Prozent in China, bei den E-Autos sogar minus 35 Prozent. Minus drei Prozent sind es weltweit.
Dabei ist gerade China für die Zukunft von Audi zentral: Es ist der wichtigste Markt für die Ingolstädter, die dort 2024 mit knapp 650 000 Autos etwa so viel absetzten, wie in ganz Europa zusammen. Es ist der größte nationale Automarkt der Welt und der am stärksten wachsende. Der europäische schrumpft und der nordamerikanische mit den USA und Kanada ist mit gut 230 000 verkauften Autos viel kleiner. Bisher hatte der chinesische Markt Audi in Krisenjahren wie 2009 oder 2016 immer gerettet. Inzwischen zieht China Audi nach unten. Das Chinageschäft ist 2024 um mehr als vierzig Prozent auf 651 Millionen Euro abgestürzt, die Gewinne nach Steuern brachen um 33 Prozent ein. Audi leidet hier vor allem bei den E-Autos. Sie sind inzwischen längst der Goldstandard, auch wenn das mancher in Deutschland noch immer nicht wahrhaben will. Und gerade da tut sich Audi sehr schwer. 2024 setzte man mickrige 24 000 Stromer ab.
Das liegt nicht etwa an einer Wirtschaftsflaute in China. Denn chinesische Marken legten im gleichen Jahr ein fulminantes Wachstum hin. Selbst Marktneulinge im Premiumsegment wie Huaweis HIMA-Verbund (siehe Kapitel 9) verkaufte 440 000 Autos, bei Xiaomi (siehe Kapitel 11) waren es gut 200 000 – im ersten Jahr seit der Markteinführung. Der Absatz der New Energy Vehicles (NEV) insgesamt stieg in China 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 12,9 Millionen Autos.
Besonders bitter: Allein der Marktneuling und Smartphone-Hersteller Xiaomi hat in China im Premiumbereich aus dem Stand fast zehn Mal so viele E-Autos verkauft wie der einstige Marktführer Audi. Zahlen, auf die Audi nicht einmal weltweit kommt: bei einem Minus von acht Prozent waren es 164 000 Stromer. Und natürlich ist Xiaomi nicht der einzige einheimische Hersteller, der Audi in China abgehängt hat. Dazu kommen Nio (221 000 Stück) oder Xpeng (190 000) und Huawei, um nur mal drei neue Marken zu nennen. Sie haben ihren Wachstumszenit noch lange nicht erreicht. Nimmt man die Verbrenner dazu, bleibt bei Audi immer noch ein Einbruch um über zehn Prozent und das in einem Markt, der insgesamt um über drei Prozent gewachsen ist. Es fehlen also 13 Prozent allein dafür, um wie der Gesamtmarkt zu wachsen.
Doch wie konnte der jahrzehntelang führende deutsche Premiumhersteller im wichtigsten Markt der Welt derart überrollt werden? Um diese und andere Fragen zu klären, treffe ich Dietmar Voggenreiter. Er hat die Erfolgsstory von Audi in China in verschiedenen Positionen mitgeprägt. Seit 2002 in Diensten von Audi war er ab 2005 zunächst Strategiechef, von 2007 an China-Chef und von 2013 an Generalbevollmächtigter China. Zwei Jahre später zog er in den Audi-Vorstand ein. Kein anderer Vorstand eines deutschen Autokonzerns verfügte über mehr Chinaerfahrung als er. Selbst bei seinem Ausscheiden 2017 galt er noch immer als »Mr. China« der deutschen Autoindustrie.
Voggenreiter, der inzwischen bei der Unternehmensberatung Horváth & Partners arbeitet und Aufsichtsratschef des Kölner Motorenherstellers Deutz AG ist, ist ein ruhiger analytischer Mittfünfziger mit einer guten Portion Humor. Ein Mann, der auch in Zeiten großer Höhenflüge seine Bodenhaftung nie verloren hat.
Ein Autobauer im Kulturviertel
Wir sitzen in einem kleinen Pekinger Café gleich um die Ecke, wo früher in den guten alten Zeiten das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Audi war. Mitten im 798 Art District, dem bekanntesten Kulturzentrum Chinas. »Das war ein Novum für Audi und ein Novum für China, dass ein Autohersteller sein Forschungs- und Entwicklungszentrum im wichtigsten Künstlerviertel des Landes einrichtet«, erzählt Voggenreiter. »Aber wir wollten eben nicht nur nah bei unseren Kunden sein, sondern auch nah bei den jungen Kreativen.« Es sei ein großes Ereignis gewesen, betont Voggenreiter, als Audi die Genehmigung für den 7600 Quadratmeter großen Komplex im 798 Art District bekam. »Das zeigte uns: Auch die Behörden sind damals mit der Zeit gegangen.« Und dafür sei man sehr dankbar gewesen.
Voggenreiter spricht gern über seine Jahre in China, die trotz vieler Probleme sehr erfolgreich waren. Hat er das Desaster kommen sehen? Hat er die Chinesen unterschätzt? Damals, in den frühen Zehnerjahren, hätten sich Voggenreiter und sein Team schon vorstellen können, dass »chinesische Autos einmal in Schlagdistanz kommen. Einige unserer Techniker sahen die hohe Aufholgeschwindigkeit und schätzten, dass der ein oder andere chinesische Hersteller in zehn bis 15 Jahren aufgeschlossen haben könnte«, sagt er. So falsch sei die Einschätzungen aus heutiger Sicht gar nicht gewesen. Aber die Stärke bei den E-Autos und in der Software bis hin zum autonomen Fahren sei in dieser Wucht überraschend gekommen. Überhaupt nicht vorstellbar sei gewesen, dass es junge Leute, die am Wochenende im Künstlerviertel chillen, einmal cool finden würden, chinesische Autos zu kaufen, während deutsche nur noch für Kunden ab Mitte fünfzig interessant sein würden. So wie im Deutschland der 1980er Jahre der Audi 80.
Als 2013 die R&D-Abteilung (Research and Development) ihr neues Quartier im Künstlerviertel bezog, hatten China und Deutschland an diesem Ort bereits eine lange gemeinsame Geschichte. Die Fabrik, auf deren Gelände sich das Künstlerviertel entwickelt hat, war das erste deutsch-chinesische Kooperationsprojekt nach der Gründung der Volksrepublik China 1949. Vielleicht durfte Audi auch deshalb dort sein. Voggenreiter kennt die Geschichte, die schon damals viel über das deutsch-chinesische Verhältnis sagte.
Weil die neu gegründete Volksrepublik China Hilfe beim Aufbau brauchte, hatte sich Mao Zedong zunächst an Josef Stalin in Moskau gewandt. Nachdem eine Reihe gemeinsamer Projekte umgesetzt worden war, wurde Stalin zögerlich. Er wollte nicht alles allein stemmen. Und so reiste Ministerpräsident Zhou Enlai 1951 auf Vorschlag der Sowjetführung mit einer Delegation von chinesischen Wissenschaftlern und Ingenieuren in die damalige DDR, um dort um »Entwicklungshilfe« zu bitten. Ein Jahr später war die Zusammenarbeit in trockenen Tüchern, das »Projekt Nr. 157« konnte beginnen. Auf einem bisher landwirtschaftlich genutzten Areal nordöstlich von Peking sollten eine Fabrik für Militär-Elektronik und Quartiere für die Arbeiter entstehen. »Die Bautätigkeit wurde den Deutschen überlassen«, erzählt Voggenreiter, »und die Architekten haben sich für einen funktionalen Entwurf im Stil des Bauhauses entschieden. ›Form follows function‹ – das war damals eine Provokation für Moskau, denen ein Komplex im verschnörkelteren Sowjetstil lieber gewesen wäre.«
Schon während der Bauphase gab es Differenzen zwischen Chinesen und Russen und Russen und Deutschen. Zu Spitzenzeiten arbeiteten mehr als hundert ostdeutsche Experten an dem Industriebau, dessen riesige Innenräume von halbrunden Deckenabschnitten überwölbt wurden, unterbrochen von schrägen Fenstern. Dadurch entstanden sehr helle Räume, mit Dächern in einer Art Sägezahnoptik. Und: Alles sollte erdbebensicher sein. Denn Peking ist Erdbebengebiet, wie das große Beben von 1976 zeigen sollte. »Die Chinesen waren schon damals beindruckt von dem hohen deutschen Qualitätsstandard, die Russen hielten das jedoch für zu teuer, für typisches Over-Engineering«, sagt Voggenreiter. »Aber am Ende wurde es so gemacht, wie die Deutschen das wollten.«
Als die Fabrik 1957 eröffnet wurde, galt sie als eine der besten des Landes. Hier wurden unter anderem die Lautsprecher für die große Halle des Volkes hergestellt, einem gewaltigen neoklassizistischen Bau am Platz des Himmlischen Friedens, in dem Staatsgäste empfangen werden, Parteitage stattfinden und bis heute alljährlich der Nationale Volkskongress, das Parlament Chinas tagt. Mit der Öffnung des Landes in den 1980er Jahren änderte sich die Bedeutung der Fabrik, sie wurde unrentabel. Seit Ende der 1990er Jahre entwickelte sich das 69 Hektar große Gebiet langsam, aber stetig zu einem Künstlerdorf. Als ich das erste Mal da war, arbeiteten dort vor allem Bildhauer, die große Flächen zum Arbeiten brauchten. Die Fabrik war mit ihren perfekten Lichtverhältnissen wie geschaffen für Ateliers und Galerien. Immer mehr kamen, 2002 öffnete dann auch die erste internationale Galerie ihre Türen: Tokyo Gallery + Beijing Tokyo Art Projects. An der Decke der Galerie hängt ein Propaganda-Slogan aus der Mao-Ära: »Unsere Generation fängt an, zu erschaffen.«
Damals schien das noch mehr Wunsch als Wirklichkeit. »Für westliche Manager waren Chinesen nicht wirklich kreativ und innovativ«, blickt Voggenreiter zurück. Ein Jahr zuvor war China in die Welthandelsorganisation (WTO) eingetreten, das Land galt als Fabrik der Welt, in der Produkte, die im Westen entwickelt worden waren, gut und preiswert hergestellt wurden. Chinesen konnten nachbauen und mehr schlecht als recht kopieren. Die Bewunderung gerade für deutsche Ingenieurskunst war ungebrochen. Sie je zu erreichen, wäre eine gewaltige Aufgabe, sie gar zu übertreffen, schien in weiter Ferne. Das war sehr bitter angesichts dessen, dass China über viele Jahrhunderte eine innovative Weltmacht war.
Dazu passt, dass auch die Regierung zu dieser Zeit noch kein gutes Gespür für die Bedeutung von kultureller Kreativität hatte. 2004 wollte sie gar das Viertel abreißen lassen, um neue Gebäude für die Olympischen Spiele 2008 zu bauen. Doch die Künstler und Kunstinteressierten begehrten auf. Die Regierung lenkte schließlich ein und stellte am Ende das Gelände sogar unter Denkmalschutz. Aus dem »Projekt 157« wurde ein internationales Kulturprojekt: Sasaki, ein Bostoner Designbüro, entwickelte einen Masterplan für das Areal. Und die SevenStar Group, ein staatlich geführtes chinesisches Konsortium, dem das Land in der Gegend gehört und das den Pensionsfonds der Fabrikarbeiter verwaltet, tat sich mit Baron Guy Ullens zusammen, einem belgischen Geschäftsmann, Philanthropen und Kunstsammler. Ullens öffnete dort das erste private Zentrum für zeitgenössische Kunst in China – damals war das eine kleine Sensation. Und die zweite Sensation war, dass man begann, Kultur und Industrie auf dem Gelände zu mischen.
»2008 besuchte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder das Viertel«, erzählt Voggenreiter. »Niemand von uns ahnte, dass wir fünf Jahre später dort selbst einziehen würden.« Heute gehört das Kulturzentrum zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Pekings und die Förderung technologischer Kreativität ist zentraler Bestandteil der chinesischen Politik. Fast zehn Jahre war Audi ein Teil von 798, bis man 2022 in ein modernes Hochhaus umzog. »Es mag Zufall sein«, sagt Voggenreiter, »aber seltsam ist es schon. Mit dem Umzug gingen auch die wilden und sehr erfolgreichen Zeiten von Audi zu Ende.«
Atemloses Wachstum
Angefangen hatten die guten Zeiten damit, dass Audi in China nicht länger seine alten Modelle wie den Audi 100 verhökerte, sondern auf dringenden Wunsch der chinesischen Regierung die neusten Audis dort auf den Markt brachte und im Land baute. Als Voggenreiter 2002 zu Audi kam, hatte der chinesische Markt ein Volumen von gut einer Million Autos. »Es gab ein legendäres Meeting mit einem der politischen Top-Entscheider Chinas, das mir gut in Erinnerung geblieben ist«, erzählt Voggenreiter, das müsse so 2007 gewesen sein. »Der sagte bei einem Treffen mit uns ganz ruhig: ›2010 verkaufen wir zehn Millionen Autos. Und 2020 zwanzig Millionen.‹ Wir haben uns nichts anmerken lassen«, sagt der ehemalige Audi-Manager, »aber wir dachten, der verliert jetzt die Bodenhaftung.«
2005 hatte der chinesische Markt den deutschen zwar erstmals mit drei Millionen Autos überholt, aber dass er so groß werden würde, war nicht wirklich vorstellbar. »Es ging sogar noch schneller und noch weiter, als der Spitzenpolitiker damals vermutet hat,« räumt Voggenreiter ein. »Wir haben die Wachstumsgeschwindigkeit des Marktes komplett unterschätzt. Alle. Ich kenne niemanden in der deutschen Autoindustrie, der Anfang der Nullerjahre auch nur in diese Richtung gedacht hätte.« Auch keine der Marktstudien und Prognosen hätte dies angedeutet. »Ich weiß noch, wie wir 2005 versucht haben, zehn Jahre vorauszudenken, da war ich gerade Strategiechef von Audi geworden.« Audi war damals schon die erfolgreichste Premiummarke in China, alles lief super. Die chinesische Führung fuhr Audi A8. Der A6 war in China der Wagen der etwas weniger wichtigen Regierungsmitglieder und der Topfirmenwagen des Landes. Die Ingolstädter hatten gerade eine Langversion des A6 herausgebracht, nur für den chinesischen Markt, weil die Besitzer der Autos hinten saßen und mehr Beinfreiheit wollten.
»Unsere große Erkenntnis damals war – und die erschien uns schon geradezu revolutionär: Wir können uns nicht mehr in Ingolstadt ausdenken, was den Kunden in China gefallen könnte.« Das habe manchen in Ingolstadt sauer aufgestoßen, nachdem man von dort aus viele Jahrzehnte uneingeschränkt den Takt für die Welt angegeben hatte. »Das war unsere Art des Fortschrittsdenkens«, so Voggenreiter, »und darauf waren wir durchaus stolz.« Mit seinen Managern besuchte er chinesische Familien. »Wir wollten deren Lebenswelten verstehen und die Erkenntnisse an unsere Entwickler weitergeben. Das war ein ganz neuer Ansatz. Entwickler in Deutschland gingen damals davon aus, dass die rückständigen Chinesen gar nicht wissen können, was sie wollen, sondern dass wir sie an die Hand nehmen und ihnen ein Produkt vorsetzen müssen.« Wie falsch diese Einschätzung war, zeigten die Gespräche, die Voggenreiters Leute auch mit Kunden führten, die eine S-Klasse oder einen 7er BMW gekauft hatten. Sie wussten ziemlich gut Bescheid über die Vorteile der einen oder anderen Variante und hatten durchaus eigene Wünsche.
Doch die China-Manager mussten auch aufpassen, den Bogen für Ingolstadt nicht zu weit zu überspannen: »Wenn ich als Strategiechef jetzt auch noch angefangen hätte, zusammen mit dem damaligen China-Chef Erich Schmidt mit Eckwerten von mehr als zehn Millionen Autos pro Jahr innerhalb der nächsten zehn Jahre zu planen, wären wir für größenwahnsinnig erklärt worden«, sagt Voggenreiter. Keiner hätte sie mehr ernst genommen, nicht nur bei Audi, auch bei der deutschen Konkurrenz.
Der Kern von Voggenreiters maßvoller Strategie war: China wird ein größerer Markt als Deutschland und wir müssen bei der Entwicklung näher am Kunden sein. Damit war er schon weiter als die anderen deutschen Premiumhersteller und weiter als die öffentliche Meinung im Westen. 2001 hatte Gordon G. Chang seinen Weltbestseller The Coming Collapse of China veröffentlicht, der die Stimmung mitgeprägt hat. Die Skepsis in Deutschland war groß. Niemand sprach von den Chinesen als ernstzunehmende Wettbewerber, sondern alle redeten darüber, dass das kommunistische China ein Koloss auf tönernen Füßen sei.
Visionäre E-Auto-Strategie
Gerade in Deutschland sei man es gewohnt gewesen, die Trends und das Tempo in der Industrie zu setzen, erklärt Voggenreiter. Deshalb habe auch niemand aufgehorcht, als vor gut zwanzig Jahren – im September 2004 – das chinesische Ministerium für Wissenschaft und Technologie nüchtern feststellte: »Studien zu Elektroautos haben erste Ergebnisse erzielt. China verfügt über die wichtigsten proprietären Technologien zur Herstellung dynamischer Systeme und Komponenten von Elektroautos. Viele dieser Technologien haben ein international führendes Niveau erreicht.«
Von denen, die davon Notiz nahmen, hielten die meisten das schlicht für kommunistische Propaganda. Es war jedoch Teil eines gigantischen Förderprogramms für Hochtechnologie mit dem Zahlenkürzel 863, weil es im März 1986, dem dritten Monat des Jahres, ins Leben gerufen worden war. Das E-Auto-Programm wurde 2001 gestartet, just in dem Jahr, in dem China Mitglied der Welthandelsorganisation wurde. Und federführend war ausgerechnet ein ehemaliger Audi-Mitarbeiter. Wan Gang, ein Ingenieur, der gut Deutsch spricht, gilt heute als »Vater der chinesischen E-Auto-Industrie«.
Von 1985 bis 1991 war Wan nach seinem Studium in China zur Promotion an der Technischen Universität Clausthal in Niedersachsen. Gleich danach ging er zu Audi, in den Bereich Forschung und Entwicklung. Zwischen 1995 und 1998 arbeitete er mit Oliver Blume zusammen, heute Chef von VW und Porsche. Im Jahr 2000 kehrte Wan auf Einladung der Regierung nach China zurück, um den E-Auto-Bereich im Rahmen des Projekts 863 zu leiten. An der Shanghaier Eliteuniversität Tongji, deren Präsident er später wurde, baute er ein Forschungsinstitut für die Entwicklung von Wasserstoff- und E-Technologie auf. »Der umweltfreundliche Antrieb von Autos – ob mit Strom oder Wasserstoff – war immer mein Traum«, erinnert sich Wan in einem Doppelinterview mit Blume in der Wochenzeitung Die Zeit. »Um ihn zu realisieren, bin ich von Deutschland nach China zurückgegangen.« Schön wäre gewesen, er hätte das nicht tun müssen, weil E-Autos auch in Deutschland ein wichtiges Thema gewesen wären. Doch dem war nicht so.
Stattdessen baute Wan nun E-Motoren in VW Santanas ein, mit dem Know-how, das er in Deutschland erworben hatte. Damals hat Blume bei ihm in Shanghai promoviert, während er gleichzeitig Vorstandsassistent Produktion bei Audi war. »Zu dieser Zeit war die E-Mobilität für die internationale Automobilindustrie eine Utopie«, erinnert sich Blume, »aber Wan Gang hat schon damals fest daran geglaubt. Aus heutiger Perspektive war das visionär.«
Das Visionäre in diesem Bereich hat offenbar nicht auf Blume abgefärbt, der Kontakt mit Wan nicht dazu geführt, dass er bei VW oder gar in Deutschland zum Fürsprecher der E-Mobilität geworden wäre. Auch nicht, als er 2015 Vorstandsvorsitzender von Porsche wurde. Er hätte Deutschland zumindest eindringlich vor dem Aufstieg Chinas als E-Auto-Nation warnen müssen.
Bei BMW war man etwas früher wach geworden. 2016 waren die Münchner bei den E-Autos weltweit sogar auf Platz drei aufgestiegen, mit einem Marktanteil von sieben Prozent, hinter Tesla (neun Prozent) und BYD (13 Prozent). VW hingegen hatte zu diesem Zeitpunkt kein reines E-Auto auf dem Markt. Seit 2022 ist Blume neben seinem Job bei Porsche auch noch VW-Chef, also Vorstandsvorsitzender des Mutterkonzerns von Porsche. Doch da war es schon zu spät, da waren die chinesischen Hersteller längst aus dem Windschatten gefahren.
Audi auf der Überholspur
Als Voggenreiter 2007 das Angebot bekam, China-Chef von Audi zu werden, habe er das angesichts der Wachstumszahlen gerne angenommen. Audi war im Jahr zuvor um vierzig Prozent gewachsen und den deutschen Wettbewerbern um Meilen voraus. »Audi in China auf der Überholspur«, lauteten die Überschriften damals. Da machte auch die unglückliche Besitzstruktur des deutsch-chinesischen Joint Ventures nicht viel aus: Audi selbst hatte nur einen Anteil von zehn Prozent und war ansonsten eingeklemmt zwischen Anteilen der eigenen Muttergesellschaft Volkswagen und dem chinesischen Partner First Automotive Works (FAW).
Das Gefühl vorneweg zu fahren, wurde bei Audi auch durch die Performance der deutschen Wettbewerber gestärkt. Erst 2006 eröffnete Dieter Zetsche, damals Vorstandschef von DaimlerChrysler, in Peking das erste chinesische Mercedes-Werk, für das der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder im Dezember 2004 den Grundstein gelegt hatte. »Wir sind etwas später dran, aber in keiner Weise zu spät«, war Zetsche sich sicher. Richtig produziert wurde jedoch erst ab Mitte 2006 – zunächst nur die E-Klasse, und davon 5000 Stück. Darüber hinaus verkauften die Stuttgarter rund 7000 importierte S-Klasse-Wagen pro Jahr. Zum Vergleich: Das meistverkaufte Auto war der A6 mit über 60 000 Stück. Und bei Audi wurde neben dem A6 auch der A4 lokal gefertigt. Der importierte Q7 war 2006 erstmals im Markt präsent. BMW war zwar weiter als Mercedes, aber im Vergleich zu Audi ebenfalls weit abgeschlagen. Trotz einer Steigerung um fünfzig Prozent im Vergleich zum Vorjahr kamen die Münchner 2006 nur auf gut 36 000 Verkäufe. 22 500 der Autos, 3er und 5er, wurden im nordchinesischen Shenyang lokal produziert, der Rest wurde importiert.
Dass die Deutschen überhaupt lokal produzierten, lag an einer Regelung der Regierung, die ausländische Hersteller dazu nötigte, immer mehr Autos vor Ort zu fertigen und ein entsprechendes Lieferkettennetzwerk aufzubauen, anstatt sie nur zu importieren. »Wir wurden von der Regierung durch hohe Importzölle dazu gezwungen«, räumt Voggenreiter ein, »und haben aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir unsere Autos in China billiger, aber in vergleichbarer Qualität herstellen können, weil auch die Werke neuer waren.«
Während man sich bei den westlichen Platzhirschen also in Sicherheit wiegte und teils in Selbstgefälligkeit verharrte, kämpfte Vordenker Wan damit, seine E-Auto-Strategie durchzusetzen. Die erste Dekade des neuen Jahrtausends war für ihn eine, wie er selbst sagt, »harte Zeit«. Nur ab und zu habe es mal positive öffentliche Aufmerksamkeit gegeben. Selbst als er für die Olympischen Spiele 2008 in Peking fünfzig Elektrobusse, zwanzig Wasserstoff-Brennstoffzellen-Autos und zwei Wasserstoff-Brennstoffzellen-Busse entwickelt hatte, war die Resonanz mäßig. Niemand konnte sich vorstellen, dass nur zehn Jahre später allein im südchinesischen Shenzhen 16 000 Busse elektrisch fahren würden, mit Klimaanlage bei subtropischem Wetter, das ganze Jahr über.
»Ich kann mich gut daran erinnern, wie Wan Gang mir die Pläne für die elektrische Antriebstechnologie erläutert hat,« erzählt Voggenreiter. »Bei uns war der Glaube, dass sich E-Autos in der Geschwindigkeit durchsetzen würden, wie es dann tatsächlich der Fall war, eher gering.« Nur ein Amerikaner, der nicht aus der Autoindustrie kommt, wagte eine Wette. Warren Buffet kaufte 2008 für 230 Millionen Dollar Aktien von BYD. Während er damals mit seiner Investition einen Zehn-Prozent-Anteil hielt, sind es heute nur noch 4,4 Prozent – mit einem Wert von 2,4 Milliarden Dollar.
Audi brachte zu dieser Zeit mit dem Q5 das erste lokal produzierte Premium-SUV auf den chinesischen Markt. Damals gab es dieses Segment in China noch gar nicht, sehr wohl aber einen weltweiten Trend zu den dicken Brummern. Eigentlich ideal für die schlechten Straßenverhältnisse in den ländlichen Regionen des Landes. Und tatsächlich: »Das Fahrzeug verkaufte sich viel besser als prognostiziert«, erinnert sich Voggenreiter.
Dass es Wan in jener Phase so schwer hatte, lag daran, dass große Projekte wie der Umbau einer ganzen Industrie nur langsam in Schwung kamen und nicht etwa an seinem geringen Einfluss auf die Politik: Im gleichen Jahr, in dem Voggenreiter China-Chef von Audi wurde, kürte man Wan zum Wissenschafts- und Technologieminister des Landes – ohne dass er Mitglied der KP war. Ein Novum. Elf Jahre blieb er auf diesem Posten. »Ich war immer wieder von Neuem überrascht, wenn ich ihn getroffen habe, mit welcher Geradlinigkeit er das Thema E-Mobilität verfolgt hat«, erzählt Voggenreiter, »wohl wissend, dass vielleicht das ein oder andere später kommt als geplant. Aber er ist drangeblieben.«
Über den größten Teil von Wans Amtszeit hinweg schienen die deutschen Hersteller für die Chinesen unerreichbar. Vor allem die Autos seines ehemaligen Arbeitgebers Audi. Selbst im Volkswagen-Konzern waren die Ingolstädter ein Vorbild. Denn VW, als erster europäischer Autohersteller bereits seit 1984 in China, hatte sich in diesen Jahren noch nicht richtig von den alten Zeiten gelöst. Knapp 46 Prozent der 2006 verkauften Fahrzeuge waren alte Kisten wie der Santana (163 000) oder der Jetta (177 000). Nun wurden sie allmählich zu einer Belastung für das Image der Wolfsburger. Und sie machten vor allem Umsatz, aber kaum Gewinn.
Premium? Das war im Konzern Audi. Ingolstadt setzte auch beim Händlernetz Maßstäbe. Mercedes hatte zu dieser Zeit knapp achtzig Händler in China, BMW etwa sechzig, Audi aber über 120. Man blickte auf die deutsche Konkurrenz und konnte sich einmal mehr auf die Schulter klopfen. Dabei waren damals schon unter den zehn erfolgreichsten Pkw-Herstellern in China immerhin drei rein chinesische Produzenten. BYD stellte 63 000 Autos her, spielte aber noch nicht wirklich eine Rolle. Bei Geely waren es gut 200 000, bei Chery über 300 000. Aber: »Das waren noch keine wettbewerbsfähigen Autos, die ein Audi-Manager wahrgenommen hätte, und zwar zu Recht«, kommentiert Voggenreiter den damaligen Entwicklungsstand der Chinesen. Eine Haltung, in der man sich noch Jahre später bestätigt fühlen konnte, als der ADAC mit dem SUV »Landwind« von Jiangling Motors Corporation (JMC) das erste chinesische Auto überhaupt testete. »Die Sicherheitstechnik dieses Autos liegt dreißig bis vierzig Jahre zurück«, sagte ein ADAC-Sprecher 2013. »So einen Zusammenbruch wie bei diesem Auto hatten wir noch nie.« Der »Landwind« ist bis heute das schlechteste jemals im Auftrag des ADAC gecrashte Auto.
Die magische Zehn-Millionen-Marke
Es war die Zeit, in der Voggenreiter seine Strategie »eine Nasenlänge voraus« genannt hat. Es ging darum, immer eine Hauptbaureihe früher lokal zu fertigen als die deutschen Wettbewerber und damit die Autos billiger, aber in gleicher Qualität bauen zu können. Damals hat sich Voggenreiter voll auf die Frage konzentriert, welches Modell wie schnell lokalisiert wird und welches bewusst importiert wird. »Wir wollten bei den Zulieferteilen möglichst viel an Wertschöpfung im eigenen Land lassen, also die Teile mit Gewinnaufschlag von Audi Deutschland nach Audi China verkaufen. Peking wollte natürlich, dass wir so viel wie möglich in China herstellen und zuliefern. Das waren harte Verhandlungen, um zu Kompromissen zu kommen, die für beide Seiten gesichtswahrend und gewinnbringend waren«, so Voggenreiter. Ab 2008 gab es dann den ersten Gegenwind: eine Beschaffungswertgrenze für Dienstwagen der Regierung. »Dass Audi über dieser Grenze lag, war natürlich kein Zufall«, meint Voggenreiter.