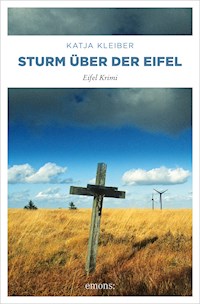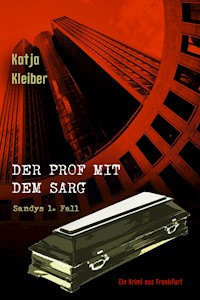4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Sandys Schwester Silvia gerät unter Verdacht, ihren Chef ermordet zu haben. Privatdetektivin Sandy setzt alle Hebel in Bewegung, um Silvias Unschuld zu beweisen. Die ehemalige Punkerin nimmt sogar einen Job in einer Großbank an, um den Mord aufzuklären. Als Sandy herausfindet, dass ihre Schwester sie belogen hat, muss sie sich entscheiden, ob sie auch gegen die eigene Familie ermittelt. Erst ein Ausflug ins Rotlichtmilieu bringt sie auf eine neue Spur. Führte der Banker ein Doppelleben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Der Banker mit dem Stöckelschuh
Sandy ermittelt in Frankfurt
Katja Kleiber
Copyright © 2021 by Katja Kleiber
c/o easy-shop
Kathrin Mothes
Schloßstraße 20
06869 Coswig (Anhalt)
www.katja-kleiber.de
Coverdesign: Juliane Schneeweiß
Dieses Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Erstellt mit Vellum
Disclaimer
Es handelt sich um ein fiktives Werk. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Institutionen sind rein zufällig.
Inhalt
1. Überraschender Besuch
2. Obdachlos
3. Dessous
4. Der Chef ist tot
5. Chillen am Main
6. Koks
7. Indizien
8. Blutiger Schmuck
9. Verknallt
10. Ausgetrickst
11. Fassadenkletterei
12. Der Junkie
13. Grippe
14. Ein Joint
15. Im Knast
16. Aktfotos
17. Die Cousine
18. Undercover
19. Ein netter Kollege
20. Der Brief
21. Blues
22. Schrottimmobilien
23. Herzrhythmus
24. Tequila
25. Schokoriegel
26. Drogenkurier
27. In der Zelle
28. Drogenfund
29. Alte Wunden
30. Pitbull in Aktion
31. Ausgeflogen
32. Auf dem Präsidium
33. Im Krankenhaus
34. Kein Anschluss unter dieser Nummer
35. Alte Liebe
36. Kontenkaskade
37. Schweizer Konto
38. Feine Strümpfe
39. Die Rausschmeißerin
40. Schätzchen
41. Bankgeheimnis
42. Die Frau in ihm
43. Taunusidylle
44. Der Zeuge
45. Alleingang
46. Sturmfreie Bude
47. Die Vernissage
Danksagung
Über die Autorin
Bücher von Katja Kleiber
Das Kind mit der Knarre: Chaos
Flammen
Überraschender Besuch
Ich hasste es, bei wichtigen Sachen wie Sex gestört zu werden. Mattus nackter Po schaute zwischen den Bettlaken hervor. Ich überlegte gerade, ob ich reinbeißen oder ihn sanft streicheln sollte.
Mattu schnarchte rhythmisch vor sich hin. Er hatte mir gestern einen Schnellkurs in Sachen Wein gegeben. Bisher konnte ich zwar Licher Pils von der Henninger Plörre unterscheiden, aber nicht einen Roten vom anderen. Jetzt schwirrte mir der Kopf. Keine Ahnung, ob es an dem Gerede über Rebsorte, Lage und Jahrgang lag oder am Restalkohol. Zu Sex waren wir nicht gekommen, das wollte ich jetzt nachholen. Dieser Hintern war einfach zu verführerisch.
Das Schrillen der Türklingel bohrte sich in mein Hirn. Mattu knurrte etwas Unverständliches und zog sich das Kissen über den Kopf.
Ich war zu faul, um aufzustehen. Der Sommer war unglaublich heiß. Das einzige Fenster meiner winzigen Wohnung stand sperrangelweit offen, aber kein Lüftchen rührte sich.
Die Türklingel schrillte wieder. Lang anhaltend. Jemand schien seinen Finger auf den Knopf zu halten. Außerdem war es nicht die Haustür, die Glocke klang anders. Jemand war direkt vor meiner Wohnung. Ich sprang auf, ging die wenigen Schritte zur Tür und riss sie auf. Da stand eine junge blonde Frau, die sich an einen riesigen Rollkoffer klammerte. Ich starrte sie an. Sie kam mir vage bekannt vor.
„Sandra! Zieh dir was an!“, quietschte eine mir wohlvertraute Stimme.
Meine Schwester! Wie kam die denn hierher?
„Wie kommst du denn hierher?“
„Lass mich erst mal rein.“ Sie schob den Rollkoffer wie einen Rammbock vor sich her, sodass ich automatisch zur Seite trat.
Sie hievte das Monstrum über die Schwelle und drängte sich an mir vorbei in das Apartment.
„Was …?“ Ihr fehlten die Worte.
Ich folgte ihrem entgeisterten Blick. Ein Kühlschrank, darauf eine Doppelkochplatte, ein geklauter Einkaufswagen voller Klamotten und ein Tisch mit drei Stühlen machten die Einrichtung aus. Früher als Punkerin hatte ich schlechter gewohnt. Meine vier Wände hier in Frankfurt waren echt top. Die Miete war bezahlbar, von den Nachbarn kriegte ich kaum was mit.
Silvias Miene wurde starr. Ach ja, da war noch die Doppelmatratze, auf der Mattu vor sich hin schnarchte. Inzwischen hatte er das Laken über sich gezogen. Wie konnte er bei dem Lärm nur weiterschlafen? Er musste tatsächlich ausgelaugt sein.
„Wie kommst du denn hierher?“, fragte ich noch einmal.
Meine Schwester Silvia hatte ich seit, na, seit mindestens zehn Jahren nicht mehr gesehen. Während ich mich in besetzten Häusern und auf Punkkonzerten herumtrieb, hatte sie wahrscheinlich brav die Schule beendet und einen vermutlich grottenlangweiligen Beruf ergriffen. Konnte ja nicht jeder so einen coolen Job haben wie ich.
„Sandra, ich muss einige Tage bei dir bleiben. Wirklich nur ein paar Tage, bis ich eine Wohnung gefunden habe.“
Jetzt starrte ich sie entgeistert an. Meine Schwester? Bei mir wohnen?
„Äh.“ Mehr brachte ich nicht heraus.
„Ich habe eine Stelle in der Zentrale der Deutschen Bank bekommen“, sprudelte sie hervor. „Für mich ist das die Chance auf eine Karriere, ein echtes Sprungbrett.“
„Ja und, wieso läufst du dann hier auf?“ Ich musterte sie kritisch.
Eigentlich hatten wir beide das gleiche mausfarbene Haar, nur sie hatte ihres honigblond getönt und zu einem akkuraten Bubikopf schneiden lassen, während meines raspelkurz und vom vielen Färben ausgelaugt war. Ihre Brauen waren gezupft, die Augen sorgfältig geschminkt. An den Ohrläppchen baumelten Perlenohrringe, die ich zuletzt bei meiner Mutter gesehen hatte. Instinktiv griff ich an meine Ohren, die von Löchern gespickt waren.
Silvia trug ein ärmelloses Leinenkleid. Trotz der Hitze hatte sie ein Jäckchen übergeworfen, was Gestricktes mit vielen großen Maschen. Sie duftete nach irgendeinem Blümchenparfüm.
Mir wurde bewusst, dass ich immer noch nackt war. Ich wühlte in dem alten Einkaufswagen und zerrte ein schwarzes T-Shirt und einen Slip hervor, um mich notdürftig zu bekleiden. Mehr konnte mein Schwesterchen bei diesen Temperaturen nicht erwarten.
Schließlich setzte ich mich an den Tisch und deutete auf die freien Stühle. Silvia nahm Platz und schlug geziert die Beine übereinander.
„So, dann willst du hier Karriere machen.“ Sie war also Bankerin geworden. Privatdetektivin war auf jeden Fall die bessere Wahl, fand ich. Ich verstand immer noch nicht, wieso sie bei mir aufschlug. Wir hatten uns in den letzten zehn Jahren nichts zu sagen gehabt und auch nicht vermisst, zumindest was mich anging. „Woher hast du überhaupt meine Adresse?“
„Deine Nummer steht im Telefonbuch, und als ich da angerufen habe, hat mir die Sekretärin deine Straße genannt.“
Soso. Mit der Trine würde ich ein paar Worte reden. Ich kannte sie über meine Freundin Freifrau Freya von Buckow. Die gestandene Rechtsanwältin vermietete mir einen Raum unter dem Dach ihres Prachtbaus im Westend. Eine lange Geschichte, wie es zu dieser Freundschaft gekommen ist, jedenfalls residierte meine Detektei dadurch in einer der besten Gegenden Frankfurts. Die Trine, die eigentlich Christel hieß, bewachte Freyas Vorzimmer und nahm meine Anrufe entgegen, wenn ich nicht da war. Jetzt hatte sie meine Privatadresse ausgeplaudert.
„Okay, und wie denkst du dir das?“ Ich wies mit einer Rundumbewegung auf mein kleines Reich. „Hier ist kein Platz.“
„Sandra, bitte!“ Sie schaute mich flehentlich an.
„Sandy!“
„Wie?“
„Sandy! Ich heiße jetzt Sandy.“
Meine Eltern waren auf die bescheuerte Idee verfallen, mich „Sandra Isolde“ zu taufen. „Sandy“ war das kleinere Übel.
„Ich finde keine Wohnung in Frankfurt. Ich habe das ganze Internet durchsucht, nichts. Dann habe ich Makler angerufen, die haben nicht mal zurückgerufen.“ Ihr Stimme wurde schrill.
Mattu wälzte sich unruhig auf der Matratze hin und her.
Silvia umklammerte immer noch den Griff ihres Rollkoffers. „Normalerweise hat die Bank Gästewohnungen für solche Fälle, aber die sind mit Indern belegt.“
„Mit Indern?“
„Die machen irgendeine Weiterbildung wegen des IT-Systems der Bank. Das wird von Indien aus betreut.“
Ich stöhnte. Meine Schwester auf die Straße zu schicken, war keine Option. Sie würde das nicht eine Nacht aushalten. Ich wusste, wovon ich sprach. Nachdem die Bullen unser besetztes Haus in Hamburg geräumt hatten, hatte ich einige Tage auf einer Parkbank im Planten un Blomen geschlafen. Es war nicht nur unbequem, sondern ich holte mir auch eine Lungenentzündung. Wenn die Streetworkerin mich nicht gefunden und ins Krankenhaus gebracht hätte, wäre ich wohl nicht mehr am Leben. Meine Schwester würde in einer einzigen Nacht auf einer Frankfurter Parkbank durchdrehen. Ich stellte mir vor, wie Penner und Junkies sie um einen Euro anbettelten, falls sie ihr nicht gleich die Brieftasche klauten. Silvia würde vor Ekel sterben.
Ich seufzte. „Na gut, du kannst ’ne Weile bleiben. Aber ich habe nur die Matratze.“
Silvia blickte skeptisch auf das Ding, das auf Paletten lag. Mattu richtete sich halb auf. Er stierte uns aus glasigen Augen an.
„Danke. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann“, sagte Silvia. „Räum halt ein bisschen auf, dann kann man es doch aushalten.“ Sie deutete zu den Weinflaschen und Mattus verschlafene Gestalt. „Hier scheint man ja spät aufzustehen.“
Mattus stöhnte. Es klang nach Protest. Immerhin war Sonntag. Ich wüsste nicht, wieso ich nicht um zwölf noch im Bett liegen sollte. Wir hatten es uns verdient nach der kleinen Orgie gestern, das musste ich Silvia allerdings nicht unter die Nase reiben.
Mattu schwang die Beine von der Matratze und stand auf. Er hielt es nicht für nötig, das Laken mitzunehmen.
Bewundernd blickte ich ihn an. Keine Ahnung, was er an mir fand, aber als Mann war er ein Glückstreffer. Er machte bisher keine Anstalten, unsere lockere Beziehung irgendwie Richtung Eigenheim und Ehe zu drängen, versuchte nicht einmal, mich von den Vorteilen des Zusammenlebens zu überzeugen. Ehrlich gesagt, hatte ich seine Wohnung noch nie gesehen. War einfach zu weit weg, irgendwo hinter Hanau.
Außerdem hatte Mattu graue Augen, die ich stundenlang anschauen konnte. Sie passten gut zu seinem ergrauten Stoppelschnitt. Ordentlich genug für einen Beamten, struppig genug, um cool zu sein.
„Oh.“ Silvia schlug eine Hand vor den Mund.
Mattu schwankte ins Bad, sodass ich noch einmal seinen straffen Hintern bewundern konnte.
Obdachlos
Kalle kaute mir ein Ohr ab. Jetzt erzählte er schon zum dritten Mal, wie ihn seine Frau verlassen hatte. „Die Alte“, wie er sagte. Mit der Trennung habe es angefangen. Das Saufen und alles andere auch.
Ich nuckelte an meinem Bier. Die Unterhaltung am Kiosk in der Tillystraße war nicht besonders erhebend. Die anderen, die hier morgens um neun mit ihren Bierflaschen herumstanden, schienen Kalles Geschichte auswendig zu kennen. Zumindest schenkten sie ihm keine Beachtung. Mich hatten sie vorhin nur gemustert. Da ich ein Bier bestellt und mich damit an die Theke gehockt hatte, stuften sie mich wohl als ihresgleichen ein.
Ich hörte Kalle mit einem Ohr zu, versuchte, möglichst langsam zu trinken, und behielt das Haus gegenüber im Blick. Hier wohnte Achim Schrader, der sich krankgemeldet hatte. Der Arbeitgeber, die Telekom in Darmstadt, hatte die Detektei Meier beauftragt, die Krankschreibung zu überprüfen. Meier hatte mich heute in aller Frühe angerufen und angeschnauzt, ich solle die nächsten drei Tage ein Auge auf Schrader haben. Meier reichte mir Aufträge weiter, für die sein Büro keine Zeit hatte oder die er zu nervig fand für seine Angestellten. Hier war wohl Letzteres der Fall. Seit einer Stunde fixierte ich die Haustür gegenüber und ließ Kalles Tiraden über mich ergehen. Jetzt war er wieder an der Stelle, wie er seinen Job verloren hatte. Seine Erzählung war eine Platte mit einem Sprung, an dem die Nadel hängen blieb. Fakt war, dass er tiefes Mitleid mit sich und seinem Schicksal hatte.
Da, die Tür ging auf. Schrader trat heraus – er sah zwar nicht ganz so aus wie auf dem Passfoto aus seiner Personalakte, das die Telekom eingescannt und rübergeschickt hatte, aber er war es.
Ich drückte Kalle mein Bier in die Hand. „Für dich. Ich muss weg.“
„Das ist ja noch fast voll.“ Er schnappte sich die Flasche und umklammerte sie mit der einen Hand, während er mit der anderen seine eigene an den Mund stemmte. „Komm mal wieder!“, rief er mir hinterher.
Ich folgte Schrader, der zur Straßenbahnhaltestelle ging und brav einen Fahrschein zog. Ich tat es ihm gleich, denn ich konnte es mir nicht leisten, wegen Schwarzfahrens aufgehalten zu werden, während das Zielobjekt entschwand.
Während wir auf die Bahn warteten, beobachtete ich den Mann unauffällig. Er trug eine abgeschnittene Jeans und ein T-Shirt. Von einem Humpeln war nichts zu bemerken, dabei hatte er seinem Chef etwas von „Bänderdehnung“ im linken Bein erzählt.
Die S-Bahn rauschte heran, wir stiegen ein. In der Bahn war es noch heißer als draußen, falls das überhaupt möglich war. Die Klimaanlagen der Frankfurter Straßenbahnen versagten regelmäßig, wenn die Temperaturen über dreißig Grad stiegen. Auf den Klimawandel waren die Verkehrsbetriebe offensichtlich nicht vorbereitet. Ich atmete möglichst flach, um den Dunst aus Schweiß und einer Mischung billiger Parfüms in dem Waggon nicht allzu tief in die Lunge zu kriegen.
Die Linie 11 durchquerte an der Mainzer Landstraße einige ärmere Viertel. Schrader und ich schienen die einzigen Deutschen an Bord zu sein. Die übliche Frankfurter Mischung: eine afrikanische Mutti mit einem hübschen kleinen Blag, einige junge Türken, die wohl die Schule schwänzte, osteuropäische Frauen im Billigchic.
Die Bullenhitze schläferte mich ein. Meier hatte mich viel zu früh aus den Federn gerissen. Meine Augen fielen auf halbmast. Fast hätte ich verpasst, dass Schrader an der Jägerallee ausstieg. Er trottete über die Straße, ich hinterher. Er bog in die Schrebergartensiedlung ein, ich hinterher. Zum Glück blickte er sich nicht um. Er öffnete ein Gartentor zu einer Parzelle. Schräg gegenüber die Schnitzelranch, das Wirtshaus der Kleingärtner. Ich hockte mich an einen Tisch auf der Terrasse, halb verborgen von einer Grünpflanze. Von hier hatte ich das Gartengrundstück, das Schrader betreten hatte, gut im Auge. Gerade bollerte er gegen die Tür der Laube. Ein älterer Mann mit Baseballkappe öffnete ihm.
„Und, wie?“ Er sprach laut genug, dass ich ihn verstehen konnte.
„Muss“, antwortete Schrader und verschwand mit dem anderen in der Hütte.
„Sie wünschen?“ Der Wirt der Schnitzelranch sah mich fragend an.
„Ein Wasser bitte.“ Ich war nassgeschwitzt, obwohl ich mich nur wenige Schritte bewegt hatte. Noch ein Bier um die Uhrzeit bei der Hitze würde mich umhauen.
Mein Beruf war wirklich nicht der schlechteste. Meine Schwester saß jetzt in ihrem Büro vor einem Computerbildschirm. Sicher war der Raum auf arktische Temperaturen heruntergekühlt, sodass sie sich bei nächster Gelegenheit erkälten würde.
Währenddessen befand ich mich draußen auf einer Terrasse, die wenigstens manchmal ein Luftzug erreichte. Der Wirt stellte mir wortlos ein Wasser hin und verzog sich wieder nach drinnen. Eine müde Zitronenscheibe hing in dem Glas. Ich quetschte sie aus und sah zu, wie sich die Eiswürfel in Sekundenschnelle auflösten.
Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, was sich im Garten gegenüber tat. Schrader und sein Gartenkumpel machten sich an einem Stapel Pflastersteine zu schaffen. In den folgenden Stunden verfolgte ich, wie sie eine Auffahrt zu dem Gartenhäuschen pflasterten. Ihnen lief der Schweiß in Strömen über die Gesichter, während ich noch einige Wasser trank und schließlich ein Schnitzel orderte. Ging ja auf Spesen. Es gelang mir, hinter der Grünpflanze versteckt einige Fotos von den Männern zu schießen. Hoffentlich war Schrader gut genug zu erkennen. Auf dem winzigen Display konnte ich das nicht feststellen. Immerhin, Auftrag ausgeführt. Ich fand, das wäre genug Arbeit für heute, zumal mir Meier sicher nur einen Bruchteil dessen auszahlte, was er der Telekom abknöpfte. Ich war sein Laufbursche, er würde Provision kassieren. Seine Detektei war richtig gut im Geschäft.
Als ich nach Hause kam, war meine Schwester noch nicht da. Ich griff mir ein Bier aus dem Kühlschrank. Das war gut gekühlt, ein Genuss nach dem lauwarmen Wasser in der Schrebergartenkolonie. Dann sackte ich auf die Matratze und stülpte mir Kopfhörer über. Motörhead lenkte mich ab, und das Bier machte die Hitze erträglich.
Schließlich senkte sich Dunkelheit über die Stadt. Ich raffte mich auf und öffnete das Fenster. Die Luft, die hereinschwappte, war heißer als die im Zimmer. Ich war zu faul, wieder aufzustehen, um das Fenster zu schließen.
Ich musste eingedöst sein. Ein Donnern haute mich aus dem Schlaf. Es krachte noch einmal, dann blitzte und krachte es in Folge. Schließlich brach ein Platzregen herunter. Ich rappelte mich auf und trat ans Fenster. Im Hinterhof war niemand zu sehen. Die Studenten aus dem Erdgeschoss, die dort manchmal rauchten, hatten sich wohlweislich in ihre Bude verzogen.
Der Regen reinigte die Luft von den üblichen Abgasen, es roch nahezu frisch. Ich streckte den Arm aus, so weit ich konnte. Einige dicke Tropfen platschten in meine hohle Hand. Ich rieb mir die Nässe übers Gesicht. Dann schloss ich das Fenster, damit es nicht hereinregnete.
Ein Schlüssel drehte sich im Schloss, und eine patschnasse Silvia rumpelte herein. Sie kämpfte mit einem großen Karton. Er rutschte ihr aus der Hand und knallte auf den Boden. Auf der Packung prangte eine fröhliche junge Frau auf einer Aufblasmatratze.
Silvia sackte auf einen Stuhl. Ihr Make-up war verschmiert, Schweißtropfen zeichneten sich unter ihrem Gesichtspuder ab.
„Frankfurt ist schrecklich. Wie kannst du nur hier wohnen?“
„Ich wohne ganz gut hier. Wieso?“
„Es war ein furchtbarer Tag.“
Mein Tag in Frankfurt war gar nicht schlecht gewesen, aber das sagte ich ihr nicht. Ich bot meiner Schwester ein Bier an. Sie verzog angewidert das Gesicht. Was anderes hatte ich nicht zu bieten. Oder doch. Ich ließ Wasser aus dem Hahn in ein Glas laufen und reichte es ihr. Sie beäugte es skeptisch, dann kippte sie es in einem Zug herunter.
„Was ist passiert?“
Wieso hasste sie Frankfurt gleich nach ihrer Ankunft?
„Es gibt einfach keine Wohnungen! Es war so schrecklich, ich bin bei dieser Hitze hin und her gefahren, nichts zu machen. Die Makler sind dermaßen unverschämt!“ Sie holte Luft und schimpfte weiter. „Die stellen einfach Fotos auf ihre Website, die gar nicht der Wahrheit entsprechen.“
Ein bekanntes Problem. Es gab nicht genug Wohnraum in Frankfurt. Mein Vermieter versuchte dauernd, die Miete für dieses winzige Loch hochzusetzen. Nur Freyas gestelzte Schriftsätze hatten mich bisher vor einer Wuchermiete bewahrt.
„Dann war ich bei einer Wohnung, da standen die Leute Schlange bis auf die Straße, nur für die Besichtigung.“
Ich war froh, nicht umziehen zu müssen.
„Wie war es denn bei der Bank?“, fragte ich, um sie abzulenken.
„Und dann habe ich eine Wohnung gesehen, die war echt schön, aber die Flugzeuge flogen so niedrig über das Haus, dass man sein eigenes Wort nicht verstand.“
Auch das war nichts Neues. Die Stadtteile südlich des Mains litten unter Fluglärm.
„Und dein erster Arbeitstag?“
Silvia schlug die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen.
„Was denn?“
So schlimm konnte es selbst bei der Deutschen Bank nicht sein.
„Ich habe Mamas Ohrring verloren. Du weißt schon, diese Klipse mit den großen Perlen. Einer ist weg, einfach weg!“
Schien ja ein echter Unglückstag für sie zu sein. Jetzt erst bemerkte ich, dass sie nur noch einen Perlenohrring trug.
„Wie kommst du an Mamas Ohrringe?“
Silvia sprang auf, ging ans Spülbecken und schöpfte sich Wasser ins Gesicht. Schließlich richtete sie sich auf, schien gefasster. „Sie hat sie mir geschenkt, als ich die Stelle bei der Bank bekommen habe in Hannover. Sie meinte, das würde seriös wirken.“
In der Tat, die Ohrringe ließen sie sicher zehn Jahre älter wirken. Nur dass jetzt einer weg war.
„Du wirst ihn schon wiederfinden“, sagte ich, um sie zu trösten.
Mir hatte Mutter noch nie etwas Wertvolles geschenkt. Wahrscheinlich wusste sie, dass ich es sofort zu Geld machen würde. Trotzdem ungerecht, dass Silvia die Ohrringe bekommen hatte. Die Perlen waren echt und hätten eine Menge Kohle gebracht.
Silvia schnaufte wütend. Dann machte sie sich über den Karton her und zog eine riesige Matratze hervor. Das Paket enthielt auch eine Fußpumpe, mit der sie das Monstrum aufblies. Schließlich war die Matratze prall gefüllt. Sie nahm fast den ganzen Rest des Zimmers ein.
Dessous
Achim Schrader war auf den Fotos gut zu erkennen. Gemeinsam mit seinem Kumpel hockte er auf dem Boden, richtete Pflastersteine, klopfte sie fest und schleppte neue heran. Er hantierte mit Wasserwaage und Seil, damit alles gerade wurde. Sogar die Schweißtropfen auf seiner Stirn waren gestochen scharf abgelichtet. Ich klickte durch die Bildfolge auf meinem Monitor. Die Fotos könnten in einem Lehrbuch für Pflasterer erscheinen. Alle Arbeitsschritte waren festgehalten. Sollte ich ihn um seinen Job bei der Telekom bringen? Dort schwitzte er mit Sicherheit weniger und verdiente mehr als bei der Schwarzarbeit im Kleingarten.
Das Telefon klingelte. Wahrscheinlich Meier, der mir Druck machen wollte. Wenn es nach ihm ging, sollten die Berichte immer schon vorgestern fertig sein. Ich nahm ab.
„Detektei Hardenberg, was gibt’s?“, knurrte ich.
„Die haben meinen Chef umgebracht. Sandra, was soll ich nur machen? Die Polizei ist hier und …“ Silvias Stimme ging in ein Schluchzen über.
„Was? Wer hat deinen Chef umgebracht? Wieso?“ Besonders logisch klangen meine Fragen nicht. „Nun beruhige dich erst mal. Alles halb so schlimm“, säuselte ich.
„Mein Chef ist tot. Jetzt ist die Polizei da und verhört uns alle.“ Silvia klang panisch.
„Bleib ganz ruhig.“ Wieso musste ausgerechnet meine Schwester in so was reinrutschen? „Wie umgebracht? Im Ernst, ein Mord?“
„Weiß nicht“, sagte sie erstickt.
„Wahrscheinlich war es nur ein Herzinfarkt, und die Polizei macht eine Routinebefragung.“
„Ich weiß nicht“, schluchzte sie. „Aber er ist tot.“
„Silvia, hör mir mal zu, du hast nichts damit zu tun. Also beantworte die Fragen der Polizei, so gut du kannst.“
„Meinst du?“ Sie schien Hoffnung zu schöpfen.
Einer Punkerin hätte ich geraten, den Mund zu halten und kein Sterbenswörtchen zu den Bullen zu sagen. Meine Schwester war allerdings eine seriöse Bankangestellte. Sollte sie der Polizei doch sagen, dass sie zur Tatzeit Bilanzen aufgestellt hatte oder was immer sie da trieb. Sie sollte einfach so harmlos auftreten, wie sie in Wirklichkeit war.
„Ja, du erzählst wahrheitsgemäß, was du weißt. Und so schnell du kannst, kommst du nach Hause. Dann beruhigst du dich erst mal“, redete ich auf sie ein.
„Okay. Mach ich.“ Sie hörte sich schon etwas ruhiger an.
Im Hintergrund wurden Stimmen laut. Silvia legte auf, ohne sich zu verabschieden.
Ich rannte die Treppe hinunter in Freyas Kanzlei. Ohne auf die Trine zu achten, riss ich die Bürotür auf. Freya war nicht da.
„Freya ist nicht da“, sagte die Trine hinter mir.
„Seh ich“, fuhr ich sie an. „Ist sie bei Gericht?“
„Shoppen.“ Die Trine blätterte mit sorgsam gefeilten und lackierten Fingernägeln eine Seite in ihrem Modemagazin um.
Shoppen? Meines Wissens hatte Freya ihre Einkäufe bisher zeitsparend im Internet erledigt. Bei ihrer Topfigur passte sie problemlos in die Normgrößen. Und jetzt ging sie shoppen? Neues Hobby, oder was?
Die Trine hatte einen gigantischen Ventilator mit Standfuß vor ihrem Schreibtisch aufgestellt, der ihr mit floppenden Geräuschen Luft zufächelte. Allein dieses „Flopp-Flopp“ den ganzen Tag würde mich wahnsinnig machen. Da fiel mir ein, dass ich noch ein Wörtchen mit der Trine zu reden hatte.
Ich baute mich vor ihr auf und stützte die Hände auf den Schreibtisch. Als ich mich vorbeugte, rollte sie mit ihrem Bürostuhl nach hinten.
„Du hast meine Adresse rausgegeben.“ Mein Ton war so finster wie meine Gedanken.
Die Trine rollte noch weiter nach hinten, bis sie mit der Rückenlehne an die Wand stieß. „Ja, da hat jemand angerufen, aber das war doch deine Schwester.“ Ihre Stimme war eine ganze Tonlage hochgerutscht.
Die Trine war als Sekretärin völlig unfähig, gehörte jedoch zu Freyas menschlichen Rettungsprojekten.
„Meine Privatadresse wird nicht herausgegeben“, sagte ich. „Ich habe übrigens keine Schwester.“
Da sollte sie mal dran knapsen. Ich rauschte hinaus und stapfte die Treppe hoch.
Hier saß ich wieder in meinem Büro und starrte auf die Fotos auf dem Bildschirm. Eine kleine Erpressung wäre sicher auch drin. Wie viel Schrader wohl zahlen würde, um seinen Telekom-Job zu retten? Ich schlug in der Kopie der Personalakte nach. Enttäuschend, er war Pförtner. Wahrscheinlich saß er Wechselschichten in irgendeinem Pförtnerhäuschen ab und kam mit dem Lohn nicht über die Runden. Wenn sein Kumpel ihm für die schweißtreibende Plackerei mit den Pflastersteinen einen Fuffi zugesteckt hatte, wäre das eine willkommene Aufbesserung seines Lohns gewesen.
Ich öffnete eine neue Datei und tippte Schraders Namen und Adresse ein. Dann erfand ich ein Observationsprotokoll, nach dem er gegen ein Uhr nachmittags zum Kiosk gehumpelt war, um ein Päckchen Zigaretten zu kaufen, und ansonsten das Haus nicht verlassen hatte. Statt einem rechnete ich drei Tage ab. So rettete ich Schraders Job und meinen Kontostand.
Missmutig betrachtete ich die Liste, die Meier geschickt hatte. Alles Leute mit langen Krankenständen und Fehlzeiten, die ich überprüfen sollte. Für heute hatte ich genug getan. Das Büro unter dem Dach heizte sich immer mehr auf. Das Gewitter gestern Abend hatte nur vorübergehend Abkühlung gebracht. Ich zog die Jalousie noch ein Stück herunter, packte meine Sachen und ging.
Unten wäre ich fast mit Freya zusammengestoßen, die mit Schwung zur Tür hereinkam. Sie war beladen mit einigen großen Tüten, auffällig mit Markennamen bedruckt.
Ich zog neugierig an der größten Tüte, die riesige Schnörkelbuchstaben in Rosa trug. „Was hast du denn gekauft? Zeig mal her.“
Freya klappte die Tüte auf, machte sie aber sofort wieder zu.
„Brauchte unbedingt neue Unterwäsche“, murmelte sie.
Worauf ich einen kurzen Blick erhascht hatte, fiel mehr unter die Kategorie „Dessous“. Irgendetwas Dunkelgrünes mit viel Spitze hatte aus der Tüte hervorgeblitzt.
Was hatte Freya vor? Wollte sie endlich Pit eine Chance geben, der seit Jahren um sie herumscharwenzelte?
Freya schob die Tüten schnell in eine Ecke neben ihrem Bürostuhl, sodass ich nicht reingucken konnte.
„Ich muss arbeiten“, quetschte sie hervor und schloss die Tür vor meiner Nase.
Ich war mir sicher, dass sie ungestört sein wollte, um ihre neuen Eroberungen anzuprobieren.
Der Chef ist tot
Silvia schleppte sich zur Tür herein. Stöhnend ließ sie sich auf einen Stuhl fallen. Ihre Augen waren verheult, vom Make-up war so gut wie nichts mehr übrig und die Frisur verstrubbelt.
„Jetzt entspann dich erst mal.“ Das war das Beste, was mir einfiel.
Kaum hatte sie sich gesetzt, klingelte es an der Haustür. Ich schaute Silvia an. Hatte sie etwa jemanden in meine Wohnung eingeladen? Sie zuckte mit den Schultern. Ich drückte den Öffner, ging ins Treppenhaus und blickte nach unten. Schwere Schritte näherten sich langsam. Schließlich leuchtete etwas Rotes auf. Das entpuppte sich als ein prächtiger Irokesenkamm auf einem ansonsten kahl geschorenen Schädel.
„Wombel!“
Mein Punkerkumpel aus Hamburg schnaufte die Treppe hoch. Trotz der Hitze trug er wie gewohnt Springerstiefel. Auch den Seesack, sein übliches Reisegepäck, schleppte er mit sich.
„Hi, Sandy!“ Er drückte mich an sich.
Ich fühlte, dass sein T-Shirt durchgeschwitzt war. Er roch nach Bier.
Dann hielt er mich auf Armlänge von sich. „Gut siehst du aus!“
Wenn er Süßholz raspelte, wollte er garantiert etwas von mir.
„Kann ich ein paar Tage bei dir bleiben? Ich hab beruflich in Frankfurt zu tun.“
Das konnte ja lustig werden. Ganz schön eng mit drei Leuten in der Bude. Ich sagte erst mal gar nichts.
Irgendwas stimmte nicht mit Wombel. Ich musterte ihn kritisch. Auch Silvia starrte ihn an. Vermutlich hatte sie noch nie einen Punker aus der Nähe gesehen, schon gar nicht solch einen riesigen. Wombel könnte als Prototyp des Deutschen in jedem Kinofilm auftreten. Er war groß und breitschultrig, hatte blaue Augen. Wahrscheinlich war er auch naturblond, doch ich kannte ihn nur mit dem roten Irokesen. Trotzdem, irgendwie war er anders als sonst. Bei der Hitze trug er keine Lederjacke, dafür ein T-Shirt und eine Jeans. Das war’s! Die Jeans war nagelneu, das T-Shirt schlicht schwarz ohne Aufdruck, sauber und anscheinend ebenfalls neu.
„Willst du auch Karriere machen in Frankfurt?“
Wombel wusste genau, dass ich auf seine Kleidung anspielte.
Er wand sich. „Muss meinem Sohn ein Vorbild sein.“
Fast hätte ich laut gelacht. Wombels Sohn Anton war gerade mal ein paar Monate alt. Dem waren Wombels Klamotten total egal. Außerdem wurde er von einem Lesbenpaar aufgezogen, das Wombel ohne sein Wissen als Samenspender missbraucht hatte. Eine der Lesben hatte ihn verführt, als er im Vollrausch gewesen war. Wombel hatte von ihrer Schwangerschaft als Letzter erfahren. Und jetzt ging er in der Vaterrolle auf?
„Wer ist das eigentlich?“ Er nickte Richtung Silvia. Ohne Zweifel wollte er das Thema wechseln.
„Meine Schwester“, quetschte ich hervor.
„Mein Name ist Silvia“, sagte Silvia und streckte Wombel die Hand hin.
„Äh, Wombel“, sagte er und schlug herzhaft ein.
Durch Zufall hatte ich einmal erfahren, dass er eigentlich Sven hieß, aber inzwischen erinnerte er sich wohl nicht mal selbst an diesen Namen.
Wombel blickte zwischen Silvia und mir hin und her. „Hätte ich merken sollen, ihr seht euch ähnlich.“
Das traf mich. Wo, bitte, sah ich meiner Schwester ähnlich? Gut, wir waren beide klein und von zierlicher Statur, aber sonst … Silvia hatte sich mit Make-up zugespachtelt, ihre Haare blondiert und anscheinend auf ihre Figur geachtet. Ich hingegen hatte ausgebleichtes Kurzhaar, schminkte mich nicht und setzte einen kleinen Rettungsring über der Hüfte an. Kam wohl vom vielen Bier. Wombel hatte eindeutig einen Knick in der Optik.
„Du hast einen Job gefunden in Frankfurt? Wo denn?“ Ich wollte wissen, für wen er sich so in Schale geworfen hatte.
„Ich mache eine Ausbildung bei einem Fotografen. Der findet meine Bilder gut“, sagte Wombel mit stolzgeschwellter Brust.
„Welche Bilder denn?“
„Ach, ich hab da so ’ne Serie über Punks gemacht.“
„Zeig doch mal!“
War meine Schwester neugierig oder wollte sie sich nur von ihren Problemen ablenken? Im Zweifel tat sie alles, um freundlich zu erscheinen. Das war mir schon immer auf den Nerv gegangen. Nie wusste ich, ob sie jemanden gut fand oder ob sie ihn insgeheim verabscheute und nur nett sein wollte. Das hatte sie von meiner Mutter. Stets liebenswürdig zu den Gästen und nach der Party über sie herziehen. Ein Verhalten, das ich nicht ausstehen konnte.
Wombel fühlte sich offensichtlich geschmeichelt. Er griff in seinen Seesack. Eine Mappe mit steifem Umschlag kam zum Vorschein. Wombel schlug sie auf und zog Ausdrucke von Fotos aus einem Innenfach. Er fächerte sie auf dem Tisch auf.
Silvia und ich beugten uns darüber. Es waren Schwarz-Weiß-Bilder. Porträts. Punkerinnen mit Bierflasche, Punker mit Kippe im Mundwinkel, Punker beim Zähneputzen und beim Essen. Die Gesichter wirkten traurig, einsam, hoffnungslos, nur wenige sahen heiter oder zufrieden aus. Ich kannte keinen von ihnen, die Fotos ließen mich jedoch die Gefühle dieser Menschen spüren.
„Wow“, entfuhr es mir.
Auch Silvia war beeindruckt. „Die hast alle du gemacht?“
„Ja, seit ein paar Jahren hab ich immer eine Kamera dabei. Sind ja jetzt winzig, die Teile.“ Er klopfte auf seinen Seesack.
Mehr als einen Schlafsack und eine Zahnbürste hätte ich nie darin vermutet, aber offensichtlich barg das alte Bundeswehrteil Überraschungen.
„Die sind sehr persönlich“, sagte Silvia. „Echt prima.“
„Ein Kumpel hat einige meiner Bilder ins Internet gestellt. Der Fotograf hat sie gesehen und kommentiert. Da habe ich ihn gefragt, ob ich nicht bei ihm in die Lehre gehen kann.“ Wombel guckte unsicher. So ganz geheuer schien ihm der Plan noch nicht zu sein. „Dann musste ich ihm die anderen Bilder auch noch zeigen, und er hat zugesagt.“ Er richtete sich auf. „Ja, und ich muss Anton doch ein Vorbild sein. Der will keinen Vater, der nur auf der Straße rumhängt.“
„Ich dachte, du hättest geerbt“, platzte ich heraus.
Vor Kurzem war Wombels Vater verstorben, ein steinreicher Hamburger Reeder, der ihm einiges hinterlassen hatte. Meines Wissens nach konnte Wombel so viel rumhängen, wie er wollte, und vom Eingemachten leben.
„Ach das! Das hab ich der Hafenstraße vermacht und dem Verein der Regenbogenfamilien. Was soll ich mit der Kohle!“
Gespendet, soso. Wombel hatte rumgejammert, dass er das Erbe nicht wolle. Das hatte ich nicht ernst genommen, nun hatte er das Geld tatsächlich weggegeben. Dabei hätte er es sich mit dem Erbe sicher eine ganze Zeit lang gut gehen lassen können.
Silvia blickte skeptisch. „Du hättest das Vermögen verwalten und die Zinsen spenden können, dann hätte es sich immer weiter vermehrt.“
„Ach nee, viel zu viel Arbeit!“ Wombel winkte ab. „Dann muss ich mich mit Heerscharen von Steuerberatern und Bankern abgeben.“ Er sprach das Wort „Banker“ wie „Gangster“ aus.
Ich räusperte mich. „Silvia ist Bankerin. Sie hat gerade eine Stelle bei der Deutschen Bank bekommen. Deshalb bleibt sie ein paar Tage hier, bis sie eine Wohnung gefunden hat.“
„Deshalb kannst du nicht bleiben, Wombel“, mischte sich Silvia ein. „Es ist kein Platz.“ Sie deutete auf das Monstrum von Aufblasmatratze.
„Was geht dich das denn an!“ Wie konnte Silvia entscheiden, wer in meiner Wohnung schlief und wer nicht? Schon als kleines Mädchen hatte sie immer bestimmen wollen, was in unserem Kinderzimmer wo stand. Dabei war sie drei Jahre jünger als ich und spielte sich immer wie die ältere Schwester auf. „Natürlich bleibt Wombel hier!“
„Wo denn? Es ist kein Platz“, wiederholte sie.
„Na, wir teilen uns die Matratze.“
Silvia zog die Brauen hoch, sagte jedoch nichts mehr.
Wombel schien erleichtert. „Nur für den Anfang. ’ne bezahlbare Wohnung ist schwer zu finden in Frankfurt.“
„Das habe ich auch schon gemerkt“, meinte Silvia giftig.
Würden sich die beiden die ganze Zeit streiten? Ich holte drei Bier aus dem Kühlschrank und stellte jedem eins hin.
Wombel zog ein Feuerzeug aus der Tasche und hebelte die Kronkorken ab. Silvia rührte ihr Bier nicht an. Sie saß wie ein Häufchen Elend in der Ecke und guckte so unglücklich, dass es selbst Wombel auffiel.
„Mein Tag war stressig, aber deiner war offensichtlich totale Scheiße. War es so schlimm bei der Bank?“ Er klang richtig mitfühlend.
„Ihr Chef ist tot. Die Bullen waren in der Bank“, informierte ich ihn, da Silvia nicht reagierte. Sie nippte an dem Bier und starrte vor sich hin.
„Das war dein Chef? Ich habe was davon im Radio gehört.“ Er äffte die Stimme der Moderatorin nach. „Ein Banker wurde erschlagen in der Taunusanlage neben der Euro-Skulptur gefunden.“
Erschlagen, soso. Meine Theorie, dass er einem Herzinfarkt erlegen war, stimmte also nicht. Ein Mord war geschehen. An einem seltsamen Ort.
„Am Euro-Zeichen?“ Ich hatte angenommen, der Banker wäre in der Bank gestorben.
Wombel nahm einen großen Schluck Bier. „Bestimmt ein Symbol. Es ist nicht der Banker gemeint, sondern der Kapitalismus. Da am Kunstwerk war doch das Occupy-Camp, erinnerst du dich?“
Natürlich wusste ich, was er meinte. Vor einiger Zeit hatten sich Demonstranten mit Zelten und Bretterbuden in dem Park an der Taunusanlage niedergelassen, um gegen das internationale Finanzsystem zu protestieren. Genau verstanden hatte ich es nicht, aber es war gegen Ausbeutung und gegen Großbanken gegangen. Das Euro-Zeichen hingegen feierte Frankfurt als Sitz der Eurozentralbank. Es bestand aus übermannsgroßen Neonröhren in leuchtenden Farben. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeikam, posierten japanische Touristen davor und knipsten sich mit albernen Selfiesticks, die sie vor sich hinhielten.
„Er war so zuvorkommend und höflich. Wieso passiert das ausgerechnet mir? Gerade einen Tag bin ich da, und schon ist der Chef tot.“ Silvia schluckte heftig.
Dafür, dass sie ihn erst einen Tag kannte, ging ihr der Tod des Mannes anscheinend ziemlich nah. Meine Schwester war eben viel gefühlsbetonter als ich, rief ich mir in Erinnerung.
Sie trank einen winzigen Schluck Bier. „Wir haben uns gewundert, dass er nicht erscheint. Die Sekretärin wusste auch nichts. Er hatte sich nicht krankgemeldet oder anderweitig entschuldigt.“
Logo, er wusste ja nicht, dass er sterben würde.
„Stattdessen tauchte irgendwann die Polizei auf“, erzählte Silvia weiter. „Die haben Kartons voller Akten weggeschleppt. Wie sollen wir jetzt unsere Arbeit machen? Dann haben zwei Beamte jeden aus der Abteilung befragt.“
„Das ist normal. Die müssen jetzt rauskriegen, was passiert ist“, wiegelte ich ab. „Wie hießen die denn?“ Ob Mattu dabei gewesen war? Ob er Silvia wiedererkannt hatte?
„Der eine hieß Wenigmann. Der andere hatte einen Doppelnamen, irgendwas mit Schneider, glaube ich. Ist doch egal, die haben mich richtiggehend verhört. Als wäre ich eine Verbrecherin.“ Sie trank hektisch von dem Bier und stellte die Flasche ruckartig ab, dass sie überschäumte.
„Du hast nichts zu befürchten, bleib mal cool“, sagte ich.
„Ich habe kein Alibi!“ Sie sah uns hilflos an.
„Wieso?“, fragten Wombel und ich wie aus einem Mund.
„Der ist gestern Abend umgekommen, da war ich auf Wohnungssuche. Aber weil die Wohnungen alle so schrecklich waren, habe ich mit niemandem gesprochen. Ich habe auf dem Absatz kehrtgemacht, als ich die Häuser gesehen habe. Keiner kann bezeugen, wo ich war.“ Silvia traten Tränen in die Augen.
Chillen am Main
„Da muss Freya ran“, sagten Wombel und ich gleichzeitig. Wir mussten lachen.
Silvia reagierte nicht. Vielleicht wäre es gut, sie mit Freya bekannt zu machen, um ihr Zuversicht einzuflößen. Sie konnte nicht tagelang wie eine Trauerglucke bei mir herumhocken. Freya würde ihr sagen, wie sie am besten mit der Situation umging.
Es war unerträglich stickig in meiner Bude, obwohl es schon später Nachmittag war.
„Merals Imbiss“, schlug ich vor. Wombel nickte. „Das ist das Richtige bei der Hitze.“
Ich rief Freya an, und wenig später trafen wir uns am Niederräder Mainufer. Meral hatte es irgendwie geschafft, die Bürokratie zu besiegen. Er hatte durchgesetzt, ein Dönerschiff am Mainufer vor Anker gehen zu lassen. Weder ein Döner- noch sonst ein Imbissschiff hatte es vorher gegeben. Dafür existierte vermutlich keine Kategorie beim Ordnungsamt. Meral hatte viel Unterstützung mobilisiert und schließlich eine Erlaubnis erkämpft. Allein wegen seines Siegs über die Behörden lohnte es sich, bei ihm zu essen. Außerdem gehörte sein Döner zu den besten der Stadt.
Das wussten nicht nur wir. Am Ufer vor dem Boot hatte sich eine Schlange gebildet, in die wir uns einreihten. Meral bediente aus dem Kajütenfenster heraus. Es ging schnell, bald waren wir an der Reihe. Wir setzten uns auf einen Fleck verdorrten Rasen und stopften die Döner in uns rein. Wombel spielte Musik ab. Punk aus den frühen Jahren, Sex Pistols, The Clash und so. Freya hatte ein Sixpack Bier mitgebracht.
Ich stellte sie meiner Schwester vor.
Freyas Kommentar: „Ihr seht euch ziemlich ähnlich.“
Sie auch noch! Ich sah keine Ähnlichkeit zwischen einer aufgetakelten Karrierebankerin und mir. Aber der leckere Döner, das Bier und die Hitze hielten mich davon ab, Streit anzufangen.
Silvia wollte wissen, wie Freya und ich uns kennengelernt hatten. Bevor ich etwas sagen konnte, erzählte Freya von der Demo in Hannover, als die Bullen uns mit Wasserwerfern in die Enge getrieben hatten. Sie war triefnass gewesen und voller blauer Flecke von den Attacken des Wasserstrahls, dazu geschockt von der Gewalt, die sie gesehen hatte. Die Bullen hatten ohne Erbarmen losgeknüppelt. Eine Frau hatte sich den Unterarm gebrochen, als sie einen Schlagstock hatte abwehren wollen. Andere Demonstranten bluteten aus Platzwunden am Kopf. Ich hatte auch einiges abgekriegt, war jedoch geistesgegenwärtig genug gewesen, mit Freya in einen Hauseingang zu flüchten. Freya schilderte die Geschichte, als hätte ich ihr das Leben gerettet. Dabei war sie es gewesen, die sich einige Jahre später als Einzige um mich gekümmert hatte, als ich wohnungslos und schwer krank gewesen war.
Silvia hörte Freya gespannt zu. Für sie klang die Erzählung sicher wie ein Abenteuerroman. Mir stockte noch heute der Atem, wenn ich an den Wasserwerfer dachte, der frontal auf uns zugerollt war.
Wombel bemerkte mein Unbehagen und beendete die Geschichte mit den Worten: „Das ist ja nun lange her.“
Wir genossen den leichten Luftzug, der über den Main ans Ufer wehte. Neben uns hockte ein Mann in Hemd und Krawatte mit einem Laptop auf den Knien. Die Anzugjacke lag neben ihm. Er hatte Kopfhörer in den Ohren, die Finger glitten unablässig über die Tastatur. Punk hörte er bestimmt nicht. Am gesamten Ufer saßen Grüppchen von Leuten. Einige klampften auf ihren Gitarren, andere ließen Konservenmusik laufen. Die meisten hatten Decken und Picknickkörbe dabei, manche Einweggrills. Der Geruch von Döner und Holzkohle lag über allem. Unter den Rauch gemischt, meinte ich Marihuanawolken wahrzunehmen. Ich schnupperte, blickte mich um und sah einige junge Türken, die eine Wasserpfeife aufgebaut hatten. Der süßliche Geruch stammte von der Wasserpfeife, nicht von Gras.
Wombel und ich nuckelten an unserem Bier, während Silvia Freya nach ihrem Beruf ausfragte.
„Das ist ja spannend“, sagte sie ein ums andere Mal.
Freya geriet in Fahrt und schilderte einige ihrer Fälle, in denen es um Gewalt gegen Frauen oder ungerechte Scheidungsvereinbarungen ging. Nach ihrer Zeit als Punkerin hatte Freya in aller Eile ein Jurastudium mit Bestnoten absolviert. Jetzt kämpfte sie nicht mehr mit Demos und Flugblättern, sondern mit Paragrafen für Gerechtigkeit. Ihre Eltern waren so erleichtert, dass sie die Punkerklamotten abgelegt und sich einem anständigen Beruf zugewandt hatte, dass sie ihr einen Stilaltbau im Westend geschenkt hatten.
Ich beobachtete Freya. Sie sah irgendwie anders aus als sonst. Ihre rote Mähne war frisch gewaschen. Sie hatte die widerspenstigen Haarsträhnen in einer kunstvollen Flechtfrisur gebändigt. Als Punkerin hatte sie Dreadlocks gehabt, aber das ziemte sich für eine Rechtsanwältin nicht. Statt des strengen Kostüms, das sie vor Gericht trug, hatte sie ein für ihre Verhältnisse ungewöhnlich tief ausgeschnittenes T-Shirt an. Es brachte ihr Dekolleté zur Geltung. Mir fiel auf, dass ihre Augen glänzten. Irgendwie wirkte sie wie runderneuert.
Schließlich konnte ich es nicht mehr ertragen, wie Silvia um das unangenehme Thema herumeierte.
„Ihr Chef wurde umgebracht, Freya.“ Ich deutete mit dem Daumen auf Silvia.
„Wer?“ Sie guckte verdattert.
„Der Chef von meiner Schwester. In der Bank.“ Mehr wusste ich auch nicht.
„Ich hab was im Gericht gehört. Dass ein Banker erschlagen aufgefunden worden ist. Das war dein Chef?“, fragte sie Silvia.
Die nickte.
„Wenn du Rechtsbeistand brauchst, kannst du dich gerne an mich wenden.“ Freya richtete sich auf, nahm Kampfpositur ein. „Hier, ich geb dir mal meine Visitenkarte, da sind die Kontaktdaten drauf.“ Sie fummelte ein Pappkärtchen aus der Tasche und drückte es meiner Schwester in die Hand. „Kannst mich jederzeit anrufen.“
Silvia las den Aufdruck, dann warf sie die Karte auf den Rasen. „Ich brauche keinen Anwalt.“ Sie sah mich auffordernd an. „Ich brauche einen Detektiv, und zwar dich.“
Koks
Das Geräusch von Silvias Föhn riss mich am nächsten Morgen aus dem Schlaf. Ihre Arbeit begann in aller Herrgottsfrühe. Schon um halb neun musste sie im Büro sitzen. Anscheinend mit stets frisch gewaschenem und geföhnten Haar. In eine Wolke aus Blümchenparfüm gehüllt, rauschte sie zur Tür hinaus.
Ganz gegen meine Gewohnheit hatte ich erst mal eine Nacht darüber geschlafen, bevor ich meiner Schwester eine Antwort geben wollte. Normalerweise entschied ich mich spontan, in diesem Fall war ich jedoch seltsam unentschlossen. Mein Instinkt riet mir zur Vorsicht.
Ich nickte noch einmal ein. Auch Wombel musste irgendwann aufgebrochen sein, denn als ich wieder aufwachte, war ich allein. Neuerdings war es offensichtlich hipp, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Nur ich erfreute mich meiner Freiheit, im Büro aufzukreuzen, wann ich Lust dazu hatte. Oder wann Meier oder irgendein anderer Auftraggeber mich quälte, damit ich schneller machte.
Mir fiel die Liste der Telekom-Mitarbeiter wieder ein. Sollte ich die nächsten Wochen mit Observationen von Leuten verbringen, die irgendeine Schwarzarbeit ausübten oder tatsächlich krank waren?