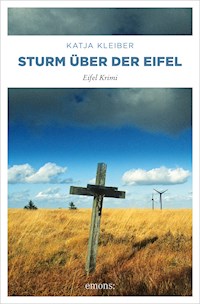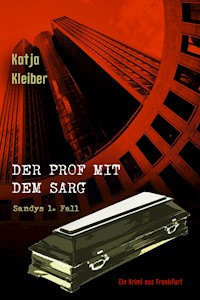Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leinpfad Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der angesehene Frankfurter Rechtsanwalt Hans Jochen Ebert wird in seiner schicken Westend-Kanzlei erstochen. Seine Tochter Verena beauftragt ausgerechnet die Ex-Punkerin und Privatdetektivin Sandy mit der Suche nach den Tätern. Denn für Verena steht felsenfest, dass Hausbesetzer ihren Vater auf dem Gewissen haben, schließlich hat er sie aus einer Wohnung rausgeklagt. Sandy ist daher genau die richtige Frau für diesen Einsatz. Sie ermittelt dort, wo die Polizei keinen Zugang hat: auf Punkkonzerten, beim Bier in Hinterhof-Kneipen oder als Undercover-Putzfrau. Doch muss erst ein zweiter Mensch sterben, bevor Sandy erkennt, worum es bei diesem Fall wirklich geht. Nämlich um illegale Adoptionen: Der Rechtsanwalt Hans Jochen Ebert arbeitete mit einem Gynäkologen zusammen, der seinen Patientinnen mit UKW (unerfülltem Kinderwunsch) Babys aus Afrika vermittelt. Das geht so lange gut, bis sich ein afrikanischer Vater nach Deutschland aufmacht, um seine kleine Tochter zurückzuholen. Der Krimi von Katja Kleiber zeigt die Bankenstadt Frankfurt von ihren unbekannten Seiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dicker als Blut
Katja Kleiber
Dicker als Blut
Ein Frankfurt-Krimi
Die Handlung und alle Personen sind völlig frei erfunden; Ähnlichkeiten wären rein zufällig.
© Leinpfad Verlag
Herbst 2013
Alle Rechte, auch diejenigen der Übersetzung, vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Leinpfad Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: kosa-design, Ingelheim
Layout: Leinpfad Verlag, Ingelheim
Lektorat: Angelika Schulz-Parthu
Druck: TZ Verlags & Print GmbH, Roßdorf
INHALT
Die Leiche in der Kanzlei
Hausbesetzer unter Verdacht
Volksküche
Flucht vor dem Amt
Kumpel mit Glatze
Total bekifft
Punkermucke
Unter Russen
Der Zuhälter
Schwarze Musik
Filmriss
Der Geist
Scharfes Huhn
Cash
Unter Golfern
Das Geheimnis des Arztes
Gefahr aus Afrika
Unter falscher Flagge
Tödlicher Irrtum
Väter und Söhne
Wombels Deal
Tod einer Katze
Kaltes Wasser
Abgesetzt
Muandros Vermächtnis
Danksagung
Die Autorin
Die Leiche in der Kanzlei
Seine Haut war schwarz wie die Nacht. Ich streichelte sie und wunderte mich, wie zart sie sich anfühlte. Zart wie Samt. Jerry hatte mich beim Bockenheimer Straßenfest angequatscht. Jetzt lag er halb auf, halb neben mir. Seine Zunge erforschte meinen Mund. Ich konzentrierte mich ganz auf ihn und seine festen, vollen Lippen. Es fühlte sich an wie der Auftakt zu einer richtig guten Nacht.
Ich spürte, wie geschickte Hände meinen Slip runterzogen. Ich versteckte mein Gesicht in Jerrys Haar und sog seinen Duft begierig ein. Gleichzeitig griff ich mit einer Hand unter das Kopfkissen und zuppelte herum, bis ich den Pariser gefunden hatte, der dort schon viel zu lange auf seinen Einsatz wartete. Als Jerry Anstalten machte, sich auf mich zu wälzen, schob ich ihm die kleine Packung in die Hand. „Nimm das“, flüsterte ich ihm zu.
Er schob meine Hand weg und versuchte, in mich einzudringen. „Hey, nimm erst mal das Kondom“, sagte ich.
„Och, nöö“, murmelte er und machte weiter.
Ich drängte ihn zur Seite. „Hey, spinnst du?“
„Macht doch keinen Spaß.” Wenn ich sein Genuschel richtig verstand, war es das, was Jerry sagte. „Stell dich doch nicht so an!“
Die ganze Stimmung war dahin. „Ich will hier keine Kids rumplärren haben.“
Ruckartig richtete sich der Mann auf. Er starrte mich an. „Du denkst doch nur, dass ich AIDS habe, stimmts?“ Alle Zärtlichkeit war aus seinen dunkelbraunen Augen verschwunden. „Alle Afrikaner haben AIDS, oder?“
Er stand auf, sprang in seine Jeans, zog den Reißverschluss mit einem Ruck zu und streifte sich das Hemd über den Kopf.
„Quatsch!“ Ich richtete mich auf. „Mach doch nicht so rum. Ist nur zur Vorsicht, ich will kein Kind!“
Er warf seine Jacke über und ging zur Tür. Ich schluckte heftig. Die Tür knallte zu.
„Hau doch ab, du blöder Nigger“, schrie ich hinter ihm her.
Ich blieb eine Weile liegen und starrte die Wand an. Es hatte so gut begonnen. Das Straßenfest auf der Leipziger Straße, gleich um die Ecke von meiner Wohnung, hatte alle Frankfurter rausgelockt: Die Türken aus ihren Kebab-Läden und Tee-Stuben, den eritreischen Schneider, den polnischen Delikatessenhändler, sogar die Autonomen waren aus ihrem sogenannten Kulturzentrum gekrochen. Es gab gute Mucke, live und umsonst, und überall was zu essen. Ich entschied mich für eine Bratwurst vom Grill, die angeblich thüringisch sein sollte, wahrscheinlich aber aus der Gefriertruhe eines heimischen Großmarkts stammte. Die Würste brutzelten verführerisch auf dem Grill und ich reihte mich in die Warteschlange ein.
Vor mir stand Jerry, der deutlich größer war als ich – was nicht so schwer ist. Sein Hintern füllte eine verblichene Jeans attraktiv aus. Dieser Anblick verkürzte mir die Wartezeit. Doch als der Afrikaner endlich seine Wurst in der Hand hielt und ich meine Bestellung loswerden wollte, hieß es: „Leute, leider alles alle. Wir müssen auf Nachschub warten.“ Jerry bemerkte meine Enttäuschung und bot mir die Hälfte seiner Bratwurst an.
Wir teilten brüderlich. Vom Bratwurststand waren wir zur Tanzfläche weitergezogen – hier erfüllte Jerry alle Klischees über Afrikaner perfekt. Ich kann zwar eigentlich nur Pogo tanzen, wackelte aber heftig mit dem Hintern, sodass es ungefähr zur Latino-Musik passte. Es hatte mich dann nur wenig Verführungskünste gekostet, ihn in meine Wohnung abzuschleppen. Selbst die karge Ausstattung – Matratze auf dem Boden, Kochecke und ein geklauter Einkaufswagen als Kleiderschrank – hatte ihn nicht abgeschreckt.
Verdammt! Das erste interessante männliche Wesen seit Wochen – vom Quickie mit dem Kellner bei meinem Türkei-Urlaub mal abgesehen – und ich musste ihn gleich verscheuchen. Vielleicht würde sich die Auswahl an Männern vergrößern, wenn ich mehr in mein Aussehen investierte? Mausfarbene, von zu häufigem Färben ausgebleichte Haare, massenhaft Löcher in den Ohren von den Piercings früher und dann noch abgeranzte Klamotten – nicht gerade das, was Männer anmacht. Ich hatte echt eine Chance verpasst.
Außerdem, Afrikaner hatten einen guten Ruf im Bett. Fast hätte ich das persönlich überprüfen können, aber nein ... wieso musste ich ihn beleidigen? Mit etwas mehr Diplomatie hätte ich ihn vielleicht doch noch rumgekriegt, das Gummi zu benutzen. Aber natürlich musste ich wieder das Erstbeste sagen, was mir durch den Kopf ging. Mist. Ich griff mir ein Bier aus dem Kühlschrank und ließ die ersten Schlucke meine Kehle runterlaufen.
Ich war auf dem besten Weg, mir einen fetten Rausch anzutrinken, Filmriss inklusive, als das Telefon klingelte. Ob Jerry seinen Abgang bereute? Ich hatte ihm am Anfang des Abends meine Visitenkarte zugeschoben und die Telefonnummer meiner Wohnung draufgekritzelt. „Privatdetektivin“ – die aufgedruckte Berufsbezeichnung hatte ihm echt imponiert. War vielleicht eine gute Taktik, um Typen aufzureißen. Klang jedenfalls interessanter als Versicherungsfach-angestellte oder so. Ich starrte das Telefon an. Sollte ich Jerry noch eine Chance geben? Das Klingeln nervte.
„Ja?“ Seit ich jahrelang in einem besetzten Haus gewohnt hatte, meldete ich mich nicht mehr mit Namen. Konspiratives Verhalten verlernt man nicht so schnell.
„Sandy, kannst du mal herkommen?“
Freya stellte sich auch nicht vor, aber ihre Stimme erkannte ich sofort. Sie klang seltsam gehetzt.
„Was ist los? Wo bist du?“
„Sandy, wir brauchen dich. Du musst sofort kommen.“
Ihr Gestammel klang gar nicht nach den wohlüberlegten Worten einer gestandenen Rechtsanwältin.
„Wo steckst du denn?“
„Erinnerst du dich an den Italiener, wo wir meinen Geburtstag gefeiert haben? Komm da hin.“
Sie legte ohne ein weiteres Wort auf. Ich gurgelte das restliche Bier aus der Flasche runter und zerrte meine Klamotten über. Ich steckte mein Handy ein und etwas Geld. Dann schwang ich mich auf mein Rad und strampelte zu dem Nobelitaliener im Westend, wo Freya ihren 33. Geburtstag begossen hatte.
Es hatte zu nieseln begonnen und als ich ankam, waren meine Haare nass. Die Lederjacke hielt einiges ab, aber die Jeans waren an den Oberschenkeln durchnässt. Ich fröstelte Um diese Zeit war La Marietto natürlich geschlossen. Schon von weitem sah ich die Tische und Stühle auf der Terrasse zu Türmen zusammengestellt. Sie waren mit Ketten verankert, als fürchtete der Besitzer, sie könnten weglaufen.
Im trüben Licht der Straßenlaterne leuchtete Freyas rote Haarmähne auf. Auch meine Freundin war durchnässt. Sie trat von einem Fuß auf den anderen und schwenkte die Arme, um sich zu wärmen. Ich bremste, stieg ab und schloss das Rad an einen Laternenpfahl an. Kaum hatte ich mich aufgerichtet, fiel Freya mir um den Hals und drückte mich heftig. Ich roch kalten Rauch. Sie hatte wohl schon ein ganzes Päckchen gequalmt. Ich hielt sie von mir ab. „Freya, was ist denn los? Wieso holst du mich mitten in der Nacht hierher?“
„Er ist tot.“ Sie sprach so leise, dass ich sie kaum verstand.
„Wer ist tot?“
„Verenas Vater.“ Sie zog mich hinter ihr her. Wir gingen um die Ecke. Einige Häuser weiter trat sie in den Eingang einer Villa und drückte eine Klingel. Summend sprang die Haustür auf. Ein mit Marmor ausgelegter Flur empfing uns. Freya ging einige Stufen hoch und klopfte an eine Tür, neben der ein großes Schild verkündete, dass sich hier die Kanzlei von Rechtsanwalt Hans-Jochen Ebert befand.
Die Tür war nur angelehnt. Freya schob sie auf und wir kamen in eine Kanzlei, in der Möbel aus Glas und Edelstahl zeigten, wie überaus erfolgreich der Anwalt war.
Freya ging vor in eine kleine Küche, die von einer riesigen Espressomaschine beherrscht wurde. Neben dem chromblitzenden Monster hockte ein verheultes Mädchen mit langen braunen Haaren und schluchzte vor sich hin.
Unbeholfen blieb ich im Türrahmen stehen.
Die Küche war voller Zigarettenrauch. Freya griff nach dem Päckchen auf dem Tisch, fummelte umständlich eine raus und steckte sie sich an.
Dann stellte sie Becher unter die Espressomaschine und drückte einige Tasten. Sie schob mir einen Stuhl hin, wartete, bis ich saß und drückte mir einen dampfenden Cappuccino in die Hand. Den anderen gab sie dem Mädchen. Als es schniefend aufblickte, erkannte ich, dass sie älter war, als ich gedacht hatte – vielleicht Mitte, Ende 20. Durch die langen, glatten Haare und ihre zierliche Figur wirkte sie mädchenhaft. Ihr Gesicht war rot, die Augen geschwollen.
„Das ist Verena, Verena Ebert“, sagte Freya und strich der jungen Frau leicht über die Schulter. „Wir kennen uns vom Studium und sie unterstützt mich bei der Kampagne gegen häusliche Gewalt.“
Die Kampagne war Freyas neuestes Lieblingsbaby. Es genügte ihr nicht, Frauen vor Gericht gegen gewalttätige Ehemänner zu verteidigen, nein, jetzt wollte sie auch noch eine bundesweite Kampagne anstoßen. Seit Wochen sprach sie von nichts anderem.
Freya merkte, dass ich innerlich aufstöhnte. Sie sprach schnell weiter. „Na, und wir hofften, wir könnten Verenas Vater auch für die Kampagne gewinnen. Das wäre ein echter Coup.“ Freya warf ihren leuchtend roten Haarschopf kämpferisch nach hinten. Dann sackte sie zusammen: „Aber jetzt ist er tot!“
„Die Hausbesetzer waren es!“, presste die junge Frau auf dem Küchenstuhl hervor und fing dann haltlos an zu heulen.
Ich blickte Freya verblüfft an, aber sie achtete nicht auf mich.
Sie nahm Verena sanft ein vollgeheultes Taschentuch ab und drückte ihr ein frisches in die Hand. Sie streichelte ihr über den Rücken, bis das Schluchzen langsam nachließ.
Dann zog Freya mich aus der Küche. „Er wurde ermordet“, flüsterte sie. „Kannst dus dir ansehen?“ Ohne meine Antwort abzuwarten, schob sie mich über den Flur in ein großes Büro.
Dann sah ich den Mann: Er schien ganz normal an seinem Schreibtisch zu sitzen. Doch der Kopf hing auf die Brust herunter und auf dem Schreibtisch hatte sich eine riesige rote Lache ausgebreitet.
Mein Magen hob sich, als ich das ganze Blut sah und vor allem roch. Ich drehte mich um und wollte rausrennen. Freya hielt mich an der Schulter fest. „Willst du ihn dir nicht in Ruhe angucken?“
„Wieso ruft ihr nicht die Polizei?“, zischte ich. Ich war zwar Privatdetektivin, aber eigentlich überprüfte ich meist nur die Lebensläufe von Managern, die sich auf neue Posten bewarben, oder fahndete nach Vätern, die ihren Unterhalt schuldig geblieben waren. Übrigens häufig im Auftrag von Freya von Buckow, die mir gerade eine Leiche präsentierte.
Freya murmelte etwas Unverständliches.
„Wir müssen die Bullen holen. Das hier ist ’ne Nummer zu groß.“ Ich bemühte mich, den Toten nicht anzuschauen und rang die Übelkeit nieder, die sich in meinem Magen breitmachte.
„Ich konnte einfach nicht alleine bleiben.“ Freya sah mich flehend an. „Verena ist total neben der Spur. Lass mich nicht alleine.“
„Ich will nichts damit zu tun haben.“ Schon der Gedanke an die Leiche und die Polizei und die ganzen Komplikationen, die sich ergeben könnten, erschreckte mich.
„Guck dich wenigstens um, ob dir was auffällt“, drängte Freya. „wenn die Polizei erst hier ist, darfst du nicht mehr ran.“
Ich starrte sie wortlos an.
„Schließlich bist du Detektivin.“
Das war ein Argument. Es konnte nicht schaden, wenn ich mich umschaute. Widerstrebend wandte ich mich der Leiche zu. Dann fiel mir ein, dass es besser wäre, keine Spuren zu hinterlassen. Ich ging in die Küche und kramte nach einer Plastiktüte.
Verena wiegte ihren Körper rhythmisch vor und zurück und schien mich nicht zu bemerken.
Ich ging zurück ins Büro und schaute mich gründlich um. Ein riesiger Schreibtisch aus Glas beherrschte den Raum. Er war leer, bis auf einen eleganten Laptop und die Blutlache. An der Wand hinter dem Schreibtisch stand ein raumhohes Regal voller dicker Bücher. Manche kamen mir bekannt vor. Auch Freya hatte solche Wälzer in rotem Plastikeinband in ihrer Kanzlei stehen. Es waren Gesetzestexte, das wusste ich. Diese Juristen studierten jahrelang und mussten nachher doch wieder alles in dicken Büchern nachschlagen. Zwischen den Büchern standen grob geschnitzte Holzfiguren, die ich für afrikanisches Kunsthandwerk hielt.
Der Raum hatte große Fenster, die auf eine Art Balkon führten, obwohl die Kanzlei im Erdgeschoss lag. Vor den Fenstern stand eine gigantische Sofagarnitur aus braunem Leder. Eines der Fenster war weit geöffnet. Ich beugte mich hinaus. Vor dem Haus begrenzte ein schmiedeeiserner Zaun einen schmalen Garten, nicht breiter als ein Meter. Dann holte ich tief Luft, drehte mich um und ging näher an den Schreibtisch.
Obwohl mir wieder der Ekel in der Kehle hochstieg, sah ich mir den toten Körper dieses Mal gründlich an. Der Mann trug einen Anzug, ein weißes Hemd und eine graublaue Krawatte. Auf seiner Nase saß eine unauffällige Brille. Sein silbergraues Haar war exakt geschnitten. Ich schätzte ihn auf Anfang 50. Kein Alter für den Tod. Schon gar nicht für einen solchen: Am Hals des Mannes klaffte ein riesiger Schnitt, aus dem noch immer Blut sickerte.
Freya hatte mich die ganze Zeit beobachtet. Jetzt wandte sie sich ab. „Ich kümmer mich um Verena“, murmelte sie und verließ den Raum.
Ich ging um den Schreibtisch herum und trat hinter den Toten. Der Geruch des Bluts stieg mir unangenehm in die Nase. Ich versuchte, den Atem anzuhalten, mich zu konzentrieren und prägte mir jede Einzelheit des Toten ein.
Mir wurde klar, wieso er so akkurat da saß. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er war an den Schreibtischstuhl gefesselt, die Hände hinter seinem Rücken zusammengefasst. Der ganze Körper war mit einem starken Plastikseil mehrmals umwunden und am Stuhl festgezurrt. Das Seil leuchtete in bunten Farben. Es wirkte sehr robust, jedenfalls war es keine Paketkordel oder so. Damit kam auch Selbstmord nicht in Frage.
Da fiel mir auf, dass irgendwas mit der Kleidung des Toten nicht stimmte. Ich zog die Plastiktüte, die ich aus der Küche mitgebracht hatte, über meine Hand und packte den Schreibtischstuhl. Ich zog ihn mit seiner Last ein wenig vom Tisch ab. Der Stuhl kippelte und ich musste alle Kraft aufwenden, damit er nicht mitsamt der Leiche umkippte. Schließlich hatte ich den Stuhl stabilisiert und trat einen Schritt zurück.
Ich schrie laut auf. Die Anzughose des Mannes war bis auf die Kniekehlen heruntergezogen. Der Mann saß praktisch in Unterhose festgezurrt auf seinem Stuhl. In einer weißen Baumwoll-Feinrippunterhose.
Ich wandte mich ab, trat wieder ans offene Fenster und holte ein paarmal tief Luft. Draußen war eigentlich nichts zu sehen, außer der nächtlichen Straße. Doch vor meinen Augen sah ich das Bild des Toten. Ohne Hose.
Um mich abzulenken, betrachtete ich eingehend den Fensterrahmen. Es war ein alter Holzrahmen, jedoch gut gepflegt. Ich fuhr mit dem Finger darüber. Der weiße Lack fühlte sich glatt an. Er hatte keine Beschädigungen. Das Fenster war jedenfalls nicht aufgebrochen worden.
Als ich mich einigermaßen wieder gefangen hatte, wandte ich mich um. Ich konzentrierte mich auf die Details des Zimmers. Der Laptop auf dem Schreibtisch war aufgeklappt. Als ich auf die Tastatur drückte, erwachte er zum Leben, zeigte auf dem Monitor aber nur die Programmsymbole. Keines der Programme war aktiv.
Eine lederne, schon etwas abgenutzte, Aktentasche stand gegen ein Schreibtischbein gelehnt. Ich blickte kurz hinein. Neben dem aktuellen Spiegel-Magazin fand ich eine Golf-Zeitschrift und ein Programm der Frankfurter Oper. In einer Seitentasche steckte die Börse des Anwalts. „Nicht schlecht“, murmelte ich, während ich die Fächer durchging. Sie enthielten 655 Euro in Scheinen, verschiedene Kreditkarten in Gold-Ausgabe und einiges Kleingeld. Ich ließ alles unverändert, obwohl es mir in den Fingern juckte, einen Fuffi rauszunehmen – brauchte er ja jetzt nicht mehr.
Dann fiel mir etwas Graues, Zerknülltes neben der Tasche auf. Ich stupste es vorsichtig an. Es war ein nasser Socken. Wieso nur einer? Wieso war das Ding nass? Seltsam.
Ich holte tief Luft und wandte mich noch einmal der Leiche zu, benutzte wieder die Tüte als Handschuh und durchsuchte seine Taschen, fand aber nichts außer einer Taxiquittung von voriger Woche in der hinteren Hosentasche. 37 Euro hatte die Fahrt gekostet. In der Tasche der Anzugjacke steckten einige Visitenkarten des Anwalts. Eine davon stopfte ich in meine hintere Hosentasche.
Als die Jacke wieder zurückglitt, fiel mir etwas Seltsames an den nackten Beinen des Toten auf. Ich versuchte, genauer hinzublicken, ohne der Leiche näher zu kommen. An der Innenseite der Oberschenkel waren rote Flecken zu sehen. Sie zogen sich in einer Reihe von der Mitte des Oberschenkels bis kurz vor die Feinripphose, und zwar an beiden Beinen.
Ich ging in die Küche und holte Freya. Ich wies auf die kleinen, kreisrunden Flecken.
Freya starrte eine Weile hin und fuhr plötzlich angewidert zurück. Sie presste die Lippen zusammen und wandte sich ab.
Ich zog sie ans offene Fenster. „Was ist das?“
„Brandblasen.“ Sie schluckte. Sie sog die frische Nachtluft tief ein. „Von einer Zigarette, würde ich sagen.“ Sie machte eine Pause.
Ich wusste, dass wir beide den gleichen unangenehmen Gedanken hatten.
„Hab so was mal bei einer Klientin gesehen“, sagte Freya. „Die kam mit ihrem Leben nicht klar und hat sich selbst die Handgelenke mit Zigaretten verbrannt. War die einzige Möglichkeit, wie sie ihren Körper spürte.“
„Der Anwalt hat sich aber nicht selbst verbrannt“, stellte ich fest. Schließlich war er gefesselt.
Freya nickte. Sie legte eine Hand auf meine Schulter. „Sandy, bitte, erzähl Verena nichts davon, sie ist sowieso schon total fertig.“
Wir hielten es in dem Raum mit der Leiche nicht mehr aus und gingen in die Küche. Dort, ohne den Anblick des Toten, funktionierte mein Hirn deutlich besser. „Freya, du rufst die Polizei an und erzählst alles. Außerdem hol einen Notarzt.“ Ich nickte mit dem Kopf in Richtung Verena.
„Meinst du? So schlimm?“
„Eine Beruhigungspille würde ihr guttun. Wenigstens für die ersten Stunden.“
„Okay, ich rufe Pit an.“
Pit war einer von Freyas Freunden aus der blaublütigen Fraktion. Freya von Buckow und Pit von Bredenbeck hatten schon als Kind im Sandkasten zusammen gespielt. Jetzt führte Pit eine Hausarztpraxis im Nordend. Er würde sich freuen, selbst wenn Freya ihn mitten in der Nacht anrief. Ich glaube, er würde ganz gerne mal eine ganze Nacht mit ihr verbringen, aber Freya hatte das noch nicht begriffen.
„Und dann rufst du die Polizei an!“
„Mach du das doch, bitte!“
„Freya, ich bin nie hier gewesen.“
„Aber als Detektivin ist das doch deine Aufgabe. Die Polizei wird dich viel ernster nehmen als mich.“
Ich dachte nach. Die Polizei kannte mich nicht. Jedenfalls nicht als Detektivin, höchstens als Punkerin mit einer dicken Akte. „Wenn die Polizei weiß, dass ich hier war, glaubt sie, dass ich ermittele und macht jede Menge Schwierigkeiten.“
Freya schien noch nicht ganz überzeugt.
„Wie willst du erklären, dass du als brave Bürgerin nicht sofort die Polizei gerufen hast? Sondern mich?“
Sie nickte ergeben.
Ich griff meine Sachen, schaute noch mal zu Verena, die immer noch in der Küche auf ihrem Stuhl hin- und herschaukelte, und verließ die Kanzlei.
Draußen wandte ich mich noch einmal zurück und blickte zu den Fenstern des Büros hoch. Von hier war nur der schwache Lichtschein aus der Küche zu sehen. Aber an der Fassade der Villa fiel mir etwas auf. Ich ging näher heran. Ein Graffiti zog sich neben dem Bürofenster lang: „KAPITAISTENKNEC“ stand dort, gesprüht mit roter Farbe. Ich musste grinsen.
Wahrscheinlich sollte es „Kapitalistenknecht“ heißen, aber der Sprüher war gestört worden und hatte mitten im Wort aufgehört. Außerdem hatte er in seiner Hast das „L“ von „Kapitalisten“ vergessen.
Ich studierte die Schrift genauer. Das „N“ von „Knecht“ war von einem Kreis umgeben und lief oben in eine Pfeilspitze aus. Dieses Zeichen kannte ich. Das Zeichen der Hausbesetzer.
Ich bildete mir ein, es roch nach frischer Farbe. Ich streckte meinen Arm aus und berührte das Graffito. Ein Fleck nasser Farbe blieb auf meinem Zeigefinger zurück.
Hausbesetzer unter Verdacht
„Hier! Guck dir das an!“ Freya knallte die BILD-Zeitung auf den kleinen, runden Tisch im Wartezimmer ihrer Kanzlei. Dann riss sie die Zeitung wieder hoch, blätterte hektisch zu den Frankfurt-Seiten und hielt sie mir unter die Nase.
„Mord an Anwalt!“ stand dort in riesengroßen Lettern. Etwas kleiner darunter: „War es ein Hausbesetzer?“ Daneben war ein Foto abgedruckt, das unscharf und dunkel einen Jugendlichen zeigte, dessen Gesicht von einem Palästinensertuch verhüllt war.
„Kevin H. wurde kurz vor der Tat im Westend gesehen. Er hatte allen Grund zur Abrechnung: Rechtsanwalt Ebert hatte ihn und andere Chaoten aus dem besetzten Haus in der Offenbacher Landstraße geklagt. Der Eigentümer kann nun endlich mit dem Bau des dort geplanten Hotels beginnen.“ Und dann fett: „Hat Kevin H. mit dem Anwalt abgerechnet?“
„Ist das nicht unverschämt?“ Freyas Stimme war vor Aufregung ganz hoch. Wir hatten uns verabredet, um die Geschehnisse von gestern zu besprechen. Am Samstag war die Kanzlei für Klienten geschlossen, sodass wir ungestört waren.
„Was hatte denn der Anwalt mit Hausbesetzern zu tun?“, wollte ich wissen.
„Steht doch hier: Er hat Hauseigentümer vertreten und die Hausis verklagt.“ Unwillkürlich verfiel Freya in den Slang unserer Punkerjahre. „Die letzte Räumung hier in Frankfurt hat er veranlasst.“
„Na, das wäre doch ein Motiv. Kann sein, die Hausbesetzer haben ihn aus Rache fertiggemacht.“
„Aber die bringen doch niemand um!“, rief Freya entrüstet.
Stimmte das? Ich selbst hatte jahrelang in einem besetzten Haus in Hamburg gelebt. Nie hatten wir Anwälte oder sonst wen umgebracht. Im Gegenteil. Fast hätten die Hausbesitzer mich umgebracht. Die Eigentümer, zwei Brüder, beides vermögende Zahnärzte, ließen das Haus räumen. Danach wusste ich nicht wohin und schlief auf einer Parkbank im Planten un Blomen. Beinahe wäre ich an einer Lungenentzündung verreckt. Irgendein Streetworker, der eigentlich auf der Suche nach Junkies war, hatte mich entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Freya war die Einzige gewesen, die mich besucht und gepflegt hatte, als ich wochenlang im Krankenhaus lag. Gleichzeitig zog sie ihr Jurastudium im Eiltempo durch und schloss auch noch mit einem Spitzenexamen ab. Ihre Eltern waren froh, dass sie die Punkerszene verlassen hatte. Sie überließen ihr den Altbau im Frankfurter Westend als Schenkung zu Lebzeiten, wie Freya mir erklärt hatte. Was so viel hieß wie, das Haus gehörte ihr. Umgehend machte sie dort ihre Kanzlei auf. Als das Krankenhaus mich entließ und ich nicht wusste, wohin, lud sie mich ein, nach Frankfurt zu kommen. „Das Haus ist eh viel zu groß“, hatte sie gesagt. Also richtete ich meine Detektei im Dachgeschoss ein. Seither sind wir Kolleginnen – wenn man das so sagen darf. Ein gut funktionierendes Gespann, bestehend aus einer erfolgreichen Anwältin und eine Privatdetektivin, die sich gerade eben so über Wasser hielt.
Freya hantierte an der chromblitzenden Kaffeemaschine herum, an der sich normalerweise ihre Klientinnen bedienten. Sie klopfte einen Filter aus und füllte neues Kaffeepulver ein, drückte es mit dem Zeigefinger zurecht.
„Hausbesetzer, die einen Anwalt umbringen? Anwälte haben normalerweise Gegner, die mit Rechtsmitteln streiten, nicht mit Waffen,“ meinte Freya schließlich. „Aber Verena glaubt auch, dass Hausbesetzer die Täter sind.“
„Warum?“
Freya zuckte mit den Schultern. „Ist halt ’ne einfache Erklärung. Ihr Vater hatte ja tatsächlich die Besetzer rausgeklagt damals.“
„Kennst du den?“ Ich tippte auf das Foto in der BILD-Zeitung.
Freya nahm das Blatt hoch und musterte den Mann. „Nee. Aber selbst wenn es mein Bruder wäre, würde ich den auf diesem Bild nicht erkennen.“ Sie warf die Zeitung wieder auf den Tisch.
Ich blätterte weiter. Der Artikel auf der Innenseite war genauso reißerisch aufgemacht wie der auf der Titelseite. Er zeigte ein Foto des Anwalts, das wohl einige Jahre alt war, denn er hatte auf dem Bild dunklere Haare, nicht das reine Silberweiß, das ich gesehen hatte. Ansonsten sah er durchschnittlich aus, wie ein Geschäftsmann eben. Ich legte die Zeitung wieder auf den Tisch.
„Woher die das wohl wissen? Ich meine, wie kommen die auf den Typen, diesen Kevin?“
Die Kaffeemaschine röhrte und fauchte. Freya griff nach den Tassen und reichte mir einen duftenden Milchkaffee. „Journalisten von Boulevardblättern hören regelmäßig den Polizeifunk ab,“ meinte sie. „Das ist zwar verboten, aber technisch sehr einfach. Deshalb sind die auch die Ersten bei großen Unfällen, Bränden, Geiselnahmen usw.“
Ich runzelte die Stirn.
„Oder die haben Informanten. Und natürlich ein Archiv. Trotzdem, auf die Idee, dass Hausbesetzer Verenas Vater auf dem Gewissen haben, kann nur so’n Boulevardblatt kommen.“
„Freya, hast du den Spruch an der Fassade gesehen? Von wegen ‚Kapitalistenknecht’ und so? Das galt sicher dem Anwalt.“
Sie nickte. „Na, und? Solche Graffitis sind doch überall in der Stadt.“
„Aber dieses war frisch.“
„Echt?“
„Ja, gestern Abend war die Farbe noch feucht.“
„Puh“, Freya nippte vornehm an ihrem Kaffee. Schließlich meinte sie: „Na, so was kriegen die gerade noch hin, aber einen Mord? Das sind Chaoten, wissen wir doch.“ Sie nahm noch einen winzigen Schluck.
Ich ließ mich nicht beirren. „Freya, es könnte doch so gewesen sein: Die Hausbesetzer haben die Wand besprüht, der Anwalt hat sie dabei überrascht, es kam zum Streit und sie haben ihn abgeschlachtet.“ Konnte man ja wohl so sagen. Dem Anwalt war die Kehle durchgeschnitten worden.
„Und die Brandflecken an den Oberschenkeln?“ Freya runzelte eine ihrer Augenbrauen. Als echte Rothaarige hatte sie elegante, feine Augenbrauen, soweit ich weiß, ohne je zu zupfen. Jedenfalls hatte sie schon als Punkerin diese fein geschwungenen Augenbrauen gehabt, als sie noch Dreadlocks trug und ganz sicher keine Kosmetikerin besuchte.
„Okay, einem Hausbesetzer rutscht sein Messer aus, er mordet im Affekt einen Anwalt. Aber würde er ihn vorher auf seinen Bürostuhl fesseln und mit brennenden Zigaretten traktieren?“
Ich zuckte die Schultern. Das war mir auch ein Rätsel. „Was haben eigentlich die Bullen gestern gesagt?“
„Nichts Besonderes. Die haben das volle Programm abgezogen, Tatort absperren, Spurensicherung usw.“ Freya grinste auf einmal. „Da war ein Kommissar, Mattuschinski oder so, der war sogar voll nett. Er hat sich um Verena gekümmert und versucht, sie zu beruhigen.“
Nun zog ich die Augenbrauen hoch. Ein Polizist, der sich kümmert? Ich hatte die Bullen bisher anders erlebt.
„Und wie gehts Verena?“, fragte ich.
„Sie ist ziemlich mitgenommen.“ Freya zögerte. Dann seufzte sie: „Verena hat sich auf die Idee fixiert, dass es Hausbesetzer waren. Dass die kurzen Prozess mit ihrem Vater gemacht haben. Und deshalb“, sie holte tief Luft, „deshalb sollst du den Fall übernehmen. Sie denkt, dass du bei den Hausbesetzern mehr herausfindest als die Polizei. Kannst du nachher mal zu ihr gehen? Sie will sonst niemanden sehen, aber du sollst dich melden, hat sie gesagt.“
Ich schluckte. Wollten mich die beiden Rechtsanwältinnen in irgendwas reinziehen? Sofort verwarf ich den Gedanken wieder. Freya hatte einen neuen Schützling gefunden, nämlich Verena, und wollte ihr mit allen Mitteln helfen. Aber wollte ich das auch?
„Schätze, das ist ’ne Nummer zu groß für mich“, wehrte ich ab.
„Verena braucht deine Hilfe.“ Freya ließ nicht locker. Wenn sie einmal ein Opfer für ihr Helfersyndrom gefunden hatte, gab sie nicht auf. Sie blickte mich bittend an.
Verena hatte gestern einen verzweifelten Eindruck gemacht. Vielleicht konnte ich sie ja von der Idee abbringen, dass es die Hausbesetzer waren. Ich hatte mit denen zwar nichts mehr zu tun, aber irgendwie ärgerte mich, dass ihnen ein Mord angehängt wurde.
„Doppelt hält besser“, setzte Freya wieder an. „Für die Polizei ist das nur ein Fall unter vielen. Wenn du dich dranhängst, wird die Sache schneller aufgeklärt.“
Freya würde mir keine Ruhe lassen, bis ich den Fall übernahm. Aber noch etwas anderes würde mir keine Ruhe lassen: Das Bild des gequälten, gefesselten Anwalts, der erbärmlich in seinem noblen Büro verreckt war.
„Okay, ich machs“, knurrte ich.
Freya gab mir Verenas Adresse. Der Straßenname war im Stadtplan nicht verzeichnet, aber sie meinte, die Wohnung sei in einem neu gebauten Viertel im ehemaligen Osthafen. Wir tranken unseren Kaffee aus, ohne den Mord noch mal zu erwähnen.
Als das Koffein meine Lebensgeister geweckt hatte, schwang ich mich auf mein Rad. Keine schöne Aufgabe, die trauernde Verena zu befragen. Hoffentlich war sie heute nicht mehr so fertig wie gestern. Vielleicht würde etwas Süßes Verena helfen. An einem Kiosk kaufte ich eine Tafel Schokolade.
Die neuen Häuser am Osthafen waren leicht zu finden. Block um Block drängten sie sich am Ufer des Mains, acht Etagen hoch. Die Wohnungen hatten Balkons in unterschiedlichen pastelligen Farben. Ich fand schnell die richtige Hausnummer und klingelte. Sofort wurde mir geöffnet. Verena wohnte ganz oben im achten Stock. Ich fuhr mit dem Aufzug hoch.
Sie stand in der geöffneten Tür und wartete auf mich. Ihre Augen waren noch rot, aber sie schien ruhiger zu sein als gestern. Sie trug schwarz, ein schlichtes T-Shirt und eine schwarze Stoffhose. Dadurch wirkte sie noch zierlicher.
Ich drückte ihr die Tafel Schokolade in die Hand.
„Genau die Sorte hat mir mein Vater früher immer mitgebracht“, sagte Verena. Ihre Stimme war tonlos und drückte keinerlei Gefühl aus. Sie klang wie ein Schüler, der ein Gedicht aufsagte.
Sie führte mich in ein Wohnzimmer, in dem eine Reihe ganz unterschiedlicher Sessel in wilden Popfarben standen. Sie waren zum großen Glasfenster ausgerichtet, hinter dem ganz unten der Main grau und träge dahinfloss. Ein Schlepper zog langsam den Strom abwärts. Ich stellte mir vor, wie Verena hier saß und den Schiffen auf dem Main zuschaute, und beneidete sie einen Moment lang.
Durch die große Fensterfront fiel eine Menge Licht in den Raum, obwohl der Himmel immer noch bedeckt war. An der Wand gegenüber von den Fenstern hingen riesige abstrakte Gemälde in Knallfarben. Verena sackte in eines der Sessel-Ungetüme und wies mit der Hand auf das daneben. Ich setzte mich.
Schweigen. Wie sollte ich ein Gespräch mit Verena anfangen? ‚Und was machst du so?’, wär jetzt wohl falsch.
„Du hattest ein enges Verhältnis zu deinem Vater?“
„Ging so.“
Verena starrte mich an, als hätte sie schon vergessen, wer ich bin und was ich hier wollte. Ihre Stimme klang belegt. Wahrscheinlich hatte Pit ihr eine ordentliche Menge Beruhigungsmittel verpasst.
„Soll ich Kaffee machen?“, fragte ich. Zwar hatte ich gerade einen getrunken, aber sie wirkte so weggetreten, dass etwas Koffein nicht schaden konnte.
„Warum nicht“, sagte sie, ohne die Stimme zu heben. „Da.“ Sie wies auf eine Tür im Hintergrund.
Ich hievte mich hoch und ging in die angegebene Richtung. Die Küche stellte sich als eine Art Laboratorium heraus, jedenfalls war sie voller Geräte aus Edelstahl, wie eine Hotelküche oder so. Ich fand die Kaffeemaschine nur, weil es das gleiche Modell war wie die in Freyas Büro. Bald hatte ich zwei Kaffee zubereitet.
Ich kehrte in den Salon zurück und drückte Verena eine Tasse in die Hand. Also wieder von vorne.
„Hast du deinen Vater oft gesehen?“
„Oft, was heißt oft.“ Sie verstummte wieder.
„Habt ihr telefoniert? An Geburtstagen oder so?“
„Also, das war so.“ Verena wurde etwas lebendiger. „Früher hatten wir kein gutes Verhältnis, ich war traurig, weil er uns alleingelassen hatte und er meldete sich nur an meinem Geburtstag und zu Weihnachten. Aber dann ...“, Verena holte tief Luft, „ ...als ich älter war, in den letzten Jahren, haben wir uns oft gesehen, einmal die Woche oder so.“
„Er hat euch alleingelassen? Was meinst du damit?“
„Als ich 14 war, haben sich meine Eltern getrennt.“
Ich versuchte zu schätzen, wie alt Verena war, und nachzurechnen. Sie erriet meine Gedanken.
„Jetzt bin ich 29, also vor 15 Jahren.“
„Und deine Mutter? Weiß sie schon, dass dein Vater nicht mehr lebt?“
„Ich habe sie heute Morgen angerufen. Sie lebt auf Teneriffa, jedenfalls solange es hier noch nicht Sommer ist. Es ist ihr egal, glaube ich.“ Verena seufzte. „Sie hat meinen Vater gehasst.“ Verächtlich setzte sie hinzu: „Wahrscheinlich wartet sie jetzt nur darauf, ob sie vielleicht doch was erbt, als Verflossene.“
Es hatte keinen Sinn, wenn sich Verena in alte Familienerinnerungen verstrickte. Ich holte sie wieder in die Gegenwart: „Wenn du deinen Vater getroffen hast, was habt ihr dann gemacht?“
„Wir hatten unsere Donnerstage. Donnerstagabends sind wir immer zusammen essen gegangen oder so.“
Verena hielt den Kaffee auf dem Schoß und wärmte ihre Finger an der Tasse, aber sie trank nicht.
„Worüber habt ihr an diesen Donnerstagen gesprochen?“
„Alles Mögliche, natürlich viel über meine Pläne, was ich machen möchte, dann über Mutter, wie sie zurechtkommt, das wollte er schon wissen.“
„Hat er über seine Arbeit geredet?“
„Eigentlich nicht, er hat mehr über seine Hobbys gesprochen, über Opern, über das Golfen und so.“
„Hat er nie von seinen Fällen erzählt?“
„Nicht so oft. Klar, manchmal hat er erzählt, dass er einen neuen Klienten hat, wenn der was Besonderes war zum Beispiel. Oder wenn er ein schwieriges Verfahren gewonnen hat.“
„Was waren denn das für Klienten und Verfahren?“
„Er hatte sich auf Immobilienfragen spezialisiert. Also Streit mit Mietern oder wenn die Bauherrn was nicht richtig ausgeführt haben oder so ...“
Verena drehte die Tasse mit dem heißen Kaffee in der Hand.
Ich nahm selbst einen Schluck, um sie zu ermuntern, auch was zu trinken, aber sie starrte aus dem Fenster auf den Main und beachtete mich nicht.
„Hatte er Feinde?“ Das klang wie in einem Fernsehkrimi. „Also, ich meine, hatte er Streit mit einem Kunden? Oder gibt es Leute, die ihn hassten, weil sie gegen ihn verloren haben?“ Erwartungsvoll schaute ich Verena an.
„Nein, das kommt nicht infrage. Seine Klienten waren sehr distinguiert.“
Ich war mir nicht ganz sicher, was sie meinte. Verena spürte meine Unsicherheit und bekräftigte: „Auf jeden Fall haben seine Klienten nichts damit zu tun. Ich glaube, es waren diese Hausbesetzer. Denen ist alles zuzutrauen.“
„Was denn für Hausbesetzer?“, fragte ich vorsichtig.
„Na, die er rausgeklagt hat. Die hatten eine Villa im Westend besetzt, die der Sparkasse gehörte. Die Sparkasse hat sich jahrelang nicht drum gekümmert, aber dann wollten sie dort eine Stiftung unterbringen und die Villa renovieren lassen. Mein Vater hat den Räumungsbescheid erwirkt.“
„Ich dachte, es sei um ein Hotel in Oberrad gegangen?“
„Wieso?
„Hab ich in der BILD gelesen.“
„Ach, lies doch nicht so was!“ Verena machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Und du meinst, die Besetzer der Villa hätten ihn ermordet?“
„Die bringen alles fertig. Das sind Anarchisten und so.“
„Hm.“ Ich enthüllte ihr jetzt besser nicht meine Vergangenheit.
„Bei Demonstrationen schmeißen die Steine.“
Das konnte ich nicht leugnen.
„Und verbrennen Autos.“ Verena schauderte.
Auch da hatte sie recht. Obwohl: Zwischen Autos abfackeln und Anwälte abschlachten bestand ein Unterschied. „Du scheinst keine gute Meinung von Hausbesetzern zu haben“, meinte ich vorsichtig.
Sie macht einen undefinierbaren Laut und rümpfte die Nase. Ich betrachtete sie schweigend.
Verena beugte sich vor. „Ich habe eine Frau verteidigt, die in einem besetzten Haus wohnte.“ Sie machte eine Pause. „Und dort vergewaltigt wurde.“
Dazu konnte ich nichts sagen. Die Sitten waren rau in der Szene und mehr als einmal hatte ich mich nachdrücklich gegen Gegrabsche gewehrt. Mancher Mann nahm das „Nein“ einer Frau nicht ernst. Verena als feministische Anwältin hatte sich offenbar ein sehr einseitiges Bild von Hausbesetzern gemacht.
„Hast du einen konkreten Hinweis auf die Hausbesetzer als Täter?“, fragte ich.
„Das ist dein Job. Ich beauftrage dich. Du bist doch Detektivin, oder?“
Ich nickte.
Verena schien wacher. Der Kaffee konnte nicht schuld sein, denn die Tasse stand unbeachtet auf einem Beistelltischchen.
Verena richtete sich im Sessel auf. „Wie viel bekommst du?“
Wenn Verena sich diese Wohnung mit Blick auf den Main leisten konnte, war sie wohl nicht ganz arm. Und mit dem zu erwartenden Erbe des Staranwalts in Aussicht ...
Ich multiplizierte meinen normalen Tagessatz und nannte ihr die Summe.
Verena zog eine Augenbraue hoch.
Ich fürchtete, ich hätte übertrieben.
Doch dann nickte sie. „Ich überweise ein Drittel als Vorschuss.“
Meine Miete für die nächsten Monate war gesichert. „Gut, aber ich habe noch ein paar Fragen.“
„Ja.“ Sie wirkte jetzt erschöpft. Mir fiel auf, dass sie tiefe Schatten unter den Augen hatte.
„Ihr wolltet gestern zu deinem Vater, um ihn als Unterstützer für Freyas Kampagne zu gewinnen?“
„Ja, gegen häusliche Gewalt. Er hätte bestimmt unterschrieben, wenn ich ihn drum bitte ... also, wenn ich ihn gebeten hätte ... gebeten haben könnte.“ Sie brach ab und stöhnte.
„Sicher. Er hätte sicher unterschrieben. Was mich interessiert: War es normal, dass dein Vater abends noch im Büro war?“
„Ja, er arbeitete oft bis spät in die Nacht.“
„Ich glaube, er kannte den Täter. Wem könnte er geöffnet haben?“