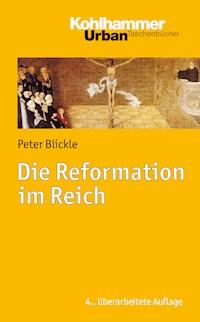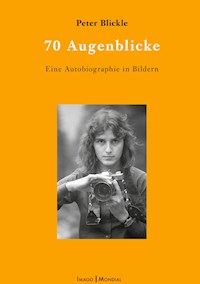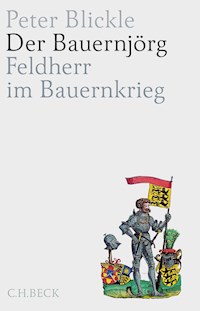7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Hunderttausend tote Bauern – die Zahl lief um im Reich und war allgemein die grobe Aufsummierung dessen, was man gerüchteweise von den Schlachten des Bauernkriegs gehört hatte. „Das vergossene Blut des Jahres 1525“, schrieb ein Schweizer Beobachter, sei ausreichend, „alle Tyrannen zu ertränken“. Waren die Forderungen und Aktionen des Gemeinen Mannes so revolutionär, daß Fürsten und Adel sie wie Hochverrat und Landfriedensbruch behandeln mußten? Peter Blickle erklärt im vorliegenden Band, wie die Aufständischen einen Diskurs über Freiheit und Gerechtigkeit auslösten, der im Erfolgsfall zur Ausweitung kommunaler Rechte der Dörfer und Städte geführt und damit das Reich stark republikanisiert hätte. Daß der Bauernkrieg zur Revolution werden konnte, ist nicht zuletzt den Reformatoren geschuldet, mehr Huldrich Zwingli als Martin Luther. Schon deswegen, aber auch wegen seiner großen Ausdehnung in der Schweiz und Österreich, ist er nicht nur ein deutscher. Auch war er keineswegs folgenlos. Der Autor hebt heraus, daß die nach der militärischen Niederwerfung geschlossenen Verträge den Untertanen für ihre Person und ihren Besitz Rechte mit verfassungsmäßigen Garantien einräumten, die modernen Menschen- und Bürgerrechten nahekommen. Er zeigt weiter, wie die gescheiterte Revolution von 1525 seit 200 Jahren für Nationalismus, Sozialismus und Liberalismus nutzbar gemacht wurde und auch auf diese Weise geschichtlich weitergewirkt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Peter Blickle
DER BAUERNKRIEG
Die Revolutiondes Gemeinen Mannes
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Hunderttausend tote Bauern – die Zahl lief um im Reich und war allgemein die grobe Aufsummierung dessen, was man gerüchteweise von den Schlachten des Bauernkriegs gehört hatte. „Das vergossene Blut des Jahres 1525“, schrieb ein Schweizer Beobachter, sei ausreichend, „alle Tyrannen zu ertränken“. Waren die Forderungen und Aktionen des Gemeinen Mannes so revolutionär, daß Fürsten und Adel sie wie Hochverrat und Landfriedensbruch behandeln mußten? Peter Blickle erklärt im vorliegenden Band, wie die Aufständischen einen Diskurs über Freiheit und Gerechtigkeit auslösten, der im Erfolgsfall zur Ausweitung kommunaler Rechte der Dörfer und Städte geführt und damit das Reich stark republikanisiert hätte. Daß der Bauernkrieg zur Revolution werden konnte, ist nicht zuletzt den Reformatoren geschuldet, mehr Huldrich Zwingli als Martin Luther. Schon deswegen, aber auch wegen seiner großen Ausdehnung in der Schweiz und Österreich, ist er nicht nur ein deutscher. Auch war er keineswegs folgenlos. Der Autor hebt heraus, daß die nach der militärischen Niederwerfung geschlossenen Verträge den Untertanen für ihre Person und ihren Besitz Rechte mit verfassungsmäßigen Garantien einräumten, die modernen Menschen- und Bürgerrechten nahekommen. Er zeigt weiter, wie die gescheiterte Revolution von 1525 seit 200 Jahren für Nationalismus, Sozialismus und Liberalismus nutzbar gemacht wurde und auch auf diese Weise geschichtlich weitergewirkt hat.
Über den Autor
Peter Blickle ist Professor em. für Neuere Geschichte an der Universität Bern. Er ist ein international renommierter Fachmann auf dem Gebiet der Erforschung von Bauernkrieg und Reformation. Im Verlag C.H.Beck sind von demselben Autor lieferbar: Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten (22006), Das Alte Europa (2008) und Der Bauernjörg (2015).
Inhalt
Einleitung – Standortfragen
1. Tyrannei und Aufruhr – das erschrockene Reich
2. Der Gemeine Mann und der deutsche Bauernkrieg – gesellschaftlicher Ort und nationaler Raum
3. Wir wöllen frei sein – ein Diskurs um die Natur des Menschen zu Beginn der Moderne
4. Kein Recht, unrecht, gerecht – wer hat die Definitionshoheit über Recht und Gesetz?
5. Der Gewalt der Gemeinde – kommunalistische Praxis und republikanische Theorie
6. Frankfurt oder Frankenhausen – eine oder zwei revolutionäre Traditionen der Deutschen?
Zeittafel
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Register
Einleitung – Standortfragen
Seitdem sich die Gegenwart mit der Vergangenheit in einem großen Kontinuum sieht, gehört der Bauernkrieg von 1525 in Deutschland zu den Ereignissen von nationalem Rang. Dafür hatte einer der Begründer der kritischen Geschichtswissenschaft und gleichzeitig auch einer ihrer bedeutendsten Repräsentanten gesorgt, Leopold Ranke. Heute indessen spielt 1525 in der internationalen Geschichtswissenschaft eine erheblich größere Rolle als in der nationalen, und die begriffliche Abbildung als Bauernkrieg ist längst nicht mehr konkurrenzlos.
Ranke hat dem Bauernkrieg im Rahmen seiner Reformationsgeschichte von 1839 den Stellenwert zugeschrieben, den er für mehr als 100 Jahre haben sollte und – angesichts des Ansehens, das Ranke in der akademischen Welt genoß – haben durfte. Von ihm stammt die Metapher vom „größten Naturereignis des deutschen Staates“. Zwar wurde der Aufstand durch die wachsende „Bedrückung des Bauernstandes“ und die „Verfolgung der evangelischen Lehre“ ausgelöst. Beides hätte sich beheben lassen, doch „die siegreiche Menge wird niemals verstehen, innezuhalten“. Allein Zerstörungswut konnte Ranke wahrnehmen, die sich mit dem „Fanatismus“ des revolutionären Theologen Thomas Müntzer paarte. „Glücklicherweise“ ist der Bauernkrieg gescheitert. Ranke hat den Bauernkrieg als ein negatives Ereignis ausgezeichnet, das zwar zur Nationalgeschichte gehörte, sich aber positiv in einer sinnstiftenden Weise für die Gegenwart nicht integrieren ließ. Die Bewegung unterlag dem Gesetz der Irrationalität und der Wut der „Menge“, wie er sagte.
Von seinen begrifflichen Kategorien kam als erste die irrationale Menge in Bedrängnis. Das war zunächst der Arbeiterbewegung geschuldet und der damit verbundenen Neudefinition der Menge als Volk und Klasse durch Karl Marx und Friedrich Engels. Seitdem gab es eine theoretische Diskussion über die geschichtliche Bedeutung der Menge, die im 19. und 20. Jahrhundert zu den Beschäftigungen der Intellektuellen weltweit gehörte. Wo hätte sich ein besserer historischer Prüfstein angeboten als im Bauernkrieg? Friedrich Engels hat ihn 1850 für den internationalen Marxismus als ein würdiges Belegstück für den Klassenkampf ausgezeichnet, die Akademie der Wissenschaften der UdSSR wie so oft die erste empirische Kärrnerarbeit geleistet (Moisej Mendeljewitsch Smirin). Die Menge Empirie, die man an einem Schreibtisch in Rußland zur Verfügung hatte, war freilich klein.
Wenig Theorie und viel Empirie hingegen enthielt ein Buch, das im Klima einer durchaus positiven Bewertung des Volkes in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren entstanden und 1933 publiziert worden war, „Der deutsche Bauernkrieg“ von Günther Franz. Sein methodischer Zugriff, über die Beschwerden der Bauern das Ereignis zu entschlüsseln, entzerrte Reformation und Bauernkrieg. Jetzt wurde er eine politische Bewegung, aber dennoch nicht kontinuitäts- und identitätsstiftend. Mit dem Urteil, der Bauer sei nach dem Bauernkrieg aus dem politischen Leben der Nation ausgeschieden, wurde eine von Rankes Positionen, nämlich die Unerheblichkeit der Menge für den Fortgang der deutschen Geschichte, nochmals befestigt.
Als frühes Beispiel einer dichten Beschreibung in Form einer Erzählung ist das Franzsche Buch an Abstraktionen und Generalisierungen wenig interessiert. Die Bauern wollten, unter Respektierung ihrer gemeindlichen Rechte, einen starken Kaiser, ansonsten sind die Ziele regional sehr verschieden. Die Thesen von Franz sind nicht scharf, sondern geschmeidig; entsprechend wandlungsfähig blieben sie. Ein faschistisches Machwerk wurde das Buch durch die Bauernkriegsforschung in der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik, die beharrlich darauf herumtrat, so als müßten die Straßenschlachten zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten aus der Weimarer Zeit nochmals, jetzt in der papierenen Form von Aufsätzen, geschlagen werden. Als die Profilierungsphase in der Deutschen Demokratischen Republik durchlaufen war, konnte selbst der Doyen der marxistischen Forschung, Max Steinmetz, für Günther Franz einen Beitrag zu dessen Festschrift schreiben.
Die Marxisten in Deutschland hatten sich nach 1960 zu Wort gemeldet. Sie borgten von Marx, Engels und Smirin die Theorie, die Empirie lag in den Archiven und war ansonsten als Literatur zu greifen, in Leipzig und Berlin (Ost) jedenfalls leichter als in Moskau. In wenigen Jahren stand, dank einiger geschickter intellektueller Operationen von Günter Vogler und Adolf Laube, das Konzept der Frühbürgerlichen Revolution. Begrifflich waren damit Reformation und Bauernkrieg, die im Westen getrennt voneinander lebten, unter einem Dach geborgen.
An der Mauer standen sich nicht nur zwei Militärsysteme gegenüber, sondern auch zwei Weltdeutungssysteme. 1525 verdankt viel dem Umstand, daß der Kalte Krieg in Deutschland seine topographische Mitte hatte. Es konnte gar nicht ausbleiben, daß die richtige Weltdeutung gerade hier sich an der Reformation bewähren mußte, wo doch die Deutschen, jedenfalls die herrschenden Eliten, ihr Weltbild aus ihrer protestantischen Überzeugung oder einer protestantischen Sozialisation zogen. Da die Reformation jedoch nicht den Deutschen als Eigentum gehört, sondern dank ihrer weiten Ausbreitung in Form lutherischer, calvinischer und presbyterianischer Landeskirchen und Gemeinden Europa, wenn nicht der Welt, waren, pathetisch gesprochen, das christliche Abendland und der Kommunismus das Referenzsystem für die Interpretation von 1525.
Das christliche Abendland litt dennoch unter einer fortschreitenden Entkonfessionalisierung im 20. Jahrhundert mit einer entsprechenden Relativierung von theologischen Sicherheiten. Sie setzte, beginnend schon im frühen 20. Jahrhundert und steil aufsteigend zwischen 1960 und 1990, eine schier unglaubliche Müntzer-Forschung frei, die naheliegenderweise zu einer positiveren Bewertung seiner Person führte, damit aber auch der des Bauernkriegs. Raffiniert waren die intellektuellen Operationen der Täuferforschung, zumindest im Hinblick auf die erzielte Wirkung, die in den bislang pazifistischen, weltabgewandten Täufern und ihren urchristlichen Überzeugungen die Bauern des Bauernkriegs und deren Programme wiedererkannte. Angesichts der Internationalität der Täuferbewegung und der Täuferforschung rückte auch auf diese Weise der Bauernkrieg fast in den Rang eines weltgeschichtlichen Ereignisses.
Das materialistisch-malthusianische Hoch, das den einprägsamen Namen Annales trug und jahrzehntelang über Europa lag, unterstützte gewissermaßen klimatisch die Erforschung des Bauernkriegs. Bauern genossen jetzt als Produzenten der materiellen Basis der Kultur eine höhere Aufmerksamkeit; gesellschaftliche Konflikte, fügte die deutsche Sozialgeschichte hinzu, sind die treibenden Kräfte geschichtlichen Wandels. So konnte der Bauernkrieg, der umgangssprachlich schon längst Revolution hieß (ohne daß dieser Mantel theoretisch gut angemessen war), zu einem Brennpunkt geschichtstheoretischer und methodologischer Grundsatzdebatten werden.
Erst eine breite, aus den Archiven kommende empirische Forschung in Deutschland machte den Bauernkrieg zu einem internationalen Forschungsgegenstand. In Amerika und Kanada, China und Japan, England und Frankreich, Italien und Tschechien wurden und werden heute große Monographien zu 1525 geschrieben, die das Ereignis auf ganz andere und damit insgesamt umfassendere Weise durch die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe ihrer Autoren aufschließen als je zuvor. Auch gibt es heute keine umfassende moderne Geschichte der Revolutionen, in welcher der Bauernkrieg nicht seinen respektierten Platz hätte. Das verdankt er seiner seit nun fast vierzig Jahren gebräuchlichen Interpretation als Revolution des gemeines Mannes.
1. Tyrannei und Aufruhr – das erschrockene Reich
„Solche Uffrur“ wie jener von 1525 „ist mit Tyrrani gelegt und gestillet worden“, urteilte Johannes Stumpf, ein Pfarrer im Zürcher Oberland und ein Freund des Schweizer Reformators Huldrich Zwingli. „Dan Tyrrani und Uffrur gehören zusamen, es ist Deckel und Hafen“. Stumpf war ein Parteigänger der Reformation, aber er war auch Humanist, ausgebildet an den Universitäten Heidelberg und Freiburg. Als solcher lokalisierte er die Ereignisse, die im historischen Bewußtsein in einer unklaren Redeweise als Bauernkrieg fortleben, mit den staatstheoretischen Kategorien der griechischen Antike. Entartete Monarchie und verkommene Adelsherrschaft, Tyrannei eben, hatten zum Aufruhr geführt, und wiederum war der Aufruhr durch neue Tyrannei niedergeschlagen worden. Seine Bilanz, die er abschließend zog, fiel verheerend aus. Seit dem „Anfang der Christenheit“ sei „uff ein Jar nie sovil Christenblut vergoßen [worden] durch den Henker. Gott hatt die Armen gestraft. Der Tyrannen Urteil stat vor der Thür“. Vor seiner eigenen Tür hatte der erste Akt des Aufstandes stattgefunden, zwischen Basel und dem Bodensee, diesseits und jenseits des Rheins, auf deutscher und schweizerischer Seite. Es war ein Aufstand von der Dauer eines Jahres, wie Stumpf richtig beobachtete. Er begann in der Erntezeit des Sommers 1524 am Hochrhein und endete ein Jahr später nach den großen Schlachten in Württemberg, im Elsaß und in Thüringen – von einem eigentümlichen Epilog im Sommer 1526 im Salzburgischen abgesehen, wo die radikalen und elitären Revolutionäre in einem schieren Verzweiflungsakt nochmals versuchten, den Ereignissen eine entscheidende Wende zu geben.
Als hätte das Kirchenjahr den Bauern den Rhythmus für ihre Aktionen vorgegeben, läßt sich der Ereignisablauf in vier eindeutig unterscheidbare Sequenzen zerlegen. Eine erste vom Sommer bis Weihnachten 1524 reichend, regional noch beschränkt auf die dem Rhein nahen Landschaften Schwarzwald, Klettgau, Stühlingen, Thurgau und Hegau. Eine zweite, in der Fastnacht 1525 kulminierend und mit dem Ostersonntag jäh abbrechend, in der im angrenzenden Oberschwaben das Programm der Bewegung entwickelt wurde, dem sie unter theoretischen Gesichtspunkten die Bezeichnung Revolution verdankt. Eine dritte reichte von Ostern bis in die Mitte des Monats Mai, eingerahmt durch Akte der Gewalt, beginnend mit der Ermordung der adeligen Besatzung von Weinsberg durch die Bauern und endend mit den Schlachten im württembergischen Böblingen, im thüringischen Frankenhausen, im elsässischen Zabern, im fränkischen Königshofen, die ihren Namen nicht nur als kriegerische Auseinandersetzungen verdienen. Die gewalttätige Phase war auch jene der größten räumlichen Ausdehnung, der Südwesten des Reiches, das Elsaß eingeschlossen, war davon ebenso betroffen wie Thüringen und Franken, noble Fürstentümer wie Kurmainz, Kurpfalz und Württemberg waren handkehrum in Bauernhand, nicht nur Junkerland. In langen Wellen lief der Aufstand nach Süden in die Alpenländer, nach Salzburg, Tirol und Graubünden oder, um genauer zu sein, in die Erzstifte und Hochstifte Salzburg, Brixen, Trient und Chur. Aber auch dort fand die Unruhe bald ihr Ende, wegen des Rhythmus der Natur. Bauern revoltieren vor oder nach der Ernte.
Die gottliche, natürliche Billigkeit, Vernunft und Verstand – zwischen Schwarzwald und Bodensee
In Thayngen, auf dem halben Weg zwischen Schaffhausen und Singen, drängte die Gemeinde seit dem Juni 1524 darauf, ihren Pfarrer zu wählen. In Adam Bärtz fand sie einen Priester, der ihr wunschgemäß das reine Evangelium predigte. Das allerdings zeitigte für Beobachter das doch befremdliche Ergebnis, daß die Altäre und Bilder der Heiligen „mit grosser Verachtung uß der Kirchen getan, dieselbe zerschlagen und ettlich in Offen geschoben und verbrennt“ wurden und die Untertanen ihrer Grundherrschaft, dem Kloster Petershausen, „nit mer in ainichem Weg pflichtig noch gehorsam“, sondern frei sein wollten. Die Gewaltakte gegenüber den Altären und Bildern waren in Wahrheit rituelle Anschläge auf die Kirche, die Abgabenverweigerung kündigte an, daß man der Herrschaft manche Rechte bestreiten wollte. Aus einem Nachbarort schrieb ein verängstigter Priester aufgeregt der österreichischen Regierung im elsässischen Ensisheim zur gleichen Zeit, seine Schäflein „wellend den Adel erwurgen und die Pfaffen alle“. Rasch wurde von den Herren und Obrigkeiten der Schafe wahre wölfische Natur entdeckt, jedenfalls wurde dies rhetorisch so dargeboten.
Die Wahrheit freilich war komplizierter. Mehrere oberdeutsche Chronisten berichten übereinstimmend, so als wollten sie den Tenor von Johannes Stumpf kontrapunktisch ausgestalten, die Frau des Grafen von Lupfen habe die Bauern in der Landgrafschaft Stühlingen Schneckenhäuschen sammeln lassen, um darauf ihr Garn zu wickeln. Falls die Geschichte nur eine Metapher sein sollte, war sie bauernschlau erfunden. Die in ihr chiffrierte Wahrheit verbarg eine doppelte herrschaftliche Arroganz, denn erstens sammelten Bauern keine Schneckenhäuschen, zu keinen Zeiten, wie finster auch immer sie gewesen sein mochten, und zweitens leisteten sie außerordentliche Frondienste nicht zur Erntezeit, und es war Erntezeit, wie die Chronisten nicht vergaßen zu bemerken. Die Bauern reagierten mit Drohgebärden. Am 23. Juni wurde ein Fähnlein aufgeworfen, man spielte also den kriegerischen Haufen, und wählte demonstrativ einen erfahrenen Landsknecht, Hans Müller von Bulgenbach, zum Hauptmann. Er sollte noch von sich reden machen, im Herbst und dann wieder im nächsten Jahr. Mit seiner charismatischen Begabung hat er zweimal die Schwarzwälder Bauern hinter sich geschart, Freiburg im Breisgau zur Kapitulation gezwungen (und den Schwarzwaldurlauber und ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann beeindruckt).
Was sich in der Landgrafschaft Stühlingen in den vergangenen Generationen an Konflikten angestaut hatte, zeigt eine mächtige Klageschrift von 62 Artikeln, die später beim Reichskammergericht als dem höchsten Gericht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation eingereicht wurde – die Leibeigenschaft sei hart, die hohen Steuern seien unbillig, die Mißstände in der Rechtspflege unerträglich. Die Schrift schließt mit der Empfehlung der stolzen Bauern an die Reichskammerrichter, sie sollten in ihrem Urteil „erwegen die gottliche, naturliche Pillickeit, Vernunft und Verstand“. Die Realität sollte auf den Prüfstand des Rechts, und was Recht sei, sagten göttliche Rechtsordnung, natürliche Gerechtigkeit und vernünftige Verständigkeit.
Rechtsbewußtsein schließt Emotionen nicht aus. Sie führten zu einem Bündnis mit den Waldshutern, in deren Wirtshäusern man ohnehin gern einen Trunk nahm, angesichts der kurzen Wegstrecke von zwei, drei Stunden. Dort wirkte in der Stadtpfarrei Balthasar Hubmaier. Seinen Namen als Prediger hatte er sich in Regensburg gemacht, wo er der Schönen Madonna, einer steil aufgehenden Wallfahrt, Zehntausende von Pilgern zugeführt hatte. 1521 war er nach Waldshut gewechselt, hatte im intellektuellen Reizklima der oberdeutschen Humanisten eine kritische Distanz zur Kirche und eine enge Beziehung zu Zwingli gefunden. Dem Stadtherrn, Erzherzog Ferdinand von Österreich, galt er schon früh als Häretiker, doch die Gemeinde vereitelte jede Auslieferung an die Regierung oder den Konstanzer Bischof. „Ist derselbig Doctor Baltasar ain Anfänger und Aufwiegler gewest des ganzen bäurischen Kriegs“, meinte im nahen Kloster St. Blasien der dort amtierende Notar. Das Urteil hat sich nicht bestätigen lassen, wiewohl später der Bischof von Wien damit auch Hubmaiers Verbrennung begründete.