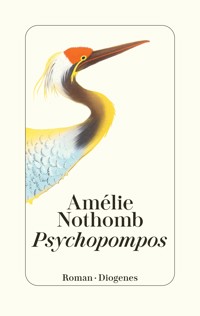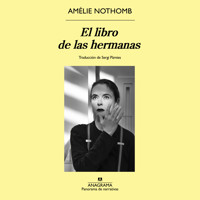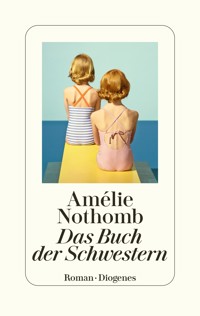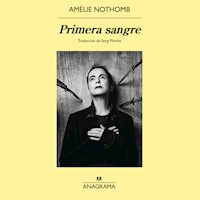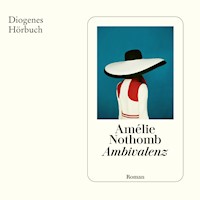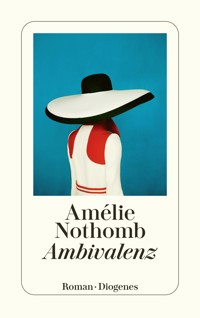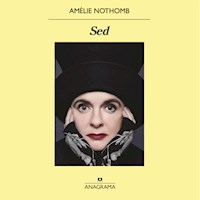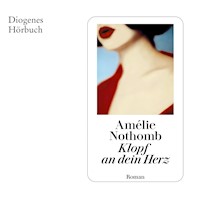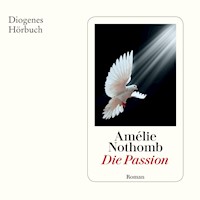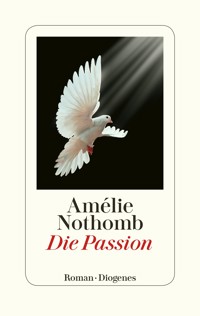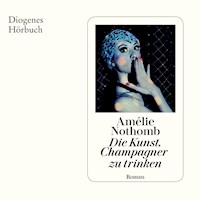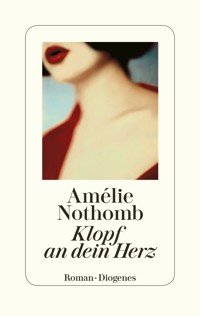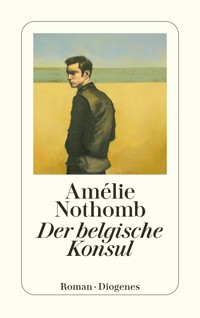
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sein erster Posten führt Patrick Nothomb in den jüngst unabhängig gewordenen Kongo. In Stanleyville soll er als Generalkonsul Belgien vertreten. Aber das Jahr 1964 hält anderes bereit, und so muss er, der kein Blut sehen kann, um das Leben Hunderter Geiseln verhandeln. Doch wer ist dieser junge Mann? Amélie Nothomb zeichnet das Bild seiner Kindheit zwischen belgischer Hautevolee und wilden Ardennen. Ein intimes Familienporträt, aber auch die Geschichte einer Welt im Wandel. Ausgezeichnet mit dem Prix Renaudot 2021 und dem Premio Strega Europeo 2022.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Amélie Nothomb
Der belgische Konsul
Roman
Aus dem Französischen von Brigitte Große
Diogenes
»Mein Vater ist ein großes Kind,
das ich als kleines Kind bekam.«
Sacha Guitry
Ich werde vor das Erschießungskommando geführt. Die Zeit dehnt sich, jede Sekunde dauert hundert Jahre länger als die davor. Ich bin achtundzwanzig Jahre alt.
Der Tod vor meinen Augen hat das Gesicht der zwölf Vollstrecker. Üblicherweise ist unter den ausgeteilten Waffen eine blind geladen. So kann jeder sich für unschuldig an dem zu verübenden Mord halten. Ich bezweifle, dass dieser Tradition heute Respekt gezollt wird. Keiner dieser Männer scheint den Wunsch nach möglicher Unschuld zu verspüren.
Als ich vor rund zwanzig Minuten hörte, wie jemand meinen Namen schrie, war mir sofort klar, was das bedeutete. Und ich schwöre, ich habe vor Erleichterung geseufzt. Wenn ich getötet werde, muss ich nicht mehr reden. Seit vier Monaten verhandle ich um unser Überleben, vier Monate endloser palabres, um unsere Ermordung hinauszuschieben. Wer wird jetzt für die Geiseln eintreten? Ich weiß es nicht, und das macht mir Angst, aber ein Teil von mir ist erleichtert: Endlich werde ich schweigen können.
Aus dem Fahrzeug, das mich zum Denkmal brachte, sah ich die Welt und wurde ihrer Schönheit gewahr. Schade, dass ich diese Herrlichkeit verlassen soll! Schade vor allem, dass ich achtundzwanzig Jahre brauchte, um dafür empfänglich zu sein.
Ich wurde aus dem Lastwagen geworfen, und die Berührung der Erde begeisterte mich: Wie ich diesen freundlichen, zärtlichen Boden liebe! Welch bezaubernder Planet! Ich könnte ihn, scheint mir, jetzt um so viel mehr schätzen. Aber das kommt ein bisschen spät. Beinahe hätte ich an der Vorstellung Gefallen gefunden, dass meine Leiche in ein paar Minuten darin verscharrt werden würde.
Es ist Mittag, die Sonne wirft ein unerbittliches Licht, die Luft ist schwer von berückenden Pflanzendüften, ich bin jung und gesund, wie dumm, ausgerechnet jetzt sterben zu müssen! Bloß keine historischen Reden, ich träume von Stille. Das Knallen der tödlichen Schüsse wird mir in den Ohren wehtun.
Dabei habe ich Dostojewski um seine Erfahrung mit dem Exekutionskommando beneidet! Jetzt ist es an mir, diesen inneren Aufruhr zu erleben. Nein, ich will nicht zu Unrecht sterben, ich fordere noch einen Augenblick, jeder Moment ist so intensiv, allein das Verrinnen der Sekunden versetzt mich in Trance.
Die zwölf Männer legen auf mich an. Sehe ich jetzt mein Leben an mir vorüberziehen? Das Einzige, was ich empfinde, ist eine ungeheure Erregung: Ich bin lebendig. Jeder Moment ist bis ins Unendliche teilbar, der Tod kann mich nicht einholen, ich versinke im harten Kern der Gegenwart.
Die Gegenwart begann vor achtundzwanzig Jahren. In den allerersten Anfängen meines Bewusstseins sehe ich schon meine unbändige Freude zu leben.
Unbändig, weil unanständig – um mich herum herrschte Trauer. Ich war acht Monate alt, als mein Vater bei einem Unfall ums Leben kam. Was zeigt, dass Sterben bei uns eine Familientradition ist.
Mein Vater war Soldat. An diesem Tag sollte er Minenräumen lernen. Doch die Übung war schnell vorbei – irrtümlich lag da eine echte Mine statt einer Attrappe. Mein Vater starb Anfang 1937, mit fünfundzwanzig Jahren.
Zwei Jahre davor hatte er meine Mutter Claude geheiratet. Es war die große Liebe, die man damals in den gehobenen Kreisen Belgiens lebte wie im neunzehnten Jahrhundert: mit Zurückhaltung und Würde. Fotos zeigen ein junges Paar, das durch einen Wald reitet. Meine Eltern sind sehr elegant, schön, schlank und verliebt. Wie einem Buch von Barbey d’Aurevilly entsprungen.
Mich wundert, wie glücklich meine Mutter darauf wirkt. So habe ich sie nie gesehen. Ihr Hochzeitsalbum endet mit Bildern von einer Beerdigung. Offensichtlich hatte meine Mutter anfangs vor, sie später zu beschriften, wenn sie Zeit dafür hätte. Aber ihr war die Lust vergangen: Ihr Leben als glücklich verheiratete Frau hatte nur zwei Jahre gewährt.
Mit fünfundzwanzig legte sie sich eine Witwenmaske zu, die sie nie wieder ablegen sollte. Selbst ihr Lächeln war erstarrt. Härte überzog ihr Gesicht und beraubte es seiner Jugend.
»Immerhin haben Sie ein Kind zum Trost«, hieß es in ihrer Umgebung.
Wenn sie dann den Kopf zur Wiege hindrehte, sah sie ein hübsches, zufriedenes Baby, dessen Heiterkeit ihren Mut sinken ließ.
Anfangs hatte sie mich geliebt. Ihr erstes Kind war ein Junge, alle hatten ihr gratuliert. Inzwischen wusste sie, dass ich nicht ihr erstes, sondern ihr einziges Kind sein würde. Die Vorstellung, dass sie die Liebe zu ihrem Mann durch die Liebe zu einem Kind ersetzen sollte, empörte sie. Natürlich hatte ihr das keiner so gesagt. Aber sie hatte es so verstanden.
Claudes Vater war General. Er fand den Tod seines Schwiegersohns akzeptabel und sagte nichts dazu. Der große Schweiger passte zu seiner Armee.
Claudes Mutter war eine sanfte, zärtliche Frau, der das Schicksal ihrer Tochter im Herzen wehtat.
»Du kannst dir deinen Kummer ruhig von der Seele reden, mein armer Schatz!«
»Hör auf, Mama. Lass mich leiden!«
»Leide nur, leide ordentlich. Das dauert seine Zeit. Und dann wirst du wieder heiraten.«
»Sei still! Niemals werde ich wieder heiraten, verstehst du, niemals. André war und ist der Mann meines Lebens.«
»Natürlich. Aber jetzt hast du Patrick.«
»Was sagst du für komische Sachen?«
»Du liebst ihn doch, deinen Sohn.«
»Ja, ich liebe ihn. Aber ich sehne mich nach den Armen und dem Blick meines Mannes, nach seiner Stimme und seinen Worten.«
»Möchtest du wieder nach Hause kommen?«
»Nein. Ich will in meiner Ehewohnung bleiben.«
»Würdest du mir Patrick eine Zeit lang anvertrauen?«
Mit einem Achselzucken willigte Claude ein.
Hochzufrieden nahm Großmama mich mit.
Nachdem ihre Tochter und die beiden erwachsenen Söhne aus dem Haus waren, freute sie sich über dieses Gottesgeschenk. Jetzt hatte sie wieder ein Baby.
»Wie schön du bist, mein kleiner Patrick, wie ein Engel!«
Sie ließ mir die Haare wachsen und steckte mich in schwarze oder blaue Samtanzüge mit Brüsseler Spitzenkragen, Seidenstrümpfe und Stiefel mit Knöpfen. Dann nahm sie mich in die Arme und zeigte mir mein Spiegelbild.
»Hast du schon einmal so ein hübsches Kind gesehen?«
Sie betrachtete mich so hingerissen, dass ich selbst glaubte, schön zu sein.
»Schau, diese langen Wimpern, wie von einer Schauspielerin, und diese blauen Augen, die weiße Haut, dieser entzückende Mund und dann die schwarzen Locken! Dich müsste man malen.«
An dieser Idee hielt sie fest. Sie bat ihre Tochter, gemeinsam mit mir einem in Brüssel bekannten Maler Modell zu sitzen. Claude lehnte ab. Und ihre Mutter erkannte, dass sie ihr eine Weile zusetzen müsste, bis sie sich breitschlagen ließe.
Meine Mutter stürzte sich ins mondäne Leben. Sie mochte Empfänge nicht besonders, aber es kam ihr gar nicht in den Sinn, dass sie das, was sie tat, gern tun musste. Sie trug ihre beeindruckend elegante Trauer vor einem Publikum zur Schau, das ihren Auftritt zu würdigen wusste und ihr das gewünschte Bild spiegelte. Mehr wollte sie gar nicht.
Wenn sie morgens aufwachte, war ihr erster Gedanke: Was ziehe ich heute Abend an? Diese Frage füllte ihr Leben aus. Ihre Nachmittage verbrachte sie bei den großen Couturiers, die entzückt waren, eine so edle Verzweiflung einzukleiden. An diesem großen, mageren Körper fielen Kleider und Kostüme perfekt.
Claudes starres Lächeln tauchte ab 1937 auf fast allen Aufnahmen von Soireen des belgischen Gotha auf. Sie wurde überall eingeladen, denn ihre Anwesenheit war eine Art Garantie für Niveau und Geschmack des jeweiligen Empfangs.
Die Männer wussten, dass es vollkommen ungefährlich war, Claude den Hof zu machen – sie würde ohnehin nicht darauf eingehen. Genau aus diesem Grund machten sie es ja. Es war ein angenehmer Zeitvertreib.
Ich liebte meine Mutter hoffnungslos, sah sie aber nur selten. Jeden Sonntag kam sie mittags zu ihren Eltern essen. Ich sah zu dieser wunderbaren Frau hoch und lief mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Sie hatte ihre spezielle Art, eine Umarmung zu vermeiden, indem sie mir die Hände entgegenstreckte, um mich dann nicht hochzuheben. Ob sie Angst hatte, ihre schöne Toilette zu ruinieren?
»Hallo Paddy«, sagte sie mit frostigem Lächeln.
Anglizismen waren en vogue.
Mit einem Ausdruck freundlicher Enttäuschung, den ich nicht deuten konnte, betrachtete sie mich von Kopf bis Fuß. Wie hätte ich auch ahnen sollen, dass sie jedes Mal hoffte, ihren Mann in mir wiederzufinden?
Bei Tisch aß meine Mutter stets wenig und sehr schnell. Sie musste nur der Pflicht genügen, Nahrung in den Mund zu schieben. Dann zog sie ein entzückendes Etui aus ihrem Täschchen und zündete sich eine Zigarette an. Ihr Vater warf ihr vernichtende Blicke zu: Eine Frau rauchte nicht, Punktum. Sie wandte mit einer verächtlichen Bewegung, die sie für diskret hielt, die Augen ab. Hätte sie sprechen können, hätte sie gesagt: »Ich bin eine unglückliche Frau. Da darf ich doch wenigstens rauchen!«
»Nun, meine liebe Claude, erzähle!«, bat Großmama.
Mama berichtete von einem Cocktail bei Soundso, einem höchst interessanten Gespräch mit Mary, der wahrscheinlich bevorstehenden Scheidung von Teddy und Anny, dem etwas lächerlichen Kostüm von Katherine – wobei sie sämtliche Vornamen englisch aussprach und ihre Eltern Mommy und Daddy nannte. Sie fand es nur bedauerlich, dass für ihren eigenen Namen kein »charmanter anglisierender Diminutiv« existierte.
Sie redete schnell, leicht vernuschelt und mit flatternden Ts, weil sie überzeugt war, dass Engländer sich so anhörten.
»Ich bin gleich bei Tatiana zum Tee eingeladen. Da siehst du, dass sie gar nicht so depressiv ist, wie sie immer tut.«
»Du könntest doch Patrick mitnehmen!«
»Ausgeschlossen, Mommy, er würde sich zu Tode langweilen.«
»Nein, Mama«, mischte ich mich ein, »ich würde dich sehr gern begleiten.«
»Ach, mein Schatz, lass es, dort sind sonst keine Kinder.«
»Das bin ich gewohnt.«
Seufzend hob sie ein wenig das Kinn. Diese Geste war mein Tod: Mir wurde klar, dass ich in den Augen dieser unerreichbaren, erhabenen Frau einen Fehler begangen hatte.
Großmama erriet, dass ich litt.
»Dann geht doch in den Park spazieren, der Kleine muss mal an die frische Luft.«
»Ich höre immer nur Luft, Luft, Luft!«
Wie oft hatte meine Mutter sich schon darüber ereifert! Aus hygienischen Erwägungen an die frische Luft zu gehen erschien ihr absurd. Und Atmen hielt sie ohnehin für überschätzt.
Wenn sie ging, war ich ebenso traurig wie erleichtert. Am meisten betrübte mich die Erkenntnis, dass Claudes Gefühle mir gegenüber genauso zwiespältig waren. Sie küsste mich, warf mir einen gebrochenen Blick zu und eilte davon. Dabei klackerten ihre Absätze so hinreißend, dass ich ganz krank vor Liebe wurde.
Ich wurde vier, und es herrschte Krieg. Ich wusste, dass das etwas Schlimmes war.
»Was wünschst du dir zum Geburtstag?«, fragte Großmama.
Mir fiel nichts ein, was mir eine Freude machen könnte.
»Wenn dir nichts einfällt, schlage ich vor, dass du in den Armen deiner Mama für den besten Porträtmaler Brüssels Modell sitzt. Er wird euch beide malen, das wird eine Weile dauern, und du musst schön brav sein.«
In den Armen deiner Mama – das war das Einzige, was ich aus ihren Worten heraushörte. Begeistert stimmte ich zu.
Claude war nicht so begeistert von der Einladung ihrer Mutter. Doch diesmal verweigerte sie sich nicht, denn der besagte Maler stand in den besseren Kreisen hoch im Kurs.
Am vereinbarten Tag kam Mama in einer prachtvollen Robe mit raffiniert bescheidenem Spitzendekolleté. Monsieur Verstraeten, der Maler, betrachtete sie mit einer Bewunderung, die mich mit Stolz erfüllte. Für mich hatte Großmama einen schwarzen Samtanzug mit breitem weißem Spitzenkragen ausgesucht.
Monsieur Verstraeten bat Mama, in einem Lehnstuhl Platz zu nehmen, und war entzückt von der unmittelbaren Eleganz ihrer Haltung. Dass er auch mich noch in dem Bild unterbringen sollte, schien ihn eher zu stören.
»Wir könnten Ihnen das Fräulein auf den Schoß setzen, mit dem Rücken zur Armlehne«, schlug er vor.
»Das ist ein junger Mann«, korrigierte Mama.
Dieses Detail war dem Maler, der mich wie ein Accessoire auf den Knien meiner Mutter drapierte, ziemlich egal. Er war nur froh, dass ich nicht allzu viel Platz einnahm.
»Könnten Sie bitte Ihre Arme um das Kind legen, Madame? Sie haben so schöne Hände!«
Von Mamas Händen berührt zu werden bereitete mir ein verwirrendes Vergnügen. Die Sitzung dauerte Jahrhunderte und wiederholte sich an mehreren Nachmittagen. Ich war jedes Mal wie elektrisiert davon, den knochigen Körper meiner Mutter unter mir zu spüren.
»So ein braves Kind!«, lobte der Maler, um Mama zu schmeicheln.
Sie hütete sich zu erwidern, dass sie nichts dafür konnte. Zum ersten Mal hatte sie einen Grund, stolz auf mich zu sein – und ich fühlte mich wie Gott in Frankreich.
Wir durften das Bild erst sehen, als es fertig war. Und die Schönheit, die wir darin entdeckten, hatte wenig mit uns zu tun. Noch bevor ich den ersten Blick riskierte, forschte ich im Gesicht meiner Mutter, ob ich Gefallen daran finden dürfte. Mama schien verzaubert. Der Maler hatte sie im Zustand verliebter Erwartung dargestellt, indem er die Härte aus ihrem Gesicht gelöscht und durch sanfte Aufmerksamkeit ersetzt hatte. An Majestät glich die Frau auf dem Gemälde der jugendlichen Herzogin von Guermantes, die einen hochrangigen Gast empfängt, nur dass sie einen anmutigen, verträumten kleinen Engel unbestimmbaren Geschlechts statt eines Rassehündchens auf dem Schoß hatte.
Als Monsieur Verstraeten meine Mutter um ihr Urteil bat, nahm ihr Gesicht sofort einen missbilligenden Ausdruck an.
»Kaum zu glauben, dass wir das sind.«
»Ich habe gemalt, was ich gesehen habe, Madame.«
»Und wo haben Sie gesehen, dass mein Sohn sieben oder acht Jahre alt ist?«
Tatsächlich wirkte ich auf dem Bild älter, was der Maler mit dem pompösen Satz begründete: »Ich wollte ein zeitloses Werk schaffen.«
Man hätte dem tausend logische Argumente entgegensetzen können, aber meine Mutter begnügte sich mit der abschließenden Bemerkung: »Nun ja, es ist sehr elegant. Wir danken Ihnen, Monsieur.«