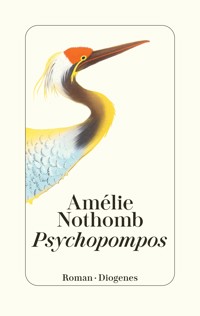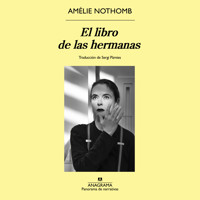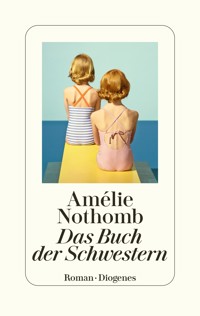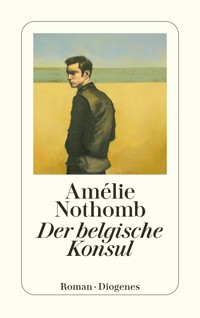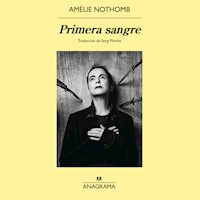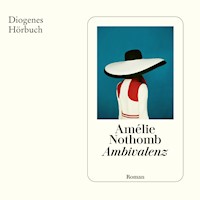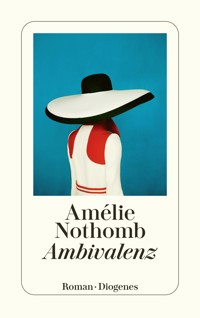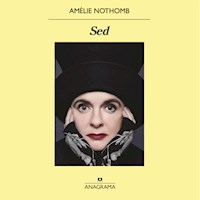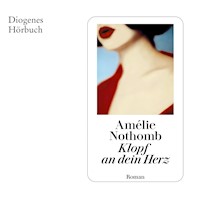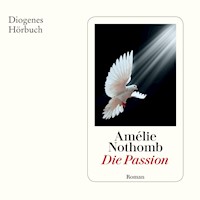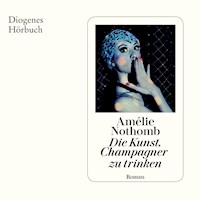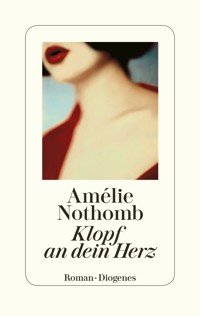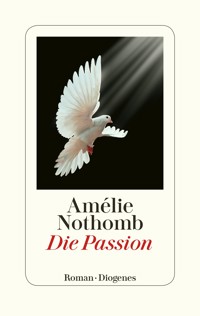
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich wusste schon immer, dass sie mich zum Tode verurteilen würden«, so beginnt dieser Roman. Hier spricht Jesus Christus in der Nacht vor seinem Tod. Mutterseelenallein in seiner Zelle, vertraut er uns seine geheimsten Gedanken an, seine Zweifel, seinen Groll. In Amélie Nothombs Roman wird Jesus tatsächlich Mensch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Amélie Nothomb
Die Passion
Roman
Aus dem Französischen von Brigitte Große
Diogenes
Ich wusste seit jeher, dass man mich zum Tode verurteilen würde. Der Vorteil dieser Gewissheit: Ich kann meine Aufmerksamkeit Dingen zuwenden, die es wert sind – den Details.
Auch dass mein Prozess jeder Gerechtigkeit hohnsprechen würde, hatte ich mir schon gedacht. Aber anders als vermutet war das Verfahren keine schnell erledigte Formalie, sondern ein aufwendig inszeniertes Spektakel. Der Ankläger hatte nichts dem Zufall überlassen.
Nacheinander traten die Belastungszeugen auf. Ich wollte meinen Augen nicht trauen, als ich die Eheleute aus Kana hereinkommen sah, auf deren Hochzeit ich mein erstes Wunder gewirkt hatte.
»Der da hat die Gabe, Wasser in Wein zu verwandeln«, erklärte der Mann ernst. »Aber er hat sie erst ganz am Ende unserer Feier eingesetzt, um sich an unserer Angst und Erniedrigung zu weiden. Das hätte er uns leicht ersparen können. Er ist schuld, dass es zuerst den schlechten Wein gab und danach den guten. Das ganze Dorf hat uns ausgelacht.«
Ruhig sah ich ihm in die Augen. Aber er hielt meinem Blick stand, weil er sich im Recht fühlte.
Der königliche Beamte warf mir Unwillen bei der Heilung seines Sohnes vor.
»Und wie geht es Ihrem Sohn jetzt?«, platzte mein Anwalt dazwischen. Er war der unfähigste Pflichtverteidiger, den man sich vorstellen kann.
»Sehr gut. Aber das war ja kein Kunststück! Bei solchen Zauberkräften reicht ein einziges Wort!«
Alle siebenunddreißig von Wundern Betroffenen hatten ein Hühnchen mit mir zu rupfen.
Am meisten musste ich über den vormals Besessenen von Kapernaum lachen, der jammerte: »Seit dem Exorzismus ist mein Leben so belanglos!«
Der nun sehende Blinde klagte über die Hässlichkeit der Welt, der einst Aussätzige beschwerte sich, dass die Almosen ausblieben, der Fischereiverband vom See Genezareth warf mir vor, ich hätte ein paar Fischer bevorzugt behandelt, und Lazarus schilderte, wie grauenhaft es sich anfühlt, wenn einem der Leichengeruch an der Haut klebt.
Offenbar war es nicht nötig gewesen, sie zu ihren Aussagen aufzufordern oder sie gar zu bestechen. Alle waren freiwillig gekommen, um gegen mich Zeugnis abzulegen. Und nicht nur einer empfand es als große Erleichterung, in Gegenwart des Schuldigen endlich sein Herz ausschütten zu können.
In Gegenwart des Schuldigen.
Meine Ruhe war nicht echt. Es kostete mich einige Anstrengung, diesen Litaneien regungslos zu lauschen. Ich schaute allen Zeugen mit einem Ausdruck milden Erstaunens in die Augen. Und alle erwiderten meinen Blick hochmütig oder trotzig und starrten zurück.
Eine Mutter, deren Sohn ich geheilt hatte, warf mir vor, ich hätte ihr Leben zur Hölle gemacht.
»Solange der Kleine krank war, war er still. Jetzt strampelt er, schreit und plärrt, ich habe keine ruhige Minute mehr und kann nachts nicht schlafen.«
»Sie haben meinen Mandanten doch darum gebeten, Ihren Sohn zu heilen!«, warf mein Pflichtverteidiger ein.
»Ja, schon, aber ich wollte nicht, dass er so unausstehlich wird wie vorher.«
»Das hätten Sie vielleicht dazusagen müssen!«
»Warum? Ist er denn nicht allwissend?«
Gute Frage. Ich weiß immer τι, aber nie πώς. Ich kenne die betreffenden Objekte, nicht aber die jeweiligen Umstandsbestimmungen. Also nein, ich bin nicht allwissend: Erst nach und nach entdecke ich die Adverbien und wundere mich. Die Leute haben recht, wenn sie sagen, der Teufel steckt im Detail.
Tatsächlich war es nicht nur nicht nötig, die Zeugen zum Aussagen zu drängen, nein, sie brannten geradezu darauf. Ich staunte über ihre Bereitwilligkeit, mich zu belasten – noch dazu, weil es vollkommen überflüssig war. Allen war klar, dass am Ende des Prozesses mein Todesurteil stehen würde.
Das vorauszusehen war keine Hexerei. Sie kannten meine Fähigkeiten und konnten nun feststellen, dass ich sie nicht eingesetzt hatte, um mich zu retten. Es gab für sie also keinen Zweifel am Ausgang des Prozesses.
Warum legten sie dann so großen Wert darauf, mir trotzdem ihre Gemeinheiten um die Ohren zu hauen? Was ist schon das Rätsel des Bösen, gemessen am Rätsel der Gemeinheit! Ich konnte ihre Lust an diesen Auftritten spüren. Sie genossen es, mich niederträchtig zu behandeln. Und waren höchstens enttäuscht, mich zu wenig leiden zu sehen. Dabei war es gar nicht meine Absicht, ihnen dieses Vergnügen vorzuenthalten, ich wunderte mich nur mehr über ihr Verhalten, als darüber empört zu sein.
Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd. Trotzdem begreife ich nicht, was in sie gefahren ist, dass sie mich derart mit Schmähungen überhäuften. Und dieses Unverständnis betrachte ich als Scheitern, ja als Verfehlung.
Pilatus hatte Anweisungen, was mich betraf, und ich sah, wie er sich ärgerte, nicht weil er mich sympathisch fand, sondern weil die Zeugen den Vernunftmenschen in ihm herausforderten. Er missverstand meine Verblüffung und wollte mir die Gelegenheit geben, diesem Unfug zu widersprechen. »Angeklagter, hast du etwas dazu zu sagen?«, fragte er mich, wie sich ein intelligenter Mensch an seinesgleichen wendet.
»Nein«, erwiderte ich.
Betrübt schüttelte er den Kopf, als wollte er sagen, man kann keinem eine goldene Brücke bauen, dem sein eigenes Schicksal egal ist.
In Wahrheit habe ich nichts gesagt, weil ich zu viel zu sagen hatte. Und hätte ich erst einmal damit angefangen, hätte ich meine Verachtung nicht mehr verbergen können. Das grämt mich. Ich bin lange genug Mensch, um zu wissen, dass man manche Gefühle nicht unterdrücken kann. Dann ist es das Beste, man lässt sie durch sich hindurchziehen und versucht erst gar nicht, sich gegen sie aufzulehnen. Nur so hinterlassen sie keine Spuren.
Die Verachtung ist ein schlafender Dämon. Und ein Dämon, der nicht handelt, verkümmert rasch. Vor Gericht aber ist Sprechen Handeln. Meine Verachtung zu verschweigen hieß also, sie am Handeln zu hindern.
Pilatus besprach die Sache mit seinen Beisitzern.
»Dass unser Mann sich nicht durch Zauberei befreit, beweist zur Genüge, dass die Zeugenaussagen falsch sind.«
»Das ist doch gar nicht der Grund dafür, dass wir seine Verurteilung fordern.«
»Ich weiß. Und ich will ihn ja auch verurteilen. Es wäre mir nur lieber gewesen, dabei nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich mich auf solche Schwindeleien stütze!«
»In Rom braucht das Volk Brot und Spiele. Hier braucht es Brot und Wunder.«
»Gut. Wenn das die Politik ist, habe ich nichts dagegen.«
Pilatus stand auf und verkündete:
»Angeklagter, du wirst gekreuzigt.«
Seine knappe Sprache gefiel mir. Der Geist der lateinischen Sprache kennt keine Pleonasmen. Wie furchtbar, wenn er gesagt hätte: »Du wirst gekreuzigt, bis dass der Tod eintritt«! Eine Kreuzigung kann nicht anders enden als mit dem Tod.
Dieser Satz aus seinem Mund verfehlte seine Wirkung nicht. Ich beobachtete die Zeugen und bemerkte ihre verspätete Reue. Obwohl sie gewusst hatten, wie es ausgehen würde, hatten sie eifrig zu diesem Urteil beigetragen. Jetzt taten sie so, als fänden sie es übertrieben und wären schockiert von dieser barbarischen Strafe. Manche wollten mir mit Blicken zu verstehen geben, dass sie sich von dem, was geschehen würde, distanzierten. Ich wandte die Augen ab.
Dass ich auf diese Weise sterben sollte, hatte ich nicht gewusst. Das war ja nicht gerade unwichtig. Als Erstes dachte ich an den Schmerz. Aber mein Geist machte nicht mit. Solche Qualen kann man sich nicht vorstellen.
Gekreuzigt wird man nur für die schändlichsten Verbrechen. Auf so eine Demütigung war ich nicht gefasst. Das also hatte man von Pilatus gefordert. Wozu sich in Mutmaßungen ergehen? Er hatte sich nicht widersetzt. Das Todesurteil stand von vornherein fest, aber er hätte mich auch köpfen lassen können. Was hatte ihn so verärgert? Wahrscheinlich, dass ich die Wunder nicht geleugnet hatte.
Aber das konnte ich nicht – die Wunder waren mein Werk. Anders als die Zeugen behauptet hatten, waren dafür jedoch enorme Anstrengungen nötig gewesen. Niemand hatte mich diese Kunst je gelehrt.
Dann kam mir ein komischer Gedanke: Wenigstens wurden bei dem, was mich erwartete, keine Wunder verlangt. Ich musste es nur geschehen lassen.
»Soll er heute gekreuzigt werden?«, fragte jemand.
Pilatus sah mich an und schien sich dieselbe Frage zu stellen. Anscheinend glaubte er, dass noch etwas fehlte, denn er antwortete:
»Nein. Morgen.«
Erst als ich wieder allein in der Zelle saß, wurde mir klar, was er von mir erwartete: Angst.
Er hatte recht. Bis zu dieser Nacht wusste ich nicht genau, was das war. Am Tag vor meiner Festnahme hatte ich auf dem Ölberg vor Kummer und Verlassenheit geweint.
Nun entdeckte ich die Angst. Nicht die Todesangst – die meistgeteilte Abstraktion –, sondern die ganz konkrete Angst vor der Kreuzigung.
Ich bin der unhinterfragbaren Überzeugung, der bestverkörperte Mensch zu sein. Wenn ich mich schlafen lege, ist mir das Lösen der Glieder eine solche Lust, dass ich mich zurückhalten muss, um nicht aufzustöhnen. Die einfachste Suppe zu essen oder abgestandenes Wasser zu trinken würde mir Freudenschreie entlocken, würde ich mich nicht zusammenreißen. Ich habe schon vor Glück geweint, nur weil ich Morgenluft atmete.
Umgekehrt ist es genauso: Das harmloseste Zahnweh quält mich unbeschreiblich. Als ich mir einmal einen Splitter zugezogen hatte, verfluchte ich mein Schicksal. Aber ich verberge das Zimperliche in mir genauso wie das Wollüstige – es passt nicht zu dem, was ich repräsentieren soll. Ein Missverständnis mehr.
In den dreiunddreißig Jahren meines Lebens konnte ich feststellen, dass der größte Erfolg meines Vaters die Verkörperung ist. Dass eine körperlose Macht auf die Idee kam, einen Körper zu erschaffen, ist und bleibt ein großartiger Geniestreich. Aber es ist auch kein Wunder, dass diese Schöpfung ihrem Schöpfer, der ihre Bedeutung nicht verstand, über den Kopf wuchs.
Ich würde gern behaupten, dass ich aus diesem Grunde gezeugt worden bin, aber das stimmt nicht.
Es wäre ein guter Grund gewesen.
Zu Recht beklagen sich die Menschen über die Unzulänglichkeiten des Körpers. Die Erklärung ist absolut logisch: Was taugt ein Haus, das ein obdachloser Architekt entworfen hat? Man ist nur gut in dem, mit dem man tagtäglich Umgang pflegt. Mein Vater hatte nie einen Körper. Aber für einen Ahnungslosen, finde ich, hat er es sagenhaft gut gemacht.
Meine Angst in dieser Nacht war ein Erbeben des Körpers angesichts der Vorstellung, was ich erleiden müsste. Von Gefolterten wird Haltung erwartet. Wenn sie nicht vor Schmerzen schreien, nennt man sie tapfer. Ich vermute jedoch, es handelt sich dabei um etwas anderes – ich werde sehen.
Besonders fürchtete ich die Nägel in meinen Händen und Füßen. Das war ein bisschen simpel – bestimmt gibt es schlimmere Qualen. Aber diese konnte ich mir zumindest vorstellen.
»Versuch zu schlafen! Morgen musst du in Form sein«, sagte der Kerkermeister zu mir. »Lach nicht! Zum Sterben braucht man einen gesunden Körper. Ich habe dich gewarnt.«
Richtig. Außerdem war es meine letzte Gelegenheit zu schlafen, was ich so gern tue. Ich versuchte es, streckte mich auf dem Boden aus und überließ mich der Ruhe. Aber sie floh mich. Immer wenn ich die Augen schloss, überkamen mich erschreckende Bilder statt Schlaf.
Also machte ich es wie alle Menschen und suchte vor den unerträglichen Gedanken Zuflucht bei anderen Gedanken.
Ich dachte an mein erstes, mein liebstes Wunder. Und stellte erleichtert fest, dass die Aussage des Paars aus Kana meine Erinnerung nicht getrübt hatte.
Dabei hatte es gar nicht gut angefangen. Mit der eigenen Mutter auf eine Hochzeit zu gehen ist eine Belastungsprobe. Meine Mutter ist eine reine Seele, aber auch eine ganz normale Frau. Sie schaute mich von der Seite an, wie um zu sagen: Und du, mein Sohn, wann willst du endlich heiraten? Ich tat so, als ob ich es nicht bemerkte.
Ich muss zugeben, dass ich Hochzeiten nicht sonderlich mag. Ein Gefühl, das sich der Analyse entzieht. Jedenfalls verursacht mir diese Art Sakrament Beklemmungen, was ich nicht verstehen kann, weil ich ja nichts damit zu tun habe. Ich werde nicht heiraten und bedaure das auch nicht.
Die Hochzeit war wie üblich: ein Fest, bei dem die Leute mehr Freude zeigten, als sie empfanden. Ich wusste, dass von mir mehr erwartet wurde. Aber was? Keine Ahnung.
Zum Festmahl gab es Brot, gebratenen Fisch und Wein. Der Wein war nicht besonders, aber das ofenwarme Brot knackte beim Hineinbeißen, und die gerade richtig gesalzenen Fische erfüllten mich mit Freude. Ich aß konzentriert, um mir nichts von all den Geschmäckern und Konsistenzen entgehen zu lassen. Meiner Mutter schien es peinlich zu sein, dass ich mich nicht mit den anderen Gästen unterhielt. Dabei sind wir uns darin ähnlich – sie ist auch nicht gerade gesprächig. Ich kann nicht sprechen, ohne etwas zu sagen, und ihr geht es genauso.
Dem Brautpaar brachte ich die freundliche Gleichgültigkeit entgegen, die man für Freunde der Eltern empfindet. Ich sah sie vielleicht zum dritten Mal, und sie übertrieben wie immer: »Wir kennen Jesus schon von Kindesbeinen an«, sagten sie. Oder: »Mit Bart siehst du ganz anders aus!« Eine solche Aufdringlichkeit ist mir unangenehm. Am liebsten hätte ich die Frischvermählten vorher nie gesehen. Das hätte unsere Beziehung ehrlicher gemacht.
Josef fehlte mir. Der gute Mann, der genauso wenig redete wie meine Mutter und ich, hatte die Gabe, sich durchzulavieren: Er hörte den anderen so intensiv zu, dass man seine Antwort zu hören vermeinte. Dieses Talent habe ich nicht geerbt. Wenn die Leute reden, ohne etwas zu sagen, tue ich nicht einmal so, als hörte ich zu.