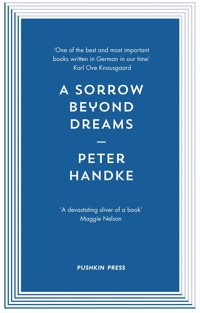23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Zentralmassiv mit dem Pico de Almanzor bildet eine bis in den Frühling hinein verschneite, fast zweihundert Gratkilometer lange Gipfelflur. Dorthin macht sich die Bankfrau aus einer nordwestlichen Flußhafenstadt auf den Weg. Sie will diese Bergkette durchqueren und dort in dem Manchadorf den Autor treffen, mit dem sie einen klassischen Lieferantenvertrag abgeschlossen hat: Sie, die mächtige Strippenzieherin mit den verschiedenen Namen, die nach einem tödlichen Verkehrsunfall der Eltern bei ihren Großeltern in einem wendischen Dorf aufwuchs, dann viel herumreiste und gar einmal als Starschauspielerin in einem berühmten Film mitspielte, bezahlt den Autor und kümmert sich um seine Geldgeschäfte; und er erzählt im Gegenzug ihre Geschichte nach vorgegebenen Regeln. Abschweifungen sind erlaubt, und als einziger Maßstab gilt: »mich erzählt werden spüren.«
Wir erfahren von den Begegnungen der wundersamen Abenteurerin mit den Menschen in der Sierra, vom Busfahrer und seinem Sohn, vom wandernden Steinmetz, dem Maultrommelspieler, vom Stadtrandidioten und nicht zuletzt vom Bruder, der lange im Gefängnis gesessen hat, und der Tochter, die verschwunden ist und doch immer wieder ganz anwesend in der Erinnerung und Sehnsucht. Vergangenheit und Zukunft, Jetztzeit und geträumte Zeit fließen ineinander in eine von den Bildern erhöhte Gegenwart. Peter Handke hat ein großes Sehnsuchtsbuch, ein Menschenbuch geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Handke
Der Bildverlust oder Durch die Sierra de Gredos
Roman
Suhrkamp Verlag
»Du wirst gehen zurückkehren nicht sterben im Krieg«
Lateinisches Orakel
»Hab' Erbarmen mit ihr, die reist an solch einem Tag«
Ibn 'Arabî
»Aber vielleicht haben die Ritterschaft und die Verzauberungen heutzutage andere Wege zu nehmen als bei den Alten«
Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha
1
Sie wünschte, es wäre ihre letzte Reise. Da, wo sie seit langem wohnte und ihre Arbeit hatte, war es ihr immer wieder neu und abenteuerlich genug. Land und Gegend waren andere als die ihrer Geburt, und sie hatte schon von Kind an in mehreren grundverschiedenen Landstrichen und Ländern gelebt.
Aufgewachsen bei vielreisenden oder eher vagabundierenden Großeltern, die mit jeder Grenze ihre Nationalität zu wechseln schienen, hing sie in der Jugend zeitweise ihrem abwesenden ostdeutschen Geburtsland nach, ihr vertraut aus keinerlei Erinnerung, vielmehr allein aus Erzählungen und später auch Träumen.
Nach einigen Besuchen in jenem Land studierte sie dann teilweise dort, sagen wir, in Dresden oder Leipzig, eine gute Fahrradstunde entfernt von ihrem Geburtsdorf, und in der Folge, einige Länder und zwei oder drei Erdteile danach, wurde sie da, zwei Autostunden weg von ihrem angeblichen, inzwischen abgerissenen und durch einen Neubau ersetzten Geburtshaus, dort sogar für ein paar Jahre ansässig, und arbeitete; damals noch nicht als Bankfrau.
Danach, nach wieder diesem und jenem anderen Land und Kontinent, Arbeiten und zwischendurch auch Vagabundieren, einem von dem einst ihrer Großeltern freilich verschiedenen ‒ fast immer allein ‒, verlor die Geburtsgegend sich allmählich, unbemerkt, aus ihrem Sinn; spurlos verschwunden eines Tages aus ihrem Innern das ausgedehnte, großmächtige Deutschland, während von ihrem speziellen, kleinteiligen Deutschland eine Zeitlang wenigstens noch einige Spuren blieben, ein Bach mit den Schatten von Wasserläufern unten im Kieselbett, ein abgeerntetes Maisfeld, aus dessen Furchen die zerhäckselten Blätter aufwirbelten, ein in die steppenkalte Gegend verirrter Maulbeerstrauch.
Und auch diese kleinen Spuren schwanden. Die Bilder kamen nicht mehr von selber. Sie mußte sie vorsätzlich herbeirufen. Und so blieben sie ohne Bedeutung. Höchstens in manchen Traum griffen sie noch ein. Und dann verloren sie sich auch aus den Träumen. Das Land ging ihr nicht mehr nach. Sie hatte kein Land mehr, auch kein anderes, auch nicht das jetzt hier. Und das war ihr nur recht. Wie recht ihr das war! Wie geformt und bloß zusätzlich verschönt sie, und nicht bloß ihr Gesicht, war von den Ewigkeiten in der Fremde.
Eine klare, frostkalte Nacht Anfang Januar an der Peripherie einer nordwestlichen Hafenstadt. Wie hieß die Stadt? Name des Landes? Dem Autor, den sie mit dem Buch über sie, ihre Unternehmungen und ihre Abenteuer beauftragt hatte, war es zugleich untersagt worden, Namen zu verwenden. Wenn es anders nicht ging, sollte er ihretwegen Ortsbezeichnungen einsetzen. Von diesen mußte aber von vornherein klar sein, daß es in der Regel die falschen ‒ geänderte oder erfundene ‒ wären. Stellenweise stand es dem Autor, mit dem sie einen klassischen Lieferantenvertrag abschloß, auch frei, einen richtigen Namen mitspielen zu lassen; der Kreis der Leser hätte, so oder so, allein der großen Geschichte zu folgen und sollte, kraft der Geschichte wie auch des Erzählens, so frei sein, jeden anfänglichen Gedanken an eine Fährtensuche oder ein Nachschnüffeln schon mit dem ersten Umblättern zu vergessen. Womöglich sogar schon mit dem ersten Satz ihres Buches hatten solche Gedanken oder Hintergedanken das Feld zu räumen für nichts als das reine Lesen.
Das gleiche, so ihre Vertragsbedingungen, galt entsprechend für die Personennamen und die Zeitangaben. Personennamen nur, wenn sie klar Ausdruck der Phantasie sind. »Welcher Phantasie?« (der Autor). ‒ »Der Phantasie des jeweiligen Abenteuers und der Liebe« (sie). »Wessen Liebe?« ‒ »Meiner. Und Zeitangaben einzig ungefähr so: An einem Wintermorgen. In einer Sommernacht. Im folgenden Herbst. Damals zu Ostern, mitten im Krieg.«
Sie hatte schon seit langem fast keine Verwandten mehr. Und wenn, so waren auch diese ihr mit der Zeit aus dem Sinn geraten. Irgendwo ‒ »wo?« ‒ »weißnicht« ‒ lebte angeblich noch ein Halbbruder, angeblich ein Wohnwagenverleiher, oder ein Mikrochiptechniker? oder beides?
Viele Jahre hatte sie dabei mit ihren Vorfahren, angefangen bei den nie bewußt wahrgenommenen Eltern, einen stillen, insgeheimen und umso glühenderen Kult betrieben. Die Vorfahren, ausgenommen höchstens die lange allzu gegenwärtigen Großeltern, bildeten, wiederum durch Erzählungen, und wenn auch noch so fragmentarische, gerade durch fragmentarische!, und dann Träume, während wohl »zwei Dutzend von Sommern und mehr noch von Wintern« ihre oft täglich neu beweinte Liebe.
Sehnte sie sich nach ihren Ahnen? Ja, aber nicht mit ihnen zu sein, sondern bloß so einen Augenblick bei ihnen vorbeischauen zu können, sie zu trösten, sich bei ihnen zu bedanken und, mit einem Schritt zurück in den gebührenden Abstand, sie anzubeten.
Und inzwischen waren diese Vorfahrenumrisse kraftlos geworden. Und auch das hatte sich ganz allmählich ereignet. Ihre verehrten Toten, so sah sie es eines Sommeroder Wintermorgens, waren Teil der zigmilliarden seit dem Beginn der Zeiten in das Erdreich versickerten, hinweggesinterten, verkrümelten oder in sämtliche Windrichtungen verpufften Nichtmehrvorhandenen, Niewiederzurückrufbaren, von keiner Liebe mehr Wiederbelebbaren, in alle Ewigkeit unersehnbar Gewordenen. Wohl agierten sie noch, wie früher, ab und zu in den Träumen, aber bloß so im Gewimmel, unter »ferner liefen«: dieses Ab und Zu hatte, anders als früher, nicht mehr die Bedeutung von »zu allen heiligen Zeiten«.
Und auch dieser zweite Tod ihrer Vorfahren war ihr dann, wie zuvor das aus ihr entschwundene kleine und große Geburtsland, recht. Die Kräfte, die sie lange Zeit weniger aus dem ganzen Land als aus den kleinen Landbruchstücken, weniger aus einem geglückten ganzen Leben eines Ahnen (es gab freilich nicht einen einzigen dieser Art) als aus dem Unglück und dem einsamen Sterben (das galt für alle ihre Vorgänger) bezogen hatte, erschienen ihr inzwischen erschwindelt. Solche Kräfte, fragte sie sich, machten sie nicht tyrannisch und rücksichtslos? Wirkten zu Lasten derer, mit denen man jetzt war, lebte, arbeitete, umging, jetzt in der Gegenwart? Solche Kräfte waren begleitet von einer Art Hoffart, welche die Tage wie auch die Nächte der Zeitgenossen, der einem so oder so nah kommenden, behindern, ja beschädigen, ja zerstören konnte? Ihre Ahnenverehrung losgeworden, wurde sie frei für andere Kräfte? Impulse? Nein, so ganz recht war ihr das Bedeutungslos- und Unscheinbarwerden der Vorfahren trotzdem nicht. Sie ließ es eher, Bitterkeit nicht nur auf der Zunge, geschehen.
Seit Wochen schon herrschte ein harter Frost in ihrer nun bald langjährigen Gegend. Sie wollte dem Autor diese Angabe, die sich kaum mit der von ihr als Wohnort vorgesehenen »nordwestlichen Hafenstadt« ‒ der Golfstrom das Klima mildernd ‒ vereinbaren ließ, zunächst ausreden. Doch dann ließ sie sich überzeugen, daß »Hafen« auch ein »Flußhafen« sein konnte, im Binnenland, weit weg von der wärmenden Küste in einem halb schon kontinentalen Kaltgebiet. Basel. Köln. Rouen. Newcastle upon Tyne. Passau. Was zählte: daß sich in einer solchen Stadt der Zentralsitz ihrer Bank befand. Aber auch der Name der Bank durfte in ihrer Geschichte nicht vorkommen.
Am Morgen ihrer Abreise stand sie noch früher auf als üblich. Wie vor jeder Reise war es eine beflügelte, leichte Nacht gewesen; wohl auch, weil sie wieder einmal geschlafen hatte im Bett ihres ausgezogenen Kinds. Die Sachen waren schon gepackt ‒ eher verstaut, in einem Tragsack, der, gekauft einst am Ende ihrer Mädchenzeit, inzwischen halb so alt war wie sie selber. Nur wirkte er unvergleichlich älter: zerschlissen, eingerissen, angeschabt; wie ein Relikt aus dem Mittelalter, da man ganz anders gereist war als heutzutage; ein Ranzen aus Hermelinfell? Immer wieder, vor jeder ihrer Alleinfahrten, und nicht nur in die Sierra, hatte sie ihn wegwerfen oder zumindest in einen Winkel verstauen wollen. Und jedesmal war er doch noch einmal, »ein letztes Mal«, an die Reihe gekommen. Ihre längst auf und davon gegangene Tochter pflegte seinerzeit als Kind, sooft eines der miteinander gespielten Spiele zuende gespielt war, die Mutter um ein »letztes Mal Spielen« zu bitten, und danach, nach so einem »letzten Mal«: »Bitte, noch einmal ein letztes Mal!« Das war dann nicht mehr ein Bitten, sondern schon ein Flehen. Der Autor: Ob er das in ihr Buch übernehmen könne? Sie: Wenn das nicht ‒ was dann? Ihr Tragsack blieb auf der ganzen Reise halb offen. Aber es fiel nie etwas aus ihm heraus. Und ihre Schuhe? Waren alt und allseits angerauht ‒ gut zum Felsklettern.
Es war noch tiefe Nacht, und der Frost knisterte außen an den Scheiben. Sie machte kein Licht; der Fastvollmond, obwohl im Abnehmen, leuchtete das ganze vielfenstrige, vorhanglose Haus aus. Die Flußhafenstadt zog sich hier an der Peripherie hin bis an den Fuß eines teils bewaldeten, teils nacktfelsigen Hügelrückens. Der Hügel, schwarz im Mondgegenlicht und sehr nah, erschien als ein Bestandteil des weiten und im Augenblick eher leer wirkenden Hauses. Von Raum zu Raum ‒ und es gab nicht wenige Räume ‒ entwarf die Beinahleere ein verschiedenes Bild: hier war die Bewohnerin längst endgültig ausgezogen; hier stand das bis auf zwei, drei Dinge und Geräte ausgeräumte Zimmer bereit für den Arbeitsbeginn; jetzt der verlassene Flur zeigte die Spuren einer Flucht; jetzt der Tisch im Salon glänzte für eine kurz bevorstehende Konferenz; dort jetzt in dem einzigen, dafür kesselgroßen Topf in der Küche war vorausgekocht für eine ganze Gesellschaft, oder für eine ganze Woche.
Eine Art Fülle oder eher Vollgestopftheit ähnlich dem Tragsack allein in dem ersten der drei aufeinanderfolgenden Kinder- bis Schüler- bis Studentinzimmer: bis in die hintersten Ecken standen und lagen da neben- und übereinander Spiele, Spielfiguren, Spielsachen. Nur hatten die Dinge in dem Rucksack ein jedes seinen Platz, seinen Zweck, seinen Plan, ergänzten sich untereinander und deuteten eins auf das andere. Hier in dem Kinderzimmer dagegen wurde an den hundert dahingewürfelten und -geschobenen Spielzeugen kein einziges Spiel erkennbar. Nicht einmal im Ansatz zeigte sich ein gleichwie vertrautes und nachvollziehbares Spielschema, und das nicht bloß wegen des Mondlichts. Und doch war in dem Zimmer gespielt worden, mit allen den Sachen da auf dem Boden, und mit denen allen gemeinsam, gleichzeitig, und wie! Voll Begeisterung, im Schweiße der Achseln und des Angesichts, unter Anfeuerungsrufen und Absingen unerhörter Lieder, Spiel, Spiel und nichts als Spiel. Und das Spielen schien noch gar nicht so lange aus. Es würde im nächsten Augenblick neu einsetzen.
Der Reisekaffee (oder -tee) an einem der Südfenster. In diese Richtung sollte sie nun. Dabei war mit gleichwelchem Süden doch längst nichts mehr anzufangen, ebenso wie mit dem Meer und mit sämtlichen anderen Richtungen ‒ recht so ‒, eingeschlossen den Himalaja und die Fahrt hinauf zum Mond. Der spiegelte sich jetzt unversehens in der Tasse und verschwand gleich wieder. Sie versuchte ihn einzufangen. Aber er entschlüpfte jedesmal. Sie saß auf einem zusammenklappbaren sogenannten Reisestuhl und wünschte, weiter und weiter so zu sitzen.
Ein Ruck jetzt: jemand beäugte sie oder ihre Silhouette von außen, aus der Finsternis: der Autor, der Lieferant. Ein erster einzelner Glockenschlag von der Stadtrandkirche, und fast zugleich die Stimme des Muezzin vom benachbarten Minarett, beantwortet von einem wiederholten Eulenruf aus dem Waldhügel. Das erste Frühflugzeug als Blinkspur neben den starr funkelnden Wintersternen, und als drittes jetzt ein Streichholz angerissen über den ganzen Himmel und schon wieder erloschen: eine Januarsternschnuppe.
Nein, kein Autor. Und doch gab es den. Er war sogar ein Grund und eins der Ziele ihrer bevorstehenden Reise. Und es ging dabei nur beiläufig oder nebenbei darum, daß sie ihm ihr Leben oder was auch immer erzählte. Hauptsächlich ging es um Geld. So wie sie und er zuerst den Liefervertrag über ihr Buch abgeschlossen hatten, so sollten sie beide nun miteinander einen Vertrag vereinbaren, worin sie oder ihre Bank ‒ die Bank und sie, zumindest ihr Name, standen seit langem für ein und dasselbe ‒ freie Hand zur Verwaltung und Vermehrung des Autorengeldes bekämen.
Üblicherweise befaßte sie sich mit derlei nicht mehr. Die Bank hatte eine eigene Abteilung dafür, und sie agierte inzwischen außer- und oberhalb der Abteilungen. In diesem Fall aber mußte sie eine Ausnahme machen. Sie selber hatte sich in eine solche Lage gebracht, indem sie, anstelle der nichtendenwollenden Zeitungsartikel und Farbmagazin-Reportagen, ein richtiges Buch über sich, ihre Bank, auch deren Geschichte, wünschte. Dabei waren die Geldsummen, die der Autor anlegen wollte (oder konnte), nicht nur im Vergleich mit den üblichen Geschäften ihrer Bank eine Kleinigkeit. Und auch die Person des Autors selber schien, nach dem einzigen bisherigen Treffen zwischen ihnen beiden, eher dazu angetan, ihr aus dem Weg zu gehen.
Wie war sie auf ihn gekommen? Warum hatte sie den Buchvertrag nicht mit einem Journalisten, oder einem Historiker, oder, am nächstliegenden, mit einem Historienjournalisten, vereinbart? Von vornherein bestand sie auf einem mehr oder weniger zünftigen Schriftsteller; einem Erzähler; meinetwegen einem Erfinder, was ja nicht heißen mußte, daß der die Fakten verbog oder fälschte ‒ er hantierte vielleicht nur da und dort mit zusätzlichen, anderen, ungeahnten, Fakten und verschwieg oder, warum nicht, vergaß in deren Schwung dafür so manche selbstverständlichen, unnötig zu erwähnenden? »Fakten statt Mythen«, so hatte einer der historischen Journalisten, als er sich für das Buchprojekt anbot, als den Untertitel vorgeschlagen. Und unter andern Sprüchen hatte auch dieser, gerade der, sie auf die Gegen- oder eher Nebenspur, die des Autors, gebracht: in dessen Falle sie sich momentweise trotzdem sah.
So oder so aber versprach sie sich von ihm, er werde in die Folge der Fakten möglichst viel anderes miteinfließen lassen; und das, was miteinfließe, werde entscheidend sein für die Geschichte. Geschichte? Eher so: wie andere in die Geschichte eingehen wollten, so wollte sie eingehen in die »Erzählung«. Und diese sollte unverfilmbar sein, oder für einen Film, wie es ihn noch nie gegeben hatte.
Sie war einmal eine Leserin gewesen. (Sie las auch jetzt noch, doch das war für sie kein Lesen mehr. Sie las nicht mehr recht. Und zugleich kam sie sich ohne Lesen verwaist vor.) Und in jener Zeit hatte der ‒ nicht nur der erzwungenen Reise wegen ‒ vermaledeite Autor ihr weniger als Held denn Lotse?, nein, sie brauchte keinen Lotsen, gedient; gedient? ja, gedient. Und obwohl seine letzten Bücher schon länger zurücklagen und sie diese auch nicht mehr gelesen hatte, war ihr dann unversehens die Idee mit ihm als dem Verfasser ihres Buchs gekommen. Er oder keiner. Und er würde sich umgehend für sie an die Arbeit machen. Niemand, auch er nicht, konnte ihr Angebot ablehnen. Schon eine Bedenkzeit wäre ihr unverständlich. Einmal, in einem anderen Erdteil zu Gast in der Residenz eines für ihre Bank fast lebenswichtigen, im übrigen sehr auf Würde bedachten Staatspräsidenten, »sagen wir, dem von Singapur«, forderte sie diesen mitten in den Verhandlungen auf, ihr eins der im Hotel vergessenen Dokumente ‒ nicht etwa holen zu lassen, sondern persönlich holen zu gehen. »Und er hat es auf der Stelle geholt!«
Der Autor, obwohl seit einem Jahrzehnt ohne neues Buch, war zugleich, fast zu seinem eigenen Leidwesen, »fast«, ganz und gar kein Vergessener. Ohne auch nur annähernd reich zu sein, litt er an keinerlei Geldmangel. Und von ihr und ihrer erdumspinnenden Legende als Bankfrau und Geldexpertin wußte er bis zu dem ihm durch einen autorisierten Boten an die Gartentür expedierten Ansinnen gar nichts, und das nicht wegen seines etwa abgeschiedenen Daseins in einem Mancha-Dorf (wo gab es das noch, ein freiwillig abgeschiedenes Dasein?).
Und auch er, der Formenforscher und Rhythmenmensch, und sonst eher Gesellschaftsunfähige oder eher -unwillige, alt, wie er zudem fast schon war, spurte auf der Stelle. Er kaufte sich in der einzigen Dorf-Tienda eine Telefonkarte und sagte sich aus der einzigen Dorf-Telefonzelle direkt bei ihr für den folgenden Morgen in der Flußhafenstadt an (bis zum nächsten Flugplatz war es immerhin für ihn eine Halbtagesreise). Treffen hier dann in ihrem Büro unterm Dach: »Ich werde Ihr Buch schreiben. Das Geld war mir seit je eins der größten Geheimnisse. Und ich will endlich hinter dieses Geheimnis kommen. Und außerdem habe ich mir immer schon solch einen Auftrag gewünscht: Kein Werk, sondern eine Lieferung. Eine Bestellung.« Rhythmenmensch? Welcher Art Rhythmen? »Vor allem der Rhythmus des Verstehens, als des umfassendsten der Gefühle, Hand in Hand mit dem Rhythmus des Schweigens und Verschweigens.«
Sie kannte Photographien des Autors von viel früher. Aber sein Gesicht hatte sich wie gar nicht verändert. Nur die Gestalt wirkte kleiner als gedacht, hutzelig, wie vertrocknet, stachlig, wie aus der Meseta-Steppe dahergeweht. Er war ihr dabei auf den ersten Blick vertraut, so wie nur ein Dorfmensch einem anderen Dorfmenschen; vertraut, wie ein Dorfmensch einem anderen Dorfmenschen sein konnte besonders an einem auswärtigen Ort, ob in der nächsten Stadt oder, was immer häufiger vorkam, in einem für sie beide fremden Land: schien es doch, als seien mehr und mehr Dorf- oder Kleinstadtbewohner, gerade solche, inzwischen in der ganzen Welt verstreut, weniger als Touristen denn als ansässig Gewordene, Arbeitende, an den fernsten Orten Verheiratete, die mit den einheimischen Japanern oder Schwarzen gezeugten Kinder durch eine Seitenstraße von Osaka oder Djibouti transportierend.
Der Zustand solcher Vertrautheit hielt freilich nicht an. Der Autor, wie er vor ihr stand ‒ er wollte sich nicht setzen ‒, wurde ihr schnell unheimlich. So unheimlich konnte einem nur jemand werden, den man sofort hatte in die Arme schließen wollen und bei dem man schon im ersten Schritt auf ihn zu gegen unsichtbares Glas stieß.
Auf nichts sonst achtete sie in ihrem Bereich ‒ und wo immer sie sich gerade befand, war ihr Bereich ‒ mehr als auf den Abstand. Der Abstand aber, den dieser Mensch (und sie sah in der Folge: nicht nur zu ihr) einhielt, war eine Art des Vor-den-Kopf-Stoßens. Es gab diejenigen, die zu gleichwelchem Reden sich einem auf Nasenlänge näherten, wie für die Großaufnahme in einem Film. Er dagegen blieb während ihres ganzen Dialogs um gut einen Schritt hinter der üblichen Distanz von Verhandlungspartnern oder miteinander Konferierenden zurück; ging sie unwillkürlich mitten in einem Satz auf ihn zu, wich er schleunigst aus und tat dazu noch, als sei nichts. Auch solche Leute da, genauso wie die sich Bauch an Bauch zu ihr Stellenden, waren Rüpel. Und zugleich: Wenn er einmal ruhig stand, war er da aufgepflanzt in ihrem Office wie auf eigenem Grund und Boden (die Bauern standen längst nicht mehr so), breitbeinig, die Fäuste in den Hüften ‒ fehlte bloß noch, daß er regelrecht in die Grätsche ging wie manche Militärs, die so ihr Terrain markierten. Und zugleich blickte er die ganze Zeit entweder an ihr vorbei oder über sie hinweg zum Dachfensterhimmel, oder starrte sie an oder lächelte unversehens, oder seufzte auf einmal schwer, oder stieß das Fragment eines unbekannten Gesangs aus, oder blieb eine Zeitlang sogar völlig unansprechbar, so daß sie, in der Annahme, er verstehe ihre Sprache nicht (es war dabei doch ihrer beider Sprache?), ins Englische, Französische, Spanische, Russische überwechselte ‒ und erst, wenn er dann offenbar gar nichts mehr verstand, gerade dann!, horchte er wieder auf oder erwachte, und die Vertragsgespräche konnten weitergehen. Friedlich erschien er ihr, und zugleich reizbar, oder umgekehrt. Zu friedlich? Zu reizbar?
Trotzdem hatte sie ihn schließlich mit dem Projekt beauftragt. Noch am selben Morgen war die Liefervereinbarung, von ihr rasch aufgesetzt, wobei er bei der Reinschrift, auf einmal Satz für Satz kräftig und geistesgegenwärtig, eingriff, unterzeichnet und gesetzkräftig. Sie gewann eine Art von Vertrauen zu dem Autor zurück, ein anderes als das auf den ersten Blick, mit dem Moment, da ihr aufging, daß sein ständiges Vergrößern jedes Grundabstands aus einem Schuldgefühl kam. Das ging ihr auf, einmal, indem es ihr Instinkt sah oder roch ‒ alle Artikel sagten ihr nach, sie sei »ganz Instinkt« ‒, und dann, indem sie unvermittelt an dem Mann da ihre eigene Schuld sah und herausroch; große Schuld; unbelangbar aber, solange man im Abstand blieb. Und wie war das bei ihr? Sie schützte sich anders. Und solange sie so geschützt war, konnte keine Rede von Schuld sein, sondern sie hatte ein Geheimnis. Und sie war stolz auf ihr Geheimnis. Sie würde dieses Geheimnis verteidigen um den Preis ihres Lebens.
Der Autor war wohl der richtige. Inzwischen aber ‒ da sie sich nun auf die Geschichte eingelassen hatte ‒ war es, als verlangte ihr Buch noch nach einem anderen, keinem Bankartikelfachmann, einem Dritten. Wie war doch eine Frage des Autors gewesen?: Sollte das Buch mehr dem Mündlichen oder mehr dem Schriftlichen folgen? Für ihn gelte die Mündlichkeit als der Grund- oder eher Untergrundzug, und zudem als die Gegenprobe. Die Schriftlichkeit jedoch sei der wesentliche Zusatz der Erzählung, sei deren Bereicherung ‒ die Bereicherung.
Umkreisen des Hauses im vormorgendlichen Garten, bei anhaltendem Mondschein. Eins der immer häufigeren Flugzeuge vorbeiziehend am Mond, der Mondlichtschatten quer durch den Garten zwinkernd, so anders als Flugzeug- oder Vogelschatten in der Sonne; eulenhaft. Die von den Bodenwürmern vor dem Frost aufgeworfenen abertausend Erdhäufchen, tiefgefroren, bei jedem Schritt ein Anstoß unter den Sohlen. Sie war neu in Yucatán und stieg dort vor Sonnenaufgang die Stufen des Mayatempels hinauf.
Aus dem dichtverflochtenen, frostverkrümmten und verzahnten Efeulaub über der Mauer am Ende des Gartens schnellten und spritzten im Bogen die kleinen, braunschwarzen, blaubehauchten Fruchtkugeln, jetzt zu Winteranfang reif geworden, und sie hörte im Innern der Hecke ein Picken, Schnäbeln und Schmatzen. Der Isonzo strömte, dort wo er noch nicht trüb war von den Zementwerken, flußab über weiße Kiesel, die auch die Ufer bildeten, vergessen die Million der Toten (nein, nicht vergessen). Die Amsel, frühester Tagesvogel?, schoß aus dem Busch, wie immer fast den Boden streifend, und wie immer mit angelegten Flügeln die Kurve kratzend und durch die längst vorgesehene Fluchtlücke mit Gezeter hinaus ins Freie tauchend.
Sie hielt inne. Die Straße der Kesselschmiede in Kairo hallte wider; Rauch und Metallstaub stoben aus den zur Straße offenen Werkstätten, und sie sah und roch die Schwaden jetzt ungleich eindringlicher und nachhaltiger als an dem Tag, da sie dort, obwohl ganz Auge und Ohr, durchgegangen war.
Solche Bilder kamen ihr täglich, vor allem morgendlich. Sie lebte von ihnen, bezog aus ihnen ihr stärkstes Daseinsgefühl. Es waren keine Erinnerungen, weder willkürliche noch unwillkürliche: dazu kamen diese Bilder zu blitzartig oder meteoritenhaft, und ließen sich weder verlangsamen noch anhalten noch gar einfangen. Wollte man sie stoppen und in Ruhe betrachten, so waren sie längst zerstoben, und mit solchem Eingriff zerstörte man sich im nachhinein auch noch die Wirkung des so jäh verschwundenen wie jäh erschienenen und einen durchkreuzenden Bruchsekundenbilds.
Wie wirkten die Bilder? Sie erhöhten ihr den Tag. Sie bekräftigten ihr die Gegenwart. Sie lebte von ihnen: das hieß auch, sie benutzte und nutzte sie. Sie verwendete sie sogar für ihre Arbeit; ihre Unternehmungen; ihre Geschäfte. Wenn sie so, beinahe sagenhaft (»legendär«, laut den Artikeln), bei der jeweiligen Sache sein konnte, mit einer »zauberischen Geistesgegenwart im entscheidenden Moment«, sämtliche Zahlen und Daten nicht nur im Kopf, sondern mit ihnen dem Partner oder Widerpart »ein wahres Hexeneinmaleins hinblätternd«, dann verdankte sie das ‒ noch keinem Interviewer hatte sie es verraten, mit was für Worten auch? ‒ dem Eingriff ihrer Bilder in ihren Arbeitstag.
Demnach waren diese doch dem Willen unterworfen und nach Belieben und/oder Bedarf abzurufen? Nein. Sie blieben unvorhersehbar. Aber im Lauf der Zeit hatte sie die eine oder andere Methode entdeckt, mit deren Hilfe ihre »Reservearmee« zu aktivieren war. Es handelte sich dabei nicht um Methoden und schon gar nicht Tricks, vielmehr um bestimmte Grundhaltungen und eine ganze Lebensweise.
Ja, sie hatte ihr Leben, und nicht nur ihren Beruf und ihre »Finanzfürstin«-Existenz, ausgerichtet auf solcherart Bildeinschießen. Welche Grundeinstellungen und Verhaltensweisen waren dazu beispielsweise besonders fruchtbar? Sie, die, von Natur oder von Berufs wegen?, wenig Scheu kannte, hatte Scheu, darüber zu reden, konnte dann aber einiges andeuten: eine gewisse Sorgsamkeit in den alltäglichen Handhabungen; Umwegsbereitschaft; Momente der Abwesenheit in Gegenwart anderer nicht etwa bekämpfen, sondern sich ihnen im Gegenteil überlassen; körperliche ‒ nicht sportliche, sondern am besten handwerkliche ‒ Anstrengung über längere Zeit und im Gleichmaß, bis an den Rand der Erschöpfung, wo es dann, vielleicht, zum Bilderglühen kommt … (statt eines Gymnastikraums hatte sie eine Werkstatt in ihrem Haus).
So wie sie von dem Bildwerden lebte, in jedem Sinn, so lebte sie für es. Und ihre Reservetruppe ‒ »dieses Wort nie mehr verwenden!« bedeutete sie dem Autor ‒ benutzte sie ganz und gar nicht zu gleichwelchem Kriegführen. Ein einziges solches sich und sie aktivierendes Bild am Tag, und der bekam sein Friedensmuster. Diese Bilder, obwohl durchwegs menschenleer und ereignislos, handelten von der, einer, einer Art Liebe. Und sie hatten sie schon von Kind an durchwirkt, an manchen Tagen weniger, an manchen Tagen als ganze Sternschnuppenschwärme ‒ immer als zuvor tatsächlich, im Vorbeigehen, Erlebtes ‒, an manchem Tag ausbleibend: Un-Tag. Und sie war überzeugt, daß das jedem mehr oder weniger so zustieß. Wohl gehörte das jeweilige Bildobjekt zu eines jeden persönlicher Welt. Aber das Bild, als Bild, war universell. Es ging über ihn, sie, es hinaus. Kraft des offenen und öffnenden Bildes gehörten die Leute zusammen. Und die Bilder waren zwanglos, anders als jede Religion oder irdische Heilslehre. Nur hatte noch niemand so recht von solcherart Bildern erzählen können? Es auch nicht so weltbedeutend wie sie gefunden? Es auch nicht gewagt? (Sie schon gar nicht?)
So scheu, oder bescheiden, war sie in Wahrheit auch bei diesem, ihrem Herzensthema, nicht. Im Lauf der Jahre hatte es sie immer wieder gedrängt, ihre zumindest merk- und denkwürdigen Erfahrungen mit den Bilderfunken oder Funkenbildern zu verbreiten. Gab es das bei einer Frau, nicht nur im Mittelalter, sondern in der Jetztzeit: eine Art von Sendungsbewußtsein? Ständig stärker wurde der Gedanke: sie mußte heraus damit. Und zuletzt hatte es ihr buchstäblich vor Augen gestanden: Jetzt oder nie. Das Phänomen war endlich mitzuteilen, der Welt! Und seltsam ‒ als gehörte das zu ihrer Sendung ‒: bald würde es dafür zu spät sein, nicht bloß für sie, sondern wiederum weltweit. Die Bilder waren am Aussterben, überall unter dem Himmel. Sie hatte sich dem einen oder dem anderen Autor anzuvertrauen, ihm ‒ nein, nicht etwa alles haarklein aufzutischen, sondern dies und jenes anzudeuten, und er sollte frei von dem Problem erzählen. Denn es handelte sich für sie um ein Problem, ein epochales, ein zukunftsentscheidendes, ein endlich fruchtbar zu machendes, vor allem aber ein schönes. Und ein schönes Problem, war das nicht das Ideal für eine Expedition, und so auch eine erzählerische?
Der Missionsdrang war etwas Neues an ihr. Es gab welche, die meinten, er komme aus ihrem Erfolg, welcher schon seit längerem beständig, nicht mehr zu überbieten und, vor allem, ungefährdet war: Missionarstum aus maßlosem Erfolg im Verein mit Gefahrlosigkeit. Andere dagegen fanden die Ursache in ihrem freiwilligen stolzen Alleinsein. Und wieder welche, so zum Beispiel der zuletzt mit der Geschichte beauftragte Autor, vermuteten oder »hatten die Eingebung«, ihr »Rittertum« wolle eine »furchtbare Schuld« umschreiben ‒ unversehens hatte er so bei ihrem ersten Gespräch den Spieß gleichsam umgedreht. »Und von diesem Umschreiben erwarten Sie sich eine Art von Entsühnung?« Keine Antwort.
In der Tat, auch wenn das nicht ihre spezifische Schuld war, hatte sie mit ihrem Bild-Einwirkenlassen im All- und Arbeitstag schon viele Leute getäuscht. Das war kaum je Absicht gewesen. Die Bilder kamen ja nie auf Befehl, sondern, wenn überhaupt, unwillkürlich. Sooft so ein Bild dann aber in sie einschoß, ging von ihr, in der Gesellschaft des Bildes, ein zusätzliches und augenblicks raumfüllendes Strahlen aus. Ihr Gegenüber, der oder die, welche gerade ihre Gesellschaft darstellten, konnten dann gar nicht anders, als dieses Strahlen auf sich zu beziehen. Im Geschäftsbereich fühlten sie sich dann auf der Stelle durchschaut, verloren jeden Hintergedanken und ließen sich ganz auf sie als Partnerin und Kontrahentin ein; folgten ihr, geradezu in dem Sinn von: gehorchten ihr.
Und in der Regel war das auch nie zu des oder der anderen Nachteil ‒ fast immer gewannen sie beide. Die Bild-Wirkung war keine Illusion! Ging es ausnahmsweise schlecht aus, so auch wiederum für sie beide. Es kam dann vor, daß so ein vermeintlich Getäuschter ihr handgreiflich auf den Leib rücken wollte (sie wurde im Geschäft nicht als »Frau« wahrgenommen): und da nun griffen jene Bilder auf die vielleicht merkwürdigste Weise ein in das Geschehen: Angesichts der Bedrohung ‒ nicht bloß einmal auch mit einer Waffe ‒ stellte sich so unvermittelt wie gesetzmäßig ein Bild ein, jeweils nur ein einzelnes, welches dafür aber so stark war, daß es ein Strahlschild zwischen sie und den Angreifer projizierte. Da, ein leerer Sandspielplatz neben einem Kanal von Gent, und der Feind war kein Feind mehr. Da, das Bibliothekshäuschen an der Stadtmauer von Ávila, mit Blick durch die Fenster auf die Vorberge der Sierra de Gredos, und die Angegriffene wurde dem Angreifer unantastbar.
Nicht wenige Schäden, sogar Zerstörungen und Verheerungen, richteten die Bilder, so wurde allgemein erzählt, aber an im privaten Leben. Dort nämlich gaukelten sie, hieß es, gewaltig. Das Strahlen, oder der Glanz, der, mit ihnen zusammen, von ihr, der Frau, ausging, konnte in den Augen des oft zufälligen Gegenüber nur Huld ‒ nein, Versprechen, Bereitschaft, Hingabe sein. Nichts Helleres, Offeneres, Nackteres als das Gesicht dieser mir unversehens zugewandten Fremden in seinem jedes Frauenlächeln übersteigenden Glanz. Begehren, Liebe, Barmherzigkeit: all das in einem. Dann freilich der Rückprall. Der Glanz jedoch blieb. Und das war es, das uns getäuschte Liebhaber entweder zu Rasenden oder zu Kümmerern oder zu beidem machte. Und da Gewalt bei ihr, der Frau!, nicht in Frage kam, mußten Schmähen und Lästern her. »Du hast dein Versprechen nicht gehalten.« ‒ »Du hast mich betrogen.« ‒ »Du führst jeden hinters Licht.« ‒ »Sie ist die Leere und Kälte in Person.« ‒ »Sphinx, die uns mit leuchtenden Augen in den Abgrund fallen sieht.«
Vielleicht liebte sie aber tatsächlich niemanden und nichts? War allein verliebt oder verschossen in das Rätsel jenes einen aus dem Nichts daherschweifenden Bildes, in dem sie jeweils ganz Gegenwart wurde, das sie endgültig ‒ war sie nicht darauf aus? ‒ zu einer Art Königin der Jetztzeit krönte? Und war es denn diesem und jener zu verdenken, daß er oder sie, von ihr im Moment so eines Bilds an der Hand berührt, über die Stirn gestreichelt, am Haarschopf gepackt, mit der Hüfte angeschubst oder gar angeblasen (nicht bloß behaucht), der Frau, die so liebevoll mit ihnen war, verkörperte Verheißung, und sie dann einen Moment später stehen- oder sitzenließ, Treulosigkeit und noch viel Ärgeres nachsagten? Liebe: davon wollte sie jedenfalls nichts hören. Und auch von Freundschaft nicht. Und das war schon seit jeher so gewesen?
Andererseits aber wünschte und wollte sie, daß ihre und unsere Geschichte jetzt in einer Zwischenzeit spielte ‒ in einer Zwischenzeit, da es noch und wieder Überraschungen gab. »In den Haupt- und Staatszeiten, da diese Geschichte nicht spielen soll« ‒ erklärte sie, »ereignen sich bekanntlich ja keinerlei schöne Überraschungen mehr.«
2
Etwas durchscholl jetzt zu Beginn der Buchzeit den vormorgendlichen, zugleich weiterhin mondhellen und da und dort umso finsterer bleibenden Garten in den Waldhügeln am Rand der nordwestlichen Flußhafenstadt. (Es gab Nächte, vor allem im Winter, die nie zu enden schienen; nie mehr würde es auf der Erde Tag werden.) Der Schall war der eines Seufzers gewesen, fast zu verwechseln mit dem in ihrem Büro von dem alten Autor ausgestoßenen.
Wie, Seufzen und »Schallen«? Ein Seufzen, das schallte? Ja. Und es war aus ihr gekommen. Und es hatte sich angehört wie ein arabischer Laut, daherkommend durch die Lüfte, diese nachbildend und verstärkend, gemacht aus nichts als aus a, w, u, h; und jetzt ging ihr auch auf, warum der Schall sie auf dergleichen Gedanken brachte: in dem Arabisch-Sammelband, von ihrer verschwundenen oder geflüchteten Tochter im Haus zurückgelassen und von ihr nun täglich weiterstudiert, war in der Einleitung gerade dieser Laut angeführt als eins der Beispiele, wie im Arabischen oft ein simpler Anhauch oder ein kleiner Ausruf oder eine Kehlkopfvibration oder eben ein bloßes Laut-Werden durch die Transkription zum Wort für den Grund oder die Ursache dieses Lauts werden konnte. Und »awuh«, das war solch ein bezeichnendes Wort. Gemäß dem Kommentar war es der innerste Laut im Menschen.
War der Laut wirklich aus ihr, der Person da, gekommen? Noch nie hatte sich ihrer ein derartiges Seufzen entrungen. Und es erfolgte aus der Dunkelheit darauf nun auch etwas wie eine Antwort. Diese kam aus einem der Bäume, in die schon die frühen Raben eingefallen waren. Bis dahin war von denen höchstens Gebrüll und Gezeter gekommen. Jetzt aber verfielen sie zunächst in Stille. Und aus dieser heraus ließ einer von ihnen einen wundersamen Schmachtruf ertönen. Oder waren das alle die Raben zusammen? Solch ein Bruch mit den üblichen Rabenschreien war dieses Schmachten, daß sie fast laut herausgelacht hätte. So zart war dieses Schmachten, daß sie, die vor nichts Erschreckende, vor ihm fast erschrak. Und sie rief einen Namen. Nein, sie schrie ihn aus sich heraus. Sie wußte dabei nicht einmal, ob es einen solchen Namen oder ein solches Wort überhaupt gab, und was oder wen er bezeichnete. Aber er bezeichnete! Vom Hügel kam ein Echo, und im Haus regte sich ein Schatten. Ein anderer immerstiller Vormorgenvogel wurde Teil des Musters im Gartenportal.
Sie sah es nicht erst heute ‒ aber jetzt, vor der Abreise, wurde es besonders deutlich, wie sich der weite plantagenhafte Garten während ihrer Zeit hier verändert hatte. Vor allem der Boden, die Form und die Gestalt des Untergrunds, war in diesen dabei nicht ganz so vielen Jahren stark umgemodelt worden. (Die Bäume waren sich dagegen ziemlich gleich geblieben.) Zwar war der Garten schon vorher leicht abschüssig. Nur hatte er damals bei ihrem Einzug noch eine plane, auch eigens ausplanierte Fläche abgegeben. Jetzt aber zeigte sich diese Ebene in eine regelrechte kleine Berg- und Tallandschaft verwandelt. Durch den dichtweißen Reif im Gras wurde das rhythmische Muster aus kleinen Hügelzügen und Mulden besonders augenfällig. Eine junge, neue Erdlandschaft, geformt in ein paar Jahren vor allem vom Regen und von den Westwinden. Auf manchen der andeutungsweisen Hügelkuppen stand bürstenhaft schon ein da angewehtes daumenhohes Nadelhölzchen. Die Mulden vertieften sich »schnell«, und manche hatten an ihrem Grund kleine Sumpfstellen mit den zugehörigen Gewächsen. Es gab sogar Moorflecken, auch Winzignaturteiche (samt Frosch und Libelle in den Warmzeiten). Das Wasser konnte da bis über die Knöchel gehen. Nur war es jetzt gefroren bis auf den Grund. Kein Absatz konnte dieses Eis brechen. Nicht nur auf ihm, auch auf den Baumblättern und -nadeln zeigte sich der Reif in der Form kleiner gesträubter stachliger Ringe.
Die einzigen Bäume, die während ihrer Zeit zu den andern dazugekommen waren: eine Maulbeere und eine Quitte. Der Maulbeerbaum war eine Züchtung; ein Stamm ohne Äste ‒ die Zweige wuchsen unmittelbar da heraus und krümmten sich gleichmäßig dicht nach unten und nach innen, Schicht um Schicht, so daß das Gewächs jetzt in der blattlosen Zeit etwas von einem übergroßen Bienenkorb hatte. Zugleich war der Stamm löchrig, mit tiefen und verzweigten Höhlungen, welche als Schlupfwinkel für die Fledermäuse dienten. Im Augenblick hielten sie da ihren Winterschlaf.
Etwas zuckte nun da heraus und flatterte im Zickzack über den Himmel. Eins der Tiere hatte also vorerst ausgeschlafen? Hieß das, daß der Frost brach? Sie wünschte sich dagegen noch weitere Frosttage ‒ auch die frostklare Luft war dafür verantwortlich, daß sie nicht aus der Gegend fortwollte. Oder hieß dieses Fledermausflappen, immer näher an ihrem Ohr: Geh nur, wir passen auf!?
Seltsam, wie sie vor jedem Aufbruch Zeichen witterte. Aber noch nie hatte sie nach den Zeichen so regelrecht den Kopf gewendet wie diesmal. Indem sie ein paar Schritte zur Seite trat, bekam sie den Überblick auf die im einzelnen wie wirre, sehr wechselhafte, als ganze jedoch gleichförmige, sich stetig wiederholende Fledermausflugbahn. Und es wurde dann klar, daß eine Figur in dieser Bahn ihr persönlich galt. Die Fledermaus zeichnete auf ihrem Kreuz-und-Quer-und-Sturz-und-Steigflug haargenau ihren, der Herrin des Anwesens, Umriß nach, an eben der Stelle, wo sie ein paar Augenblicke zuvor gestanden hatte.
Zeitlebens war sie so von Tieren umgeben gewesen. Insbesondere die als scheu geltenden kamen ihr nahe; benutzten sie als eine Art Asyl- oder Ausruhzone. Es wurde erzählt, als junges Mädchen sei sie mit einer Schlange unterm Hemd von Afrika über mehrere Grenzen, samt Schiffs- und Buspassagen, heimgereist. Sie selber erzählte lieber von weniger kribbligen Berührungen und Begegnungen ‒ zum Beispiel von der Teichuferratte, die ihr irgendwo in einem großen Wald in einem Rhythmus von schnellem Vorstoß und ebensolchem Rückzug unter Geschnüffel und schwarzem Geäugel so nah kam, daß das Tier schließlich mit Barthaar und Fell ihre Zehen streifte: jetzt noch wischte ihr manchmal etwas davon über die Haut. Oder die Libelle über dem Zwergtümpel hier im letzten Sommer: sie, der große Mensch, stand da, stand da schon seit einiger Zeit, ohne Bewegung, und dann stand da auch das kleine Flugwesen, die Libelle, ihr gegenüber in der Luft, ziemlich hoch für eine Libelle, die sonst eher nah der Wasseroberfläche verharrte, die beiden Flügelpaare so heftig im Betriebswirbel, daß sie unsichtbar blieben und dem Anschein nach allein der spindelige Körper im Raum verharrte, mit dem überdimensionalen Kopf vorne, blauschwarz, in dessen Mitte ein gelber Kreis, das Libellengesicht ausfüllend, und, obwohl dieses Gelb doch gar nicht die Augen bezeichnete, sie, den Menschen, anschauend: tiefgelbes, ihr mit jedem Augenblick näherrückendes und sie zuletzt mit sich, dem fremden, dem Libellenplaneten, überstülpendes Geschau. Etwas zum Fürchten also? Nein.
Dem Autor in seinem Manchadorf würde sie andeuten, auch die Geschichten zwischen manchen Tieren und ihr hätten mit dem Bildersinn zu schaffen. Vor allem die scheuesten Tiere erkannten (ja, »erkannten«), wenn jemand »im Bild«, ganz im Bild, ganz bei sich im Bild war. Vor so einem verloren sie nicht bloß ihre Scheu. Sie bezogen ihn, wenn auch nur für den Augenblick, doch was für einen!, ein in ihr Dasein. Nicht nur, daß sie keine Angst mehr vor ihm hatten: sie wollten ihm, ein jedes auf seine Weise, gut.
Anders als die Zuchtmaulbeere war der Quittenbaum jetzt in der ehemaligen Obstplantage am Rande der Flußhafenstadt ein Gewächs wie all die Quitten, oder kwite, seinerzeit in dem wendischen Dorf. Heute so wie vor Zeiten, da wie dort, wuchs der Stamm des Nationalbaums ihres einstigen Dorfs gleich schmal und gerade, ging auf kleiner Leiterhöhe über in das Gewinde der Äste, und in der immerniedrigen Krone zwirbelte sich ohne Stamm und Ast das Zweigdurcheinander auf, und da wie dort hingen im Winter verläßlich mehrere schwarzverschrumpelte Früchte aus dem Vorjahr und den Vorjahren des Vorjahrs im Baum. Und auch der Amselumriß daneben gehörte seit jeher dazu, ebenso wie, als das von altersher Dritte, wiederum knapp daneben, das leere zerschlissene Vogelnest. Gellendes Klagen jetzt, der ihrer Kinder beraubten Vogeleltern, rund um das Nest, während im Gras darunter die fremde Katze lief, zuckende Flügel im Maul. Nein, das war im letzten Sommer gewesen, oder vor mehreren Sommern. Und es wird im nächsten Sommer wieder geschehen.
Und ‒ war das jetzt? ‒ der aus dem Unterholz (ihr Garten war davon umgeben) auf sie zurennende Igel, qunfuth!, wie sie ihn unwillkürlich anrief, »Igel« auf arabisch. War das das Igeljunge vom letzten Herbst? Es war es. Und es hatte die Monate als Waise, allein, nicht nur überlebt, sondern war auch, schlafend unter dem gärenden warmen Kompostlaub, groß geworden, fast ein Riesenigel. Auf ihre Anrede hielt dieser inne, trippelte dann umso schneller auf sie zu, vollkommen zielbewußt, stupste sie mit seinem gummiharten, ziemlich kalten schwärzlichen Rüssel an und sagte: »Geh nicht fort. Der Garten ist so öde ohne dich. Ich möchte im Schlaf deine Schritte hören.« Er war aufgewacht, nur um ihr das mitzuteilen, und zwängte sich danach schleunigst wieder unter seinen Laubhaufen.
Seine Mutter, oder war es sein Vater gewesen?, hatte im vorigen Sommer während einer ganzen Woche jeweils am hellen Mittag, sonderbar für einen Igel, ohne Scheu das Anwesen umkurvt, zuerst bloß leise piepsend, am letzten Tag aber mit einem zunehmend schrillen Pfeifen. Am Ende hatte der Igel seinen Rundgang gestoppt auf einem Weg, der ausgelegt war mit Steinplatten. Das Tier lagerte sich an diese von der Julisonne beheizte Stelle, wurde aber nicht still, sondern pfiff noch inständiger, den Kopf weit aus dem Stachelpanzer gereckt. Pfeifen, das zu Trillern wurde, schriller als jede Alarmanlage oder Polizeisirene. Trillern, das zu Schmettern wurde. Bis zum äußersten aufgesperrtes Igelspitzmaul, und trotz ihrer, der Frau, Hand auf dem Igelgesicht keine Andeutung eines Rückzugs. Schmettern, sich steigernd zu einem Bombenalarmdröhnen ‒ dabei ein so kleiner Körper, ein so winziges Gesicht! Schließlich der Luftsprung des Schreiers, mit den vier Beinen mehr als eine Handbreit über dem Boden, und jetzt noch so ein Satz, schräg in den Raum, zumindest gleich hoch. Sichstrecken des Igels wie zum Schlaf auf den besonnten Platten. Wegstrecken der Füße, Vorstrecken der Schnauze auf dem Stein. Und kaum einen Augenblick später sein Stacheloval bespickt mit blauschillernden Fliegen, von denen schon zuvor ein paar die zuckende Nase umschwirrt hatten; die Stacheln im jähen Tod nicht mehr geordnet, sondern kreuz und quer. Und fast zugleich auch das aus dem Unterholz tappende Igeljunge, kaum apfelgroß, die soeben verreckte Mutter oder den soeben verreckten Vater kurz beschnuppernd und schon wieder verschwunden im hohen Gras. Und auch das Schreien des Vaters oder der Mutter sagte ihr jetzt: »Geh nicht fort. Schütze mein Junges.«
Auf ihren Reisen in Asien waren ihr immer wieder die Bilder vom Tod des Buddha untergekommen. Regelmäßig war er dabei umringt gewesen von Tieren. Und ein jedes dieser Tiere stellte auf den Bildern eine besondere Spezies dar; es gab in der Schar rund um den Leichnam fast jedesmal nur einen einzigen Vertreter einer bestimmten Tierart, 1 Pferd, 1 Hahn, 1 Büffel. Fast unzählige solcher Einzeltiere beweinten den toten Buddha, der jeweils ihr eigener Toter, ihr Angehöriger, ihr Geliebtester war. Und sie betrauerten ihn, so ließ es das Bild spüren, lauthals, ein jedes das Maul, die Schnauze, den Schnabel aufgerissen nach seiner Art. Und die Tiere da, der Elefant, der Tiger, die Hyäne, die Ziege, der Ochse, die Krähe, der Wolf, weinten sämtlich leibhaftige Tränen. Nicht bloß spürbar wurde ihr Klagen, sondern auch hörbar, und nicht bloß im sogenannten inneren Ohr. Und am hörbarsten wurden dabei gerade die sonst als stumm geltenden Tiere. Seinen Jammer heraus schrie der Regenwurm. Es hob den Kopf der Fisch aus dem gleich angrenzenden Stillen und/oder Indischen Ozean und brüllte. Wie aus der tiefsten Erdspalte dringendes Schluchzen der sonst kaum zu einem Pieps fähigen Wildtaube. Und sie, die Betrachterin, war mit im Bild. Sie entzifferte.
Von ihren Nachbarn dagegen gab es nichts zu entziffern? Hatte sie überhaupt Nachbarn? Ja, aber deren Häuser waren derart entfernt von dem ihren, ursprünglich eine Kutschenstation samt Herberge, später Mittelpunkt einer der seinerzeit in der Flußhanglage häufigen Obstplantagen, daß von den Bewohnern höchstens ab und zu ein Umriß hinter Bäumen wahrnehmbar wurde, jenseits der Stadtausfahrtsstraße. Sie hatte mit der Zeit ihre Arbeit mehr und mehr bei sich zuhause getan. Nur: von den Nachbarn zeigte sich ihr da eher noch weniger als je zuvor.
Und das lag nicht an ihr. Sie bewohnte nicht nur das eigene Haus und den Garten, sondern auch die nähere Umgebung. Vor allem des Nachts streunte sie durch den dicht besiedelten Stadtrand, durchstöberte sie die Hügelwälder. Und zunehmend zog es sie dorthin, wo die Menschen waren. Bloß bekam sie die, und nicht allein in der Nachtdunkelheit, kaum je zu Gesicht. Obwohl sie, ohne besonderes Verkleidetsein, sich verkleiden konnte bis zur Unscheinbarkeit oder gar Unsichtbarkeit, wurde sie von ihrer Bevölkerung gemieden? Nein, diese schloß sich von vornherein, auch untereinander, ab. Jedes Haus bildete einen vielfach abgesperrten und abgeschirmten Bezirk. Die Neuhinzugezogenen (es kamen immer mehr), anfangs noch unbekümmert laut, bei offenen Fenstern ‒ endlich waren sie weg von den Mietwohnungen, zwischen eigenen Wänden ‒, dämpften bald sowohl Stimmen als auch ihre Schallmaschinen, und inzwischen ließ kaum jemand weit und breit noch einen Mucks hören. Einzig der Stadtrandidiot, anders als einst der Dorftrottel frech und geradeaus, schrie, sang und pfiff auf den nicht bloß nachts fast menschenleeren Straßen.
Erst in den letzten Jahren war die Gegend so still geworden (bis auf die eine Stunde am Arbeitsmorgen und die eine vor Feierabend). Manchmal herrschte dann so etwas wie eine Vor- oder Nachkriegsstille. In der Regel aber strahlte die schweigsame, dabei gut ausgeleuchtete Ränderlandschaft einen atmenden Frieden aus. Vor allem war das dem einen und anderen der alten Bewohner zu verdanken. Oft waren das Handwerker, und oft übten die ihren Beruf, obwohl längst zum Ruhestand berechtigt, weiter aus, ein siebzigjähriger Schuster, ein fünfundsiebzigjähriger Maurer, ein achtzigjähriger Gärtner. Wohl annoncierten sich in allen Sparten Jüngere und Modernere. Da diese aber fast immer ganz woanders ihren Firmensitz hatten, werkten die Alten hier, besonders bei kleineren Sachen, fort und fort. Sie machten ihre Sache auch besser, und es war auf sie eher Verlaß ‒ nicht etwa, weil sie die Älteren und Erfahreneren waren, sondern weil sie ihren Sitz und auch ihr Wohnhaus an Ort und Stelle hatten, eine Straße oder eine Ecke weg von der jeweiligen Arbeit oder dem Auftraggeber; sie konnten sich Pfusch und Halbheiten nicht erlauben.
Ob Handwerker oder Sonstige: diese Alten, auch wenn sie nicht den Mund auftaten, waren wandelnde oder auch schon halb in die Flechten der Obstbäume, die Schuhlederteile und lehmgelben Schaufeln übergegangene Abenteuergeschichten. Sowie sie einmal ins Reden kamen, war auch tatsächlich die ganze Welt der Fall. Schon recht, daß man die Traum- und Geistererzählungen in Tibet oder die Wüstenwanderlieder der Tuareg sammelte: aber warum hatte niemand ein Ohr für die Epen und Sprechgesänge dieser alteingesessenen oder einst mit ihren Eltern aus anderen Ländern hierhergewanderten oder -geflüchteten Stadtrandleute? Kamera, Film, Video, Mikrophone auch für sie. Denn sie wurden zusehends weniger: die Hand, die dort in der letzten Woche die Läden schloß, wird diese endgültig geschlossen haben; versäumte Sage, versäumte Klage, versäumtes Liebeslied; selbst die versäumte kleine Andeutung ‒ was für ein Versäumnis.
Auch von den Neuzugezogenen, mochten die sich noch so in ihre Häuser verriegeln, erfuhr sie mit der Zeit einiges. Das geschah immer beiläufig, im Vorübergehen. Gerade ihr Schattendasein nach außenhin schuf den Hintergrund. Sie wollten sich um nichts in der Welt verraten. Nicht einmal zu ahnen sollte sein, wer sie waren, was sie taten, wie sie hießen, woher sie kamen. Mit ihnen begann eine neue Epoche. Wurde einmal, hinter geschlossenen Fenstern, kurz ein Klavierspiel laut, so brach dieses jeweils gleich wieder ab. Nirgends eine im Freien aufgehängte Wäsche, und wenn, dann unerkennbar hinter den dicken Hecken. Selbst die Fahrzeuge verschwanden tief unter die Erde, in Garagen noch unterhalb der Keller.
Und trotzdem blieben ihre Geschichten nicht ganz verborgen. Bruchstücke oder Partikel davon durchstießen von Zeit zu Zeit, und jedesmal unvermittelt, die Verschweigemauern. Ein einziges Elementarteilchen, heranschießend aus oft unbestimmbarer Ferne, genügte, und eine Situation brannte sich ein. Eine Situation? Eine ganze Geschichte, klarer und einleuchtender, als wäre diese von Alpha bis Omega erzählt worden.
Derartiges geschah mehr in den Nächten, und am häufigsten in der tiefsten Nacht, in den Stunden nach Mitternacht. Einmal wurde man geweckt von einem gewaltigen Klagen. Oder: was sich zunächst als ein zorniges Schreien anhörte, als ein Anbrüllen auf offener Straße, ging dann über in Klagen. Es war eine Frauenstimme, respondiert ab und zu, kurz, von der beruhigenden oder beruhigenwollenden eines Mannes. Und es handelte sich um etwas Ernsteres als einen bloßen Streit. Es ging um ein Ende; es waren das, es wurden das allmählich Sterbelaute. Zuletzt wurde das im einzelnen unverständliche Klagen geradezu zart. Nirgends, auch in keiner Oper, hatte sie je einen so innigen Klagegesang gehört. Die Stimme des Mannes, weiter gewollt ruhig, antwortete jetzt nicht mehr, sondern untermalte satzweise das Lied; verschwand schließlich aus dem Tonbild. Pause. Autotürschlagen. Abfahrtgeräusch. Stille. Und wiedereinsetzend die Klage, zugleich ausblendend, wie von jemandem, der langsam rückwärts geht. Wucht des nächtlichen Schweigens dann, entsprechend der Wucht des verstummten Klagens. Und sie war nicht die einzige in dem Umkreis, die horchte, und horchte, und horchte. Keine Ambulanzsirenen dann aber. Und am folgenden Morgen auch kein Leichenwagen; nur eine wunde Leere auf der Straße, und in dem Haus dort drüben, oder war es das dort dahinter gewesen? Und keiner der Nachbarn, der darüber ein Wort verlor.
Und noch so eine Nachmitternacht. Wachliegen. Sie lag manchmal, besonders wenn es ein Arbeitsproblem zu lösen gab, gerne wach. Und wieder eine Stimme. Diesmal aber ganz aus der Nähe. Und sie erkannte diese Stimme auch, obwohl sie so anders klang als üblich. Und sie verstand außerdem Wort für Wort, was da gesagt wurde. Die Stimme war die eines Heranwachsenden, die des Sohnes der Leute, denen sie das ehemalige Pförtnerhäuschen, eine umgebaute Remise, am Eingang ihres Grundstücks vermietet hatte. Obwohl es Teil des Vertrags war, daß die Mieter in der Tat nebenbei eine Art Pförtnerdienst versahen, hatte sie kaum etwas über die kleine Familie herausbekommen. Sie erfuhr nichts vom Beruf des Mannes oder der Frau, und ebenso nicht, wo der Jugendliche zur Schule ging, und ob überhaupt. Er grüßte sie nicht; schaute weg, wenn er sie sah. Anders als die Eltern mißachtete er die Grundstücksschwellen, die sichtbaren wie die unsichtbaren. Das zweite Tor da, den Übergang zu ihrem höchsteigenen Bereich ‒ das sie aber unverschlossen ließ ‒, benutzte er wie selbstverständlich für seine Abkürzungen an ihrem Anwesen vorbei und quer durch einen Heckenschlupf zu einer ihm anscheinend wichtigen Nebenstraße. Einmal hatte sie ihn sogar in ihrer Küche angetroffen (selbst das Haus sperrte sie in der Regel nicht ab), wo er am Tisch saß und Zeitung las; bei ihrem Erscheinen wortlos-gemächliches Sich-Trollen durch den ehemaligen Dienstboteneingang.
Nah war auch die Pförtnerei nicht, ganz und gar nicht: und doch hatte sie in jener Nacht die Stimme des Sohns von dort traumnah im Ohr, und auch so klar. Es war freilich kein Traum. Und der Nachbarssohn sagte folgendes: »Ihr wollt, daß ich tot bin. Danke für die Knochen in den Käfig. Ihr werdet mich nie mehr wiedersehen. Mein Bett bleibt leer. Danke für die Blumen auf das Grab. Laßt mich aber wenigstens noch eine letzte Kassette spielen. Warum wollt ihr mich nicht? Warum hast du mich nicht abgetrieben? Warum hast du mich nicht in den Ofen gesteckt? Oder in die Kiste mit dem doppelten Boden? Brennend heißer Wüstensand. Euer Euch liebender ‒«. Stille dann auch hier. Leere am nächsten Morgen. Und am übernächsten Morgen der Halbwüchsige wie eh und je, nur statt auf dem Fahrrad auf einem Moped.
Und noch so eine Nacht, diesmal früher. Ihr Heimkommen von der Bankzentrale unten am Fluß, vor Mitternacht, im spanischen Landrover, einer Art Tarnfahrzeug (es hätte dazu gepaßt, würde sie es verschleiert chauffieren). An der schon leeren Stadtausfahrtstraße, bei der Abzweigung zu ihrem nahegelegenen Anwesen, eine einsame Gestalt, die Handzeichen gab. Angehalten. Eine sehr junge Frau, eher ein Mädchen, etwa im Alter ihrer Tochter, wie vom Körper getrenntes Gesicht, in der Stadtrandbeleuchtung: »Wissen Sie nicht ein Haus für mich im Ausland, am besten in Nordafrika? Ich habe so viel von dem Licht dort gehört. Ich muß weg von hier. Ich bin älter, als ich wirke. Ich kenne Sie. Sie malen doch, oder? Wie kann man nur in der Gegend hier, in dem Land hier, malen? Ein Haus zum Malen für mich, in Tipasa oder Casablanca, jetzt gleich!« Und ohne die Antwort abzuwarten, verschwand das Mädchen in ein seitliches Dunkel. Und auch es kam ihr danach wieder unter die Augen: an einer fernen Dachluke sitzend und lesend, als sei nichts gewesen.
Selbst die Kinder dieser in den letzten Jahren immer häufiger Neuhinzugezogenen ‒ an den Haustüren höchstens Initialen, und dann oft solche, die auch zu einem griechischen, kyrillischen oder gar zu einem arabischen oder armenischen Alphabet gehören konnten ‒ blieben im Schatten. Wie vermummt und stumm stiegen sie neben ihren vermummten stummen Eltern oder Betreuern aus den überdimensionalen Autos und waren zu verwechseln mit den nach Feierabend in die Häuser geschleppten Großeinkäufen aus den Großmärkten (in den immer noch zahlreichen Einzelhandelsläden und auf den Märkten der Gegend kauften nur die Alten und Alteingesessenen ein, kaum je dort ein unvertrautes Gesicht, schon gar nicht das eines Kindes).
Auf dem Heimweg von der Schule ging fast immer ein jedes allein, den Blick zu Boden gesenkt, wie um unkenntlich zu bleiben. Und trotzdem prägten auch sie sich ihr früher oder später ein, nachdrücklicher als die Nachbarkinder damals im Dorf ‒ da war sie freilich selber noch Kind mit zu Boden gesenktem Blick gewesen? Und immer geschah das, wenn sie ein Weinen hörte. So ein Weinen konnte von noch so weit her kommen: ein jedesmal erhob es sich ihr aus der Nachbarschaft. Und sie hörte es am Tag, auch in den Lärmstunden der Ausfallstraße, genauso klar wie in den lautlos tiefen Nächten. Nicht jedes Weinen kam so nahe, ging so nach: kaum das, und noch so jämmerliche, der Säuglinge, und auch nicht das in der Folge eines Sturzes oder sonst eines körperlichen Mißgeschicks. Es war jenes Weinen, meist tränenlos, der ersten großen und dabei auch schon endgültigen Enttäuschung; gleichmäßige, nicht zu der Brust herausstrebende, sondern in sie eingeschlossene, geradezu ruhige Töne, eine fast schon wieder stillgewordene Mittellage aus Schluchzen, Aufheulen, Gewimmer, Röcheln, Schniefen, über einem tiefen, namenlosen Grundton, und das immer so weiter in einer Endlosschleife, auf der Stelle, hinter den versperrten Läden eines Hauses, hinter einem Gartenbaum, oder irgendwo auf einer Straße, einem Seitenweg, dahinziehend, eine Einpersonenkarawane.
Sie, als Zuhörerin, blieb dann gebannt auf der Stelle und zog zugleich mit der Karawane draußen mit. Das, was sie da von den Nachbarkindern hörte, das war der Laut der Verlassenheit. Er konnte genauso, in ebenderselben Tonlage, in einem Erwachsenen, gleich welchem?, ja gleich welchem, Laut werden. (Nur wirkte das bei einem Großen vielleicht so schneidend, daß der von seinem eigenen Wehlaut geköpft und gevierteilt würde?) Man selber war schon mit solch einem Verlassenheitslaut herumgegangen, einmal, vor langer Zeit. Und er steckte auf Dauer in einem. Zwar war er in den totesten Winkel des Leib-Körper-Labyrinths gesunken. Doch früher oder später würde er, von einem Moment zum anderen, neu den Platz in der Mitte einnehmen, mit der Gewalt einer Explosion. Sie hatte einmal einen Film gesehen, an dessen Ende eine Frau, etwa viertelstundenlang, nichts als geweint hatte. Sie saß da in einem leeren Stadion oder Park oder Rohbau und weinte plötzlich, tränenlos, wie hier die Kinder, und weinte und weinte. Zwischendurch wurde sie still. Dann weinte sie weiter, verstummte noch einmal, und gleich aber hob in ihr wieder das Weinen an, und ging so weiter, ein Weinen schließlich wie von Tausenden, das Weinen des Weinens, bis zum Schluß. (Der Autor, dem sie das andeutete, erzählte, er habe als Junger einmal ein Theaterstück geschrieben, das aus einem einzigen Satz oder einer einzigen Regieanweisung bestand: »Jemand sitzt auf der leeren Bühne und weint, eine Stunde lang.«) Sie selber hatte schon seit langem nicht mehr geweint. Aber zuzeiten hörte sie noch ihr Weinen von viel früher her.
Mehr und mehr waren zu ihr in der letzten Zeit von den unsichtbaren Kindern der Nachbarschaft solche Laute der endgültigen Verlassenheit oder Ausgestoßenheit gedrungen. Zumindest eins der Kinder sah sie dann auch. Es war an einem Frühlingsabend, schon bei Sternenhimmel klar über Wald und Stadtrand. Das Kind ging am Sportplatz vorbei heimwärts, allein. Auf dem Platz erloschen gerade die Lichter. Neben der Straße eine Reihe blühender Zierkirschen. Das Kind darunter, gesehen von hinten, fast groß, längst im Schulalter. In gleichmäßigen Abständen so im Gehen ein Schulternzucken, nacheinander unter der im Straßenlampenschein, samt umgebender Dunkelheit, besonders farbkräftigen Baumblüte. Das ständige Achselzucken ist ein Weinen, der dazugehörige Laut trotz der Nachtstille kaum wahrnehmbar, aber, hat sich das Gehör einmal darauf eingestellt, von keinem Flugzeuggedröhn oder Zugräderklirren zu übertönen. Und so ging das Rückenbildkind unter Achselzucken weinend dahin bis jenseits der Baumreihe und der Sportanlage. Wer würde einmal den Laut der Verlassenheit erzählen?
Man wußte sich gerade diesen Unbekannten und kaum Sichtbaren benachbart. Oft nahm man aus der Ferne nicht einmal deren Umrisse oder Silhouetten wahr, sondern inmitten der allgemeinen Finsternis bloße kleine weiße, nein, fahle Flecken: ihre Köpfe, ihre Gesichter, ihre Hände. Auch ihre Berufstätigkeiten bildeten solche fahlgrauen Flecken; blieben bei sämtlichen der Neuansässigen geheim; wurden von ihnen eigens verschwiegen?; was jemand tat, zählte nicht mehr; und die Kleidung verriet nichts: und all das verstärkte ihr Nachbarschaftsgefühl sogar noch. Klar war nur, daß keiner von den Leuten da zu ihrer Kundschaft gehörte. Oder? Waren sie nicht für jede Überraschung gut?
Daß sie andererseits auch über sie nicht im Bild sein konnten, das brachte ihr die Neubevölkerung noch um eins näher. Zwar lag ihr Anwesen, das einstige Kutschen-Relais, an einer besonderen Stelle, dort wo die große Steigung der Stadtausfahrtstraße anhob (früher war da mindestens ein Pferdepaar dazugespannt worden). Zwar war es auffällig allein schon durch sein Alter, seine Größe, seine Bauweise, seine Form, seinen Abstand zu den sonstigen Häusern. Aber niemand, nicht einmal die Pförtnerhäuschenleute, wußte Genaueres über seine Bewohnerin. Man wollte auch nichts von ihr wissen.
Nur einmal, in einem indischen Restaurant um die Ecke, wurde sie von dem Inhaber gefragt, ob sie eine Filmschauspielerin sei. Und ein andermal, in dem nahen chinesischen Obst- und Gemüseladen, von dem uralten, dabei gerade erst zugezogenen Ladenmieter: »Sind Sie nicht als Kind in Macao gewesen?« ‒ »Wann?« ‒ »Vor fünfzig Jahren.« Vor fünfzig Jahren! In Macao! Es war, als übertrage der Chinese so einen Teil seiner Jahre auf sie und werde dabei wirklich und augenblicklich jünger. Oder kam das wieder von der sprichwörtlichen asiatischen Neugier? Die in der Regel eher gespielt war? Die Sonstigen hier jedenfalls spielten nicht einmal die Neugier. Und das hieß, in Abwandlung einer stehenden Wendung der Relaisinsassin und Geldexpertin (statt »Ich will nicht« oder »Du darfst nicht« sagte sie jeweils: »Es kommt nicht in Frage, daß«): es kam nicht in Frage, daß hier Spezielles oder Intimes voneinander gewußt wurde.
Überhaupt erschien ihr die Gegend als Beispiel für eine neue Lebensart. Daß einer sich derart im Abstand zum anderen hielt (es war dabei ganz und gar keine Villengegend), bedeutete ja nicht, daß es zu Ende war mit der Nachbarschaft. Ohne das eigens zu zeigen, achtete man aufeinander; respektierte man einander. Im gegebenen Moment, und nur da, wäre man zur Hand und zur Stelle; danach gleich wieder im Abstand, namenlos, und nach einer kleinen Grußzeit auch wieder grußlos.
In einer Hinsicht kam sie sich im Vergleich mit den neuen Nachbarn sogar unzeitgemäß vor (und es kam nicht in Frage, daß sie, die Bankfrau, unzeitgemäß war): die Mehrheit der Neuleute zog inzwischen nicht mehr in eigene Häuser ein, sondern in für ihresgleichen, die in ein paar Jahren woanders hinziehen würden ‒ es gab zur Zeit dieser Geschichte fast nur noch ihresgleichen ‒, von den sie beschäftigenden Unternehmungen, Gesellschaften, Firmen, Instituten, Korporationen, Laboratorien überlassene Wohnkontingente (welche auch aus von der Zentrale aufgekauften Altbauten bestehen konnten). Eine zunehmende Zahl ihrer Nachbarn war, im Gegensatz zu ihr, kein Hauseigentümer mehr. Auch die Autos waren Firmenwagen oder gemietet. Das gleiche galt für die Geräte, einschließlich Fernseher und Baumsägen. Nichts, jedenfalls nichts Großes, Schweres, oder Verantwortung Beanspruchendes gehörte ihnen.
Und sie beneidete sie inzwischen fast dafür; oder, eher, war auf sie eifersüchtig, so wie es in Frage kam, eifersüchtig zu sein, als mitgehender Zuschauer, auf ein Spiel, dessen Akteur man gern selber wäre. Denn das Vergnügen, das sie lange gehabt hatte im Bewußtsein der Eigentümerschaft, war es nicht so ziemlich verbraucht? Vor allem, Land zu besitzen, das hatte ihr einmal ein ganz spezielles Raumgefühl, im Sinne von verbreiterten Schultern, gegeben. Noch ein Stück Grund dazukaufen zu ihrem eigenen, und wieder eines: Freude. (Sie gebrauchte vor dem Autor tatsächlich das Wort »Freude«.) Erhobenen Hauptes seine Besitztümer abgehen (um nicht zu sagen »umreiten«). Inzwischen freilich ging man diese eher mit gesenktem oder prüfendem Blick ab: was war daran zu tun? welche Arbeit stand daran aus? was war zu reparieren? zu reinigen? zu ersetzen?
Frei durch Eigentum? Bei ihr wenigstens bedrohte es mit der Zeit die Freiheit. Das Wahrnehmen wurde dadurch unfrei. Nur noch Teile, und Teilchen, und nichts Ganzes mehr. Und man selber, als Eigentümer, keine Ganze mehr. Ein Ausweg, eine Befreiung war seltsamerweise der Umgang mit Geld, mit dem Geld der andern, aber auch dem persönlichen ‒ so als habe das Geld, als bewegliches Gut, nichts zu schaffen mit »Eigentum« und erlaube ein freies Spiel wie das der andern im Umkreis. War dieses Spiel in der Zwischenzeit nicht ein besonders unkontrollierbares, kaum mehr Regeln gehorchendes, gefährliches geworden, bedrohlich nicht bloß für sie?
Einige der neuen Lebensformen hatten auch mit der Lage ihrer Stadt zu tun. Nach einer Zeit des Niedergangs der Flußhäfen waren diese wieder am Blühen. Zuvor gab es eine Periode ganz ohne Schiffstransporte; leer auf dem ganzen Kontinent die Flüsse und Ströme. Jetzt aber dienten die Wasserstraßen als die modernsten Verkehrs- und Lieferwege, und die an ihnen gelegenen Städte wurden Zentren wie noch nie in der Geschichte, nicht einmal im Römerreich. Und ihre Stadt, am Zusammenfluß gleich zweier Ströme, bildete etwas wie ein Zentrum der Zentren. Wie seinerzeit Augsburg mit den Fuggern, vor allem dem Patriarchen Jakob, ein Finanzzentrum ‒ aber weniger des Reichtums als des Schaltens und des Waltens. So ein Leben an und zwischen zwei welt- wie geldbedeutenden Flüssen schuf bei den Bewohnern, bei den Frischangekommenen stärker noch als bei den Altinsassen, einen speziellen Ortssinn: geprägt von Selbstbewußtsein oder gar Stolz, einem von dem, sagen wir, in New York oder in einer Metropole sonstwo nah am Meer recht verschiedenen, gleichsam einem Binnenland-Stolz.