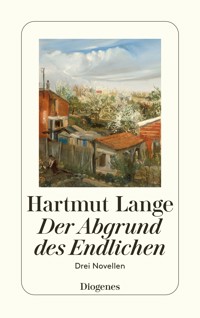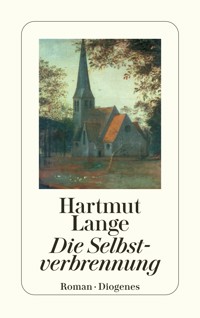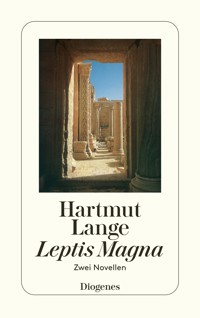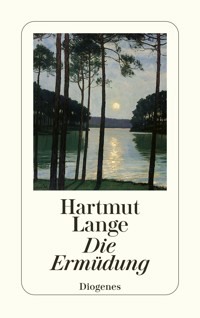15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hartmut Langes Geschichten spielen in München, einer Kleinstadt bei Hamburg, an der Ostseeküste, an der rauhen Nordwestküste Englands. Und immer wieder in Berlin, wo sich Vergangenheit und Gegenwart besonders augenfällig durchdringen. Acht taghelle, geheimnisvoll verdichtete Erzählungen, die prekäre Gemütszustände darstellen und kunstvoll auffangen: trügerische Glücksversprechen, unerfüllbare Sehnsucht, die Not einsamer Menschen, die Berührung mit dem Bösen, die Angst zu versagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hartmut Lange
Der Blickaus dem Fenster
Erzählungen
Umschlagillustration:
Félix Vallotton, ›Bois du Bologne‹, 1919 (Ausschnitt)
Copyright ©Christie’s Images Ltd./ARTOTHEK
Alle Rechte vorbehalten
Copyright ©2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 06953 2 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60694 2
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Ich bedanke mich für die Mitarbeit meiner Frau
[7]Inhalt
Der Blick aus dem Fenster[9]
In der Karlstraße[23]
Der Abschied[39]
Das Böse[49]
Nochmals: Das Böse[57]
Die Begegnung
[9]
[11]Kennt man das Gemälde von Gustave Caillebotte aus dem Jahr 1875? Man sieht eine Balustrade, dahinter, die Fensterflügel sind weit geöffnet, einen Platz. Genauer: Hier treffen mehrere Straßen zusammen, und da eine Häuserfront etwas zu sehr ins Zentrum hineinragt, ist die volle Sicht versperrt. Im Vordergrund steht ein junger Mann, hochaufgerichtet, die Hände in den Hosentaschen, wie in Gedanken versunken da, und in seinem Rücken erkennt man das plüschige Inventar des Zimmers: Ein mit Samt bezogener Stuhl und ein geblümter Teppich vermitteln den Eindruck von Gediegenheit. Das Gemälde zeigt ein Motiv aus dem klassizistischen Paris, und es dürfte schwierig sein, etwas Vergleichbares in Berlin zu entdecken, auch wenn man im Zentrum dieser Stadt, etwa in der Taubenstraße oder am Gendarmenmarkt, wohnt, wo die Häuserschluchten ähnlich strukturiert sind. Aber Giselher Reinhardt hatte alles Recht, nachdem er den Caillebotte in einem Bildband entdeckt hatte, zu behaupten, dass es von seinem Zimmer aus, wenn [12]das Fenster geöffnet war, einen ähnlichen Ausblick gab.
Zugegeben: Bei Caillebotte sieht man zwei, drei Kutschen, und die Passanten, die den Platz überqueren, tragen lange, bis über die Knöchel reichende Kleider oder Mäntel. Dies und anderes mehr unterschied sich wesentlich von der Hektik des Verkehrs, die Reinhardt vor Augen hatte, und dass auf den Bürgersteigen tagsüber auch noch ein Gedränge herrschte, hinderte ihn daran, das Fenster zu öffnen. Aber nach acht Uhr abends, ja dann schon, begann es ruhiger zu werden, und Stunden später konnte es vorkommen, dass Reinhardt von dem Eindruck nicht loskam, er sähe, wie auf dem Gemälde von Caillebotte, statt der Autos, die den Platz überquerten, tatsächlich einige Kutschen.
Darüber musste er lächeln, und nachdem er das Fenster geschlossen und die Vorhänge zugezogen hatte, war das, was er einer flüchtigen Verträumtheit zurechnete, wieder vorbei.
Giselher Reinhardt war Ministerialbeamter, und was man beobachten konnte: Er verließ jeden Morgen seine Wohnung. Sorgsam schloss er die Tür ab, achtete darauf, dass der Fahrstuhl leer war, wenn er ins Parterre hinabfuhr. Er ging bis zur Friedrichstraße, die er überquerte, und nachdem er die Glinkastraße erreicht hatte, bog er nach rechts ab, [13]um an der Ecke Unter den Linden im Café Einstein einen Espresso zu trinken. Dann, nachdem er gute zehn Minuten an der Theke gestanden hatte, verließ er das Café wieder, ging weiter in Richtung Mittelstraße und darüber hinaus bis zur Dorotheenstraße, und wenn er die stark befahrene Wilhelmstraße hinter sich gelassen hatte, betrat er das Regierungsviertel mit den Ministerien, jene Häuserschlucht aus dunklem Granit, die kalt und abweisend wirkte und die mit gläsernen Brücken versehen war, auf denen tagsüber ein geschäftiges Hin und Her herrschte. Hier hätte man, sozusagen als Passant von der Straße aus, ohne weiteres auch Giselher Reinhardt begegnen können. Im Inneren des Gebäudes aber blieb er so gut wie unauffindbar, und erst gegen Abend, meist nach neunzehn Uhr, verließ er das Regierungsviertel, um diesmal die Friedrichstraße entlang direkt bis zur Taubenstraße zu gehen.
Ja, Reinhardt war, was sein Privatleben anging, beinahe selbstlos. Für ihn galten ausschließlich alle Absprachen, alle Verpflichtungen, die er dem Ministerium gegenüber, in dem er arbeitete, eingegangen war. Dies nahm seine Zeit in Anspruch, damit war er, wie man so sagt, vollauf beschäftigt. Also: keine unnötigen Bekanntschaften, überhaupt keine privaten Verwicklungen, denen er sich hätte stellen [14]müssen. Er war froh, wenn er nach getaner Arbeit allein in der Wohnung, die er gemietet hatte, saß. Die Zimmer wurden von einer Putzfrau in Ordnung gehalten, die auch dafür sorgte, dass die Dinge, die Reinhardt herumliegen ließ, dort verstaut wurden, wo sie hingehörten. Nur der Katalog, in dem der Caillebotte abgebildet war, das etwa zweihundert Seiten starke Buch, lag einmal hier, dann wieder dort, als würde es nirgendwohin gehören, und eines Abends, nachdem Giselher Reinhardt noch ein Glas mit Cognac gefüllt und der Versuchung nachgegeben hatte, damit vor die Balustrade zu treten, nachdem er das Glas mit ruhigen, bedächtigen Schlucken leergetrunken und beschlossen hatte, er war schon im Pyjama, endlich ins Bett zu gehen, eines Abends kam er, wie einmal schon, von dem Eindruck nicht los, da wären, statt der Autos, die den Platz überquerten, einige Kutschen.
›Ich sollte nicht zu oft in dem Caillebotte herumblättern‹, dachte Reinhardt, löschte das Licht und hatte bis gegen sieben Uhr, als der Wecker klingelte, einen guten Schlaf.
Aber ach. Man kennt die Anwandlungen, die sich, weil man sie loswerden will, aus ebendiesem Grund wiederholen, und niemand könnte plausibel machen, warum ausgerechnet ein Ministerialbeamter, der nüchtern und verlässlich war, der zu [15]keinerlei Überspanntheiten neigte, warum ausgerechnet er, Giselher Reinhardt, Tage später etwas wahrnahm, das ganz und gar unwahrscheinlich genannt werden musste. Er war wie immer spät nach Hause gekommen, und irgendwann, es war gegen zwei Uhr nachts, hörte er ein unaufhörliches Rattern und Peitschenknallen, das vom Wohnzimmer her eindrang. Reinhardt bemerkte, dass er das Fenster vor der Balustrade offen gelassen hatte. Es wehte kalt herein. Also ging er erst einmal dorthin, und während er mit dem Vorhang, der sich verhakt hatte, beschäftigt war, während er versuchte, das Fenster zu schließen, sah er, dass auf dem Platz genau das geschah, was die Geräusche suggerierten.
Er sah eine Kutsche und wie der Kutscher die Pferde dazu anhielt, kaum dass sie die Mitte des Platzes erreicht hatten, wieder zu wenden. Irgendwann blieben die Pferde stehen, und nun sah er, wie die linke Tür der Kutsche geöffnet wurde und wie eine Frau vorsichtig über das hohe Trittbrett hinweg das Straßenpflaster betrat. Sie trug eine Pelerine, die Schute umrahmte ihr Gesicht, und es war unverkennbar, dass sie, nach Momenten der Unentschlossenheit, zu dem Fenster mit der Balustrade hinaufsah. Eine Weile noch ging sie auf dem Kopfsteinpflaster hin und her, wartete darauf, dass der Kutscher ihr beim Wiedereinsteigen behilflich [16]sein würde. Aber da dies nicht geschah, überwand sie erneut das hohe Trittbrett, beugte sich, nachdem sie sich gesetzt hatte, hinaus, um die Tür zu schließen. Sekunden später war die Kutsche verschwunden.
›Ich bin überarbeitet‹, dachte Giselher Reinhardt und beschloss, sich über eine Sache, die ihn beunruhigte, Klarheit zu verschaffen.
Aber was sollte er tun? Die Mittel, die er in Erwägung zog, waren lächerlich. Sollte er sich tatsächlich, und womöglich hinter dem Vorhang versteckt, auf die Lauer legen und, falls die Kutsche vorfuhr, seinen Nachbarn als Zeugen herbeirufen? Sollte er sich bei der Hausverwaltung darüber beschweren, dass hier nachts ein ununterbrochenes Rattern und Peitschenknallen zu hören war?
›Was mache ich mir für Sorgen! Auf dem Platz vor meinem Fenster ist nichts weiter zu sehen, als was Caillebotte gemalt hat‹, dachte Reinhardt schließlich und ärgerte sich, dass er unfähig war, eine Verträumtheit, auch wenn sie sich wiederholte, einfach, ja warum nicht, zuzulassen.
Also nahm er den Katalog wieder zur Hand, versuchte herauszufinden, ob es tatsächlich jener Platz, jene Kutsche und vor allem jene Frau war, die er von seinem Fenster aus gesehen hatte. Es gab Unterschiede. Reinhardt sah, dass es auf dem Gemälde [17]eine zweite Kutsche gab, aber weit entfernt und derart vage wie die beiden Schemen, von denen er nicht sagen konnte, ob es Passanten oder Gegenstände waren. Aber die Frau im Vordergrund erkannte er sofort, und sie trug, wie jene, die zu ihm aufgesehen hatte, eine Pelerine, die ihr bis zu den Knöcheln reichte. Dies konnte auch nicht anders sein, denn was Caillebotte gemalt hatte, gehörte einem anderen Jahrhundert an.
›Einem anderen Jahrhundert‹, dachte Giselher Reinhardt, und plötzlich glaubte er zu erkennen, dass er selbst, und in aller Deutlichkeit, mit einbezogen war.
Denn jener, der auf dem Gemälde vor einer Balustrade stand, wirkte keineswegs altmodisch. Im Gegenteil.
›Solch einen Anzug, auch noch bequem geschneidert, habe ich gestern erst getragen. Und dass er beide Hände in die Hosentaschen geschoben hat und etwas zu lässig, nämlich breitbeinig dasteht, auch das kommt mir irgendwie bekannt vor‹, dachte Giselher Reinhardt.