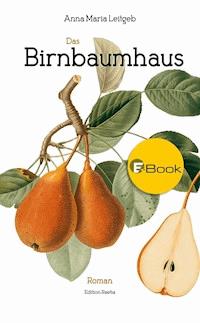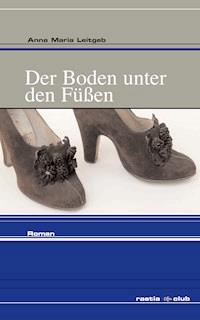
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Nähen und Kochen, das waren die einzigen Fertigkeiten, die die junge Moidi vom Schwienbacherhof hätte lernen dürfen. Doch das ledige Kind in ihrem Bauch, ihr offenes, neugieriges Wesen und nicht zuletzt das Nahen des Zweiten Weltkriegs zwingen sie zur Auswanderung - in ein anderes Leben, nach Amerika. Aus dem Landei wird eine taffe Frau, die zusehends alle Autoritäten hinterfragt. Im Zuge dessen entlarvt sie einerseits die Unbarmherzigkeit einer Kirche und einer Gesellschaft, die blind sind für das Schicksal des Einzelnen, sondern sich als oberstes Prinzip den Erhalt der Ordnung auf ihre Fahnen schreiben; andererseits wehrt sie sich gegen ein System, das auf Unterdrückung von Randgruppen aufbaut, seien es Juden, Farbige oder auch Frauen. Doch bevor sie ihre schmerzvolle Metamorphose zur selbstbestimmten Frau abschließen kann, muss sie sich erneut ihrer Vergangenheit stellen. Anna Maria Leitgeb webt die Entwicklung des Mädchens von einem unsicheren Backfisch zu einer emanzipierten Frau in die großen Wechselfälle des Jahrhunderts ein. Dabei spürt sie den Themen Rassendiskriminierung, Option, Tradition und Konvention in einer sich rasant ändernden, zum Teil auseinander brechenden Welt nach. Wie wird es sein, wenn Moidi als Erwachsene in ihre Heimat zurückkehrt und die Späne der Erinnerung auf eine scheinbar unveränderte Gegenwart mit alten Vorurteilen und Schemata fallen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch:
Der Roman erzählt die Geschichte von Moidi und ihrer Flucht aus Südtirol über den Ozean. Während des Zweiten Weltkrieges verschlägt es das schwangere Bergbauernmädchen mit seiner jüdischen Pflegefamilie nach Amerika, wo die Herbstluft nicht diesen Biss hat wie in den Alpen und die Bäume und Büsche golden und rot an den Zugfenstern vorbeiwehen.
Anna Maria Leitgeb webt die Entwicklung des Mädchens von einem unsicheren Backfisch zu einer emanzipierten Frau in die großen Wechselfälle des Jahrhunderts ein. Dabei spürt sie den Themen Rassendiskriminierung, Tradition und Konvention in einer sich rasant ändernden, zum Teil auseinander brechenden Welt nach. Wie wird es sein, wenn Moidi als Erwachsene in ihre Heimat zurückkehrt und die Späne der Erinnerung auf eine scheinbar unveränderte Gegenwart mit alten Vorurteilen und Schemata fallen?
Anna Maria Leitgeb
Der Boden unterden Füßen
Roman
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Der Spiegel hing von einem rostigen Nagel. Wie der Metallrand war auch die Glasfläche mit der Zeit trüb und fleckig geworden. Senkrecht durch die Mitte lief ein Sprung, der jedes Spiegelbild zerteilte: in zwei ungleiche und voneinander etwas verschobene Hälften. So kam es, dass sich die Schwienbacherischen immer nur wie zusammengeflickt zu sehen bekamen.
Nein, für die Eitelkeit hatte der Vater kein Geld übrig. Zum Rasieren reichte der Spiegel. Man musste eben seinen Kopf ein bisschen heben und drehen, um sein Kinn vollständig in der größeren Scherbe begutachten zu können. Da konnten sich seine Weibsbilder auch damit begnügen.
Als sich Moidi mit langen Strichen ihr Haar bürstete, war ihre Nase gebrochen und ein Auge lag höher als das andere. Sie seufzte.
Auf der oberen Wiese hatte sie die Graszeilen gewendet, Welle um Welle herübergekehrt auf ihre Schuhe. Bei jedem Schritt und jedem Einholen des Rechens waren die Heuschrecken verängstigt kreuz und quer gehüpft.
Ober der Mühle war das Gras schon trocken gewesen. Da hatte sie den Boden sauber abgekämmt, das Heu aufgehäufelt und mit der Gabel hochgestochen auf den Wagen. Es hatte gestaubt. Gras und rötlich weißer Knöterich und orangengelbe Arnikablüten und die halbkugeligen Köpfchen des Teufelsabbiss waren um sie geschwirrt, und ein silbern dreckiger Halbmond von Schweiß war auf ihrer Oberlippe aufgegangen.
Der Vater hatte sie mit eckigem Mund angeschaut und ausgelacht, wie er sie so sah, dampfend und nackt im Gesicht und angeschneit, als er, das Heutuch hoch aufgetürmt auf Kopf und Schulter balancierend, vom Waldrand heruntergestiegen kam. Und sie hatte ihn dann geschubst, weil es niemand sonst sah, und sie ein bisschen dusselig war von der Hitze. Er hatte in der Folge sein Gleichgewicht verloren, nur vor Lachen und Mutwillen, hatte den Heuberg abgeworfen und sich hinterdrein. Moidi wäre fast auf ihn gesprungen wie ein junger Hund, hätte sich mit ihm gebalgt, ihm das Gesicht abgeleckt, so leicht und ohne Gewicht war sie plötzlich mit diesem dreisten Vater gewesen, war das die Möglichkeit?
Ein unternehmungslustiger Wind war vom Berg herabgerollt, hatte sie gekitzelt. Grün und aufgeplustert waren die Wälder ringsum gewesen. Der Himmel darüber blau, so blau, hatte jede Faser in ihr aufgerichtet und sie fast in den Zenit gesaugt, aber nur fast, denn da war ihr plötzlich die Farbe des Blutes eingefallen, einige Monate war’s her, in Mutters Kammer. Nur die Farbe des Blutes war diesem Blau in seiner Intensität ebenbürtig. Der Gedanke hatte ihren Leichtsinn gedämpft, sie hatte sich besonnen, wieder gewusst, wer sie war.
Als der Vater in die Küche trat und die Stühle für den täglichen Rosenkranz zusammenschob, bürstete Moidi ihr Haar schneller, teilte es dann, zopfte es mit fliegenden Fingern, wand sich die zwei Flechten um den Kopf und steckte sie fest. Schnell drehte sie den Spiegel noch über ihrem Gesicht, suchte sich zusammen. Flugs mit etwas Spucke einige störrische Härchen in den Bögen der Brauen verstrichen, sonst schien alles in ihrem Gesicht gewöhnlich und bescheiden an seinem Ort. Als sie sich nach ihren besseren Schuhen bückte, merkte sie, wie klamm die Muskeln in den Armen und Beinen waren. Und im Bauch war eine leere Stelle, in der eine kleine Unruhe zu nagen und zu zappeln anfing.
Es war ein paar Minuten nach dem Betläuten. Der Vater wartete nicht. Er stimmte das Gebet an: „Eee ehre sei dem-Vater und em Sohn …“
Seine Vorbeterstimme war gleichmäßig und monoton und heller als seine normale Sprechstimme und dehnte die Vokale und leierte wie die Milchzentrifuge. Er kniete auf dem Steinboden in der Küche neben der Mutter zum Herrgottswinkel hin. Seine Ellbogen und Arme waren Kufen auf der Sitzfläche des Stuhls und stützten den hageren Oberkörper. Der verwitterte Hals mit dem kleinen Kopf ragte schildkrötenartig aus dem Kragen. Rund um seinen fast haarlosen Schädel lief der ringförmige Abdruck seines Hutes, innerhalb dessen sich die Haut spiegelglatt und blassrosa spannte. Die Hände waren schwielig und wurzelig und machten ein Gefäß zum Erhaschen der göttlichen Gnade, die ihn heute beim Heuen angeblitzt hatte: ja, seine Moidi hatte sich gut herausgemacht, dachte er. Aber ansonsten war es mit der Gnade in diesen Zeiten oft nicht weit her. Er fingerte die Perlen des Rosenkranzes mit Daumen und Zeigefinger ab, um seinem Gebet das richtige Maß zu geben, während sich seine Kinder und Dienstboten schnell und möglichst unauffällig hinzustahlen.
Das Flugblatt, das ihm der Lehrer, dieser spreizbeinige Großtuer, heute zugesteckt hatte, ging ihm auch jetzt nicht aus dem Sinn.
„Südtiroler, bekennt euch!“, stand drauf. „Eine schwere, aber stolze Stunde ruft euch auf zum Bekenntnis für Blut und Volk, zur Entscheidung, ob ihr für euch und eure Nachkommen endgültig auf euer deutsches Volkstum verzichten oder ob ihr euch stolz und frei als Deutsche bekennen wollt.“
Die Frauen- und ein paar brummende Männerstimmen psalmodierten „Jetzt und in der Stunde uns eres …“, aber der Vater fiel ihnen schon mit dem nächsten Geeeegrüßt seist du Maria ins Wort, schnitt ihnen das Absterbens Amen glatt ab.
„Das macht er immer, der Vater, er lässt uns nie ausreden“, dachte Moidi.
Aber der Schwienbacher war eine Maschine, die schneidet und drischt, und der Führer hatte sie allesamt verraten, Teufel noch einmal. „Verkauft an die Walschen. Nicht einmal die Vorhänge hatte der Schuft aufgezogen, als er im Zug durchs Land gefahren war. Wollte seine Visage nicht herzeigen. Die Spruchbänder auf den Bahnhöfen nicht sehen. Der feige Hund! Jetzt sollte unsereiner frisch alles liegen und stehen lassen und nach Galizien auswandern!“, so kam der Vater nicht umhin zu denken. Ja, mit dem Beten hatte es heute nicht das Richtige auf sich.
„Die Scholle opfern wir dem großen Ziele, dem großen, heiligen deutschen Reich“, das stand auf den Zetteln, die einem bei jedem Gang ins Dorf unter die Nase gehalten wurden. „Betakelt hat uns der Lotter“, wusste der Vater und machte sich und die anderen weiterbeten.
Aber die Mutter wollte nicht nach Italien hinunter ausgesiedelt werden. Denn genau das würde den Dableibern blühen, da war sie überzeugt, das hatte Mina im Geschäft auch gesagt. Und Nanne vom Kiebler. Und die hatte es vom Podestà selber.
„Das ist ja nur Propaganda, verstehst du nicht?“, hatte der Vater gekontert, als sie ihm ihr Bröckchen Meinung gab. Und überhaupt, statt in Hütten zu wohnen, aus denen die polnischen Bewohner vertrieben wurden, würde er tatsächlich lieber zu den Walschen hinuntergehen in ihren Stiefel: „Stell dir vor, auf einem Hof arbeiten, von dem man den Besitzer samt Frau und Kind verjagt hatte! Und man ist umgeben von Slowaken, Tschechen und Polacken und hat die russischen Bolschewiken in nächster Nähe! Und irgendwann kommen die Vertriebenen wieder und fordern ihr Land zurück, und man müsste wieder gehen! Wohin dann ohne Hab und Gut? Nur weil ein gewissenloser Kerl mit einer gewissenlosen Propaganda einen aus der Heimat fortgelockt hatte!“
„Siehst du nicht, wie es mit uns steht?“, hatte die Mutter geplärrt, „nicht einmal mehr auf dem Grab darf ein deutsches Wort stehen!“
„Daheim ist daheim“, hatte sie der Vater daraufhin angeschnauzt und ihr mit seinem schnellen Zorn den Mund gestopft wie mit einer Handvoll geschroteter Maiskörner.
Die Kathl, die Dirn, hatte er davongejagt. Die musste gehen, von ihm aus dorthin, wo der Pfeffer wächst. So eine wie die kann ihm gestohlen bleiben, jawohl, das kann die: „Wenn ihr die Rosenkranzandacht nicht passt und sie stattdessen den österreichischen Schnauzer anbeten will, hat sie hier nichts mehr verloren, Kruzitürken!“
Der Schwienbacher litt niemanden im Haus, der sich an Kirche und Brauch versündigte. „So wird’s gemacht und so ist es“, war sein Leibspruch.
Die Base Elsa war so gut, an Kathls Stelle einzuspringen. Sie kniete sich gerade neben die Mutter hin. Joss, der Knecht, war der Einzige, dem das Sitzen auf der Eckbank erlaubt war, denn er hatte seit dem Großen Krieg ein schlechtes Bein. Zu seinen Füßen lag der Hund. Michel und Konrad waren genau hinter der Mutter. Die mit ihren neun bzw. sechs Jahren mussten in ihrer Reichweite bleiben. Sie hatten freihändig zu knien, ohne die Stütze eines Stuhls, ließen sich aber in den wenigen unbeobachteten Augenblicken, die Mutters Inbrunst ihnen ließ, gern auf die Fersen nieder, bis sie von ihrer ungnädigen Hand wieder hochgepufft wurden zu einer andächtigeren Haltung. Die halbwüchsige Stasi zappelte neben den Brüdern relativ bequem auf dem Saum ihres Kittels herum, der ihr zu weit war, aber einen umso besseren Wulst unter ihren Knien abgab. Florian schnitt hinterm Vater jedem, der ihn ansah, Grimassen, um seine Überlegenheit in Sachen Beten unter Beweis zu stellen; war er nicht praktisch schon erwachsen? Moidi war neben ihm niedergegangen. Sie hatte sich in den fast fünfzehn Jahren ihres Lebens, in denen sie Bekanntschaft mit diesem Boden pflegte, nicht an seine Härte gewöhnen können. Jeden Tag fraßen sich die Platten in die Knie mit ihrem hundertjährigen Biss, aber „Buße muss sein und damit basta“, sagte die Mutter immer, wenn sie sich beschwerte. Deshalb versuchte Moidi so gut es ging sich mit netten Gedanken zu trösten. Schon beim ersten Gegrüßt seist du Maria fiel ihr der Lehrer ein, und bevor sie sich’s versah, stand ihr sein Mund im Sinn, pfirsichfarben, aber seltsam zerknittert, wie altes Seidenpapier. So sehr ihr die Unschicklichkeit des Bildes, das sich ihr da aufdrängte, bewusst war und so sehr sie auch versuchte, es zu verscheuchen, es kehrte doch immer zurück. Musste sie nicht jedes der zehn Gegrüßt seist du Maria in einem Gesätz des Rosenkranzes daran erinnern, dass sie der Lehrer bei den Chorproben gern mit genau dem Gruß empfing: „Gegrüßt seist du Maria“? Überhaupt redete er sie ausschließlich mit der ihrer Meinung nach viel eleganteren Version ihres Namens an, mit Maria nämlich, was sie ganz deutlich als Aufwertung ihrer Person empfand.
Ihre Tochter habe eine ausgesprochen klare Stimme, einen leuchtenden Sopran, so hatte der Lehrer zu Fronleichnam den Eltern vorgeschwärmt. Ehrlich, ohne Maria sei der Kirchenchor nichts, hatte er ihnen beteuert. „Aber gehen Sie“, hatte die Mutter unsicher, aber doch geschmeichelt erwidert, der Vater jedoch hatte sich unbeeindruckt gegeben. Besonders die Chorproben jeden Donnerstagabend gingen ihm gegen den Strich. Das sonntägliche Singen bei der Messe war seiner Meinung nach gut und genug. Warum Extraproben und Solos und diese neuen deutschen Lieder, die man das Mädchen singen hörte, na, er wusste nicht, abgesehen davon, dass sie verboten waren.
„Lass ihr die Freude“, hatte ihn die Mutter öfters beschwichtigen müssen, „die Gitsch singt halt gern, und der Lehrer hat was los, das musst du zugeben.“
„Ach was, der Spaß verdreht dem Mädel gleich einmal den Kopf! Stricken oder flicken oder nähen lernen wäre gescheiter, da hätte sie mehr davon“, hatte der Vater weitergemault, aber dieses Thema war ihm doch nicht wichtig genug gewesen, um daran viel Energie zu verschwenden.
Das Ehreseidem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist des Vaters senkte alle Scheitel, und auch als es vorbei war, blieb Moidi nach vorne gebeugt und gleichsam hängen hinter ihren geschlossenen Lidern in einem schillernden Raum wie von Öl und Wasser. Darin bewegte sich ihr Lehrer: Die rötlich blonden Haare umfusselten seinen Kopf, sodass es im Gegenlicht aussah, als hätte er einen Heiligenschein. Und seine glasblauen Glupschaugen schimmerten feucht wie die himmlische Liebe. Ein Jesusgesicht hatte der Lehrer. Jesus mit Brille. Die schlanke Nase männlich und fromm zugleich und doch ganz mitten drin in der Welt. Er zeigte auf das brennende Herz in seiner geöffneten Brust, „sieh her Maria“, sagte er, Moidi anlächelnd …
Da der Unterricht in deutscher Sprache von den Faschisten verboten worden war, hatte der Lehrer seine Stelle an der Dorfschule verloren. Das deutsche Lehrpersonal war überall in Südtirol von linientreuen Italienern ersetzt worden, die sich die Erziehung dieses ihrer Meinung nach hinterwäldlerischen Bergvolks zu guten Italienern zu Herzen nahmen. Der Lehrer aber machte es sich seinerseits zur Aufgabe und riskierte seine Haut, um sein Land und Volk deutsch zu erhalten: Er gab insgeheim Deutschstunden. Ein-, zweimal die Woche stieg er auch zum Schwienbacher hinauf und wurde mit Milch, Butter und Eiern bezahlt. In der Stube teilte er unter den schmachtenden Blicken der Schmerzensreichen sein Wissen aus und gab Moidi die Gelegenheit, sich ganz in ihn zu verschauen, während er sich vor ihr und ihren Geschwistern produzierte, mit schlenkernden Armen und Beinen erklärte und vormachte und deutete. So gescheit, der Mann. Und Moidi hatte öfters vergessen zu antworten und war ins Stottern gekommen, über und über rot, und hatte sich geschämt.
„Den duo Jung frau im Tempel auf geopfert hast …“, plärrte der Vater.
Moidi stand auf.
„Ich muss jetzt gehen“, flüsterte sie der Mutter ins Ohr.
Die blickte starr auf den geschnitzten Herrgott, „Heilige Maria Mutter Gottes bitt für uns Sünder“, und machte mit dem Kopf eine Bewegung, als wollte sie eine lästige Fliege verscheuchen. Moidi fraß ihren hochsteigenden Ärger gleich wieder hinter den Nabel hinein. Das glich der Mutter. Sie behandelte einen wie den letzten Dreck. Die Mutter betete lauter als vorher weiter, sodass es wie ein Jammern klang, wie ein Stoßgebet, und ließ die Rosenkranzkette auf die Sitzfläche des Stuhls prasseln, um ihrer Frömmigkeit Nachdruck und ihrer Tochter ein schlechtes Gewissen zu verleihen, als die sich auf den Flur stahl.
Moidi war froh, entwischt zu sein. Ihre Knie und der Rücken verstanden das Beten schon lange nicht mehr. Sie rannte noch schnell in ihre Kammer und band sich eine saubere Schürze um. Dann nahm sie das Gesangbuch vom Regal und lief damit dem Raunen und Brummen der Nachbeter und dem hellen Greinen des Vaters in der Küche davon, auf den kleinen Söller hinaus und die Holzstiege hinunter.
Die Abendsonne zeigte auf den muttergottesmantelblauen Rittersporn im Garten, und Moidi erschrak, als ob sich plötzlich ein Fenster aufgetan hätte und da etwas Wichtiges war, was sie betraf. Um Gottes Willen, was war mit ihr?
Am Blattspinat konnte sie jede Rippe sehen, der Schnittlauch stachelte giftig zwischen dem Petersil und dem Maggikraut heraus. Die Venen in den schildförmigen Blättern der Kapuzinerkresse liefen auf einen Punkt zu, dieses hellwache Auge, all diese Augen den Gartenzaun entlang, als wollten sie etwas von ihr.
Sie lief leichtfüßig den Steig bergab. Mit jedem Hüpfer über eine Wurzel hier und einen Stein da zerkleinerte sich die seltsame Ahnung, wie Fensterglas zersplittert unter den eisernen Rädern von Vaters Heuwagen. Sie sprang über das geschlängelte Band des Pfades, nahm die Stufen bildenden Felsplatten mit runden Aufprallern wie ein Ball und war bald auf dem Fahrweg angekommen. Dort hielt sie ihre Strickjacke mit beiden Armen hoch über den Kopf und war ein Schiff und segelte durch die abwechselnd warmen und kühlen Ausdünstungen der Erde hindurch, an mehreren Höfen vorbei und dann auf der mit Mauern eingefassten Dorfgasse zur Kirche hinunter.
„Gegrüßt seist du Maria“, rief jemand frech und pietätlos vom Friedhof her. Moidi fuhr ein Stich durch den Brustkorb. Sie bremste ab und band sich die Jacke um die Mitte. Da kam tatsächlich der Lehrer aus der Kapelle geschlendert, und das Mädchen konnte ihn nicht ansehen, weil er etwas mit dem Rittersporn in Mutters Küchengarten zu tun hatte. Sie spürte seine Wärme und roch seinen Brunellengeruch, als er neben ihr herging, aber sie schaute geradeaus, während sie ging, elektrisiert und befangen zugleich, an der Kommende vorbei und durch die spitzbogige Kirchentür durch und die dunkle Stiege zur Orgelempore hinauf, und stellte sich dünnwandig und durchscheinend zwischen die anderen Sänger, eine Rose zwischen Mangold und Bärlauch und Kren.
Sie wärmten ihre Stimmbänder auf mit „Meerstern ich dich grüße“.
„Maria, übernimm du die Überstimme“, befahl der Lehrer, und sie übernahm und glühte wie der spritzige Wein von St. Magdalena und sang sich zwirbelig im Kopf.
Danach die Mozart-Messe. „Missa Brevis in B, KV 275. Wunderbar. Schlicht und volkstümlich im Charakter“, rühmte der Lehrer. Moidi wurde schwerelos, als sie sich freisang, derart federleicht wurde sie, dass sie aus ihrem Leib flog und über die Brüstung und durch das Kirchenschiff. Durch die hohen Fenster glitt sie und hinaus über das waldige Finsterbachtal und am Zwiebelturm von Mittelberg gaukelte sie vorüber und war wie der Heilige Geist eine Taube, ja, so weit verstieg sie sich in der fremden Landschaft der Töne.
„Gehen wir zusammen heim?“, fragten die Huber-Schwestern Moidi, als der Lehrer schließlich seine Noten zuschlug.
„Nein, nein“, mischte sich der gleich ein, „es klappt zwar schon ganz gut, aber am Kyrie muss noch ein bisschen gefeilt werden. Maria bleibt noch da!“
Moidi wurde rot. Fast wollte sie sagen, „nein, nein, ich möchte lieber mit euch mit, der Lehrer ist so, so irgendwie … blau, und ich kann nicht schwimmen …“
Aber der Lehrer, der war jemand und nannte sie Maria, das klang edel, nach Kristallschüssel etwa, und erhob sie absolut und unmissverständlich über das anwesende Holzgeschirr voller Ästchen und Unebenheiten. Also blieb sie.
Die Chormitglieder polterten nacheinander die Holzstiege hinab und zogen die Luft mit sich aus der Kirche. Moidi lehnte sich gegen die Orgel und wusste nicht wie atmen. Dunkelheit drückte und presste bereits gegen die fade Lichtglocke, die über das Instrument und auf den Fußboden fiel. Der Lehrer übte eine verzwickte Abfolge von Akkorden und Modulationen, entwickelte über einem düster grollenden Orgelpunkt stets wechselnde, teilweise angstvoll dissonierende Harmonien, dann löste er das Geflecht prächtig in Dur auf, was ihn übermütig zu machen schien, denn er fing gar zu singen an:
Sie hieß MarieUnd treu war sieSie war der Liebling von der ganzen Kompanie.Ob GrenadierOb FüsilierEin jeder kannte sie und träumte nur von ihr.
Der war vergnügt, ja das war der. Während er sang, rannten seine Augen von Moidi ins Gewölbe hinauf, über das Netz der Rippen und zwischen die Wappen der Hochmeister, Land- und Hauskomture herum wie Eichkätzchen und stürzten sich wieder herab und setzten sich auf Moidis verwunderten Mund und auf die zwei festen Kugeln zwischen ihren Armen, die eingezwängt saßen in dem bäurischen Kleid. Und schmetterte weiterhin das Lied wie der berühmte Spatz von der Rinne.
Wenn sie zum Tanze gingDann ging mit ihrDie ganze InfanterieUnd auch die ganze KavallerieSogar die schwere Artillerie,So süß war sie!
Sie hieß MarieUnd treu war sieSie war der Liebling von der ganzen Kompanie.
„Komm her, Maria!“, kommandierte er mit lachenden Zähnen, als er fertig war. Moidi blieb gegen den Spieltisch gelehnt sitzen. Der Lehrer stieg von seinem Sitz herab und machte einen Schritt auf sie zu. Er griff ihr unters Kinn und hob ihren Kopf hoch. Moidi schloss die Augen. Ihr war so bang und sie wusste nicht recht warum. Seine Hand war fest und warm und ein kleines bisschen feucht. Oder war das, weil sie weinte? Als sie seine flatternden Lippen auf ihren Wangen fühlte, dachte sie, ach so ist es, wenn man geliebt wird. Sie stand still, und er küsste ihr nasses Gesicht ab und drang in ihren Mund ein und rieb seine knochige Figur gegen ihre, während der Geruch nach Vanille und Schweiß ihr zu Kopf stieg wie ein Stamperl Schnaps.
Dann wurde ihr heiß, heiß, um Himmels willen, so heiß im Schoß, und sein Zittern auf ihr, sein pochendes, ungeduldiges Zittern, und die Beine schmolzen unter ihr dahin, und ihr Leib prall von Saft und Süße. Es war ihr nur recht, als der Lehrer das Mieder aufzuknöpfen begann, und sie beeilte sich, ihre Hände ungelenk mit übereinander stolpernden Fingern, zu helfen. Als sie mit ihm auf den Boden fiel, riss sie ihre Augen auf und sah nur die fuchsige Aura seiner Haare, und sie schlug mit den Armen und kämpfte gegen eine Strömung an, die sie hinaus auf den See sog, weg vom sicheren Ufer.
Als Moidi schließlich den Heimweg antrat, lag das Dorf schon unter der dunklen Plache der Nacht. Im Osten fassten Rosengarten und Latemar noch mit bleichen Wurzeln nach der versunkenen Welt und bleckten mit schwarzen Zacken in den weggefallenen Himmel. Jedoch der waldige Hügel hinter dem Dorfteich und dem Gasthaus und das Eisacktal dahinter waren wie ausgelöscht. Über die Leite hin waren matte Lichttüpfchen gesprenkelt. Weiter oben war der Wald, wo er in Richtung Horn weiter kletterte, ein dunkler Fleck. Je weiter sich Moidi von der Kuhle entfernte, in der das Dorf nistete, desto dicker war die Luft mit Zikadengeschrei, man glaubte, man müsste sich daran stoßen. Und Moidi hatte diese unbändige Lust mitzuschreien, sie war so aufgerührt. Aber was würden die Leute sagen, wenn sie Zeugen würden, wie sich die Schwienbacher-Gitsch ihr Innerstes nach außen stülpte? Nein, sie steckte sich stattdessen ihre aufgesprengte Seele in die Beine und fing zu rennen an: mit sicherem Tritt bergauf in der dichten Luft, und die Schuhe tickten auf den Steinplatten des schmalen Steiges wie die Stubenuhr und flappten auf der festgetretenen Erde, und der Atem stieß aus ihr heraus und keuchte wie der Blasbalg der Orgel in der Kirche. Als sie schließlich auf den Fahrweg stieß, rang sie nach Luft. Sie ging nun langsamer. Beim ewigen Licht, das in einem Astloch neben dem Kreuz in der mehrstämmigen Buche glühte, machte sie halt. Ihre Beine zitterten und waren teigig, das Herz trommelte in ihren Ohren, und sie merkte, dass es ihr im Schritt wehtat.
Zu Hause war die Mutter in der Küche und wusch sich die Füße in der emaillierten Waschschüssel. Seit sie wieder schwanger war, standen das Clarostil-Fußbadesalz und die Salbe immer auf dem Regal neben der Rasierseife, dem Rasierpinsel und der Klinge, aber dass deshalb alle Venenschmerzen und Hühneraugen eine gewesene Sache waren, wie die Werbung versprach, stimmte auch wieder nicht.
„Bist sehr spät dran, Moidi“, seufzte die Mutter und schaute gleich zweimal, weil ihr Kind rot im Gesicht war und irgendwie anders. Aber Moidi sagte einfach, ja, es habe länger gedauert, aber sie sei müde und deshalb gute Nacht, und drehte sich um.
Der Juli war herrlich im Jahr 1939 mit einem aufgerissenen Himmel, durch den das ganze Weltall hereinzufallen schien in seiner Unendlichkeit. Irgendwo in der bläulichen Landschaft machte sich immer ein neuer Ton los, ein Läuten aus einer der Kirchen oder Kapellen, ein Bellen, ein Knattern oder Hämmern, das Aufjaulen einer Säge, ein Schrei, man konnte oft nicht sagen, von welcher Talseite der Ton kam, und wand sich hoch, immer eine andere Luftblase in einem riesigen Aquarium. Und Moidi bewegte sich darin mit wallenden Röcken, langsam, wie in Zeitlupe, und fand immer wieder eine Möglichkeit, sich mit ihrem Lehrer zu treffen, wenn nicht auf der Orgelempore in der Kirche, so doch im dämmrigen Hollergebüsch in der Mulde hinter der Langen Lacke. Dort schwebten die elfenbeinfarbenen Dolden wie Klöppelspitzen über ihnen in einem grüngoldenen Raum und ließen den Blütenstaub auf die keuchenden Leiber niedergehen und rochen süß und bitter zugleich. Und war schon fertig: Immer war zu wenig Zeit, oder jemand könnte vorbeikommen, oder ein Hund.
Ja. Aber schließlich war ein Keil da, der die Moidi und den Lehrer auseinandertrieb. Er kam in Gestalt von Mena, der Wegmachertochter. Die musste sich der Lehrer einmal genauer unter die Lupe nehmen. Hatte sie sich nicht gut entwickelt, die Kleine? Schau einer an, singt frisch wie ein Vogel in der Frühlingsluft. Aus der wird noch was, wenn man ihr unter die Arme greift. Galt es nicht, der Kirchengemeinde das Beste vorzusetzen zu Maria Himmelfahrt? Seit der Lehrer sein Auge auf ihr hatte, trug Mena den Zopf aufgestellt auf dem Kopf, wie eine Krone.
Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass Mena nach den Chorproben mit dem Lehrer privat noch extra schwere Passagen klären musste. Na ja, sie war groß und hatte vorne ordentlich was dran, aber Schönheit war sie keine. So flehentlich Moidi den Lehrer auch anblickte und nach Vorwänden suchte, die ihr gestatteten, ebenfalls länger auf dem Chor auszuharren, der Lehrer sah sie nur streng an, „Maria, du hast doch gehört, dass ich mit Mena zu arbeiten habe!“
Oder er sagte, was die Wirkung nie verfehlte, „geh nur heim, Maria, der Schwienbacher wartet bestimmt schon auf dich!“
Zur Himmelfahrtsprozession sang Moidi aus Trotz und Kummer nicht mit im Chor, sondern war eine der Jungfrauen in weißer Schürze über dem bodenlangen Gewand und mit gestärkten weißen Puffärmeln bis zu den Ellbogen und darunter die schwarzen Tatterlinge über dem glatten Fleisch der Arme und Hände. Die neckten die Keuschheit, die Tatterlinge, mit einem lustigen Gestöber von Löchchen in dem Muster, so raffiniert, und doch durften die so bekleideten Mädchen die heilige Jungfrau und Nothelferin Notburga mit ihrer Sichel durch die Wege und Touristenspaliere des Ortes tragen.
Sonst gab es Arbeit, nichts als Arbeit: das frisch geschnittene Gras anstreben, die Gerste schneiden, der Spätweizen, das Grummet. Verschwitztes Gewand und Schwielen. Missmutig schaute Moidi auf ihre kleinen Brüder, die im Bach spielten oder die feuerroten Beeren der Eberesche durch die hohlen Stiele des Geißblattes bliesen.
Vor fünfundzwanzig Jahren war der Vater mit den anderen Männern des Dorfes in den Großen Krieg gezogen. Jetzt begannen die Sommermanöver in der Poebene. Der Vater suchte im Volksboten nach Zeichen und Hinweisen, mithilfe derer man die politische Lage in Europa abschätzen konnte. Er las vor beim Mittagessen von der restlosen Bereitschaft der Achsenmächte und dass Graf Ciano, der italienische Außenminister, in Salzburg und Berchtesgaden weilte. Dann der deutsch-russische Nichtangriffspakt, was war da dahinter? Selbst der Papst schien auf Nadeln zu sein, denn er machte einen eindringlichen Friedensappell im Katholischen Sonntagsblatt.
Moidi ging das Gerede der Erwachsenen beim einen Ohr hinein und beim anderen hinaus. Sie kümmerte sich lieber um Benedikta im Roman aus deutscher Vergangenheit und wartete sehnsüchtig auf die Fortsetzung in der nächsten Woche. Und auf den Lehrer, ja den Lehrer. Stellte sich vor, dass er reuig wieder zu ihr zurückfand.
Dann war wieder Waschtag, den ganzen Tag am Brett im Nebel der Waschküche, zuerst das weiße, am zweiten Tag das farbige und am dritten das dunkle Zeug, und die Böden waren am Schluss zu spülen und zu schrubben mit der übrigen Aschenlauge. Der Vater las bei Tisch neue Schlagzeilen vor, sobald er Löffel und Gabel aus der Hand gelegt hatte, während die Frauen mit dem Aufräumen begannen und Moidi die Aluminiumtöpfe mit Essigwasser einrieb. Da war es schon September, als er „Deutschland im Krieg mit England, Frankreich und Polen“ vorlas und „Friedensbemühungen des Duce“. Und die Wiesen wurden das dritte Mal gemäht, der Hafer und der Buchweizen verarbeitet. Der neue Leps rann heuer süßer als letztes Jahr gegen den Durst.
Moidi verschwand abends im neuen Volksbotenroman Monika, ein Schicksalsroman von Frauenliebe und Frauenleid. Sie träumte weiterhin von der breiten Brust des Lehrers und seinen Armen, braun bis zu den Ellbogen, darüber weiß und zart. Und versuchte Botengänge zu ergattern, die sie in die Nähe seiner Wohnung führten.
2
Am 16. Oktober fing die Schule wieder an. Leider war sie im Sommer nicht abgebrannt, da hatten Moidis Brüder umsonst jeden Tag darum gebetet.
„Siamo tutti italiani“, verkündete Italia Molini, die Lehrerin, gleich am ersten Tag aufgekratzt und mit glänzenden Augen der Klasse. Sie sprach von den großen Taten Mussolinis, die die italienische Brust stolz schwellen ließen. Durch Mussolini würde das Volk an seine großartige Vergangenheit als Beherrscher des Abendlandes erinnert, und durch ihn würde der Welt die noch großartigere Zukunft der Italiener als Drahtzieher der Weltgeschicke vor Augen geführt. Zur Veranschaulichung des Gesagten ließ sie ihre knallroten Nägel durch den Mief des Klassenzimmers springen, dass die Reifchen um die Handgelenke säbelten. An diesem ersten Schultag ließ sie sich die gute Laune nicht verderben, auch nicht, als sie Moidis Schwester Stasi dabei ertappte, wie sie mitten in der patriotischen Predigt einnickte: den Kopf seitlich auf der Schulter pendelnd, sah das Mädchen aus wie ein welkes Blümchen im Wind. Zur Behebung des Missstandes klatschte die Signorina in die Hände, machte das Kind aufstehen und der Klasse klar und deutlich sagen, wer eigentlich dieser Mussolini sei. Verdattert und benommen stotterte Stasi „Mussolini è il re“ und schaute die Lehrerin fragend an.
„Ach was König, Mussolini è il Duce, il capo del Fascismo“, korrigierte die Signorina das Mädchen irritiert. Und das mussten diese vernagelten Barbarenkinder jetzt und sofort zehnmal in Schönschrift ins Heft schreiben: „Mussolini è il Duce, il capo del Fascismo“. Damit sie sich’s hoffentlich und endlich merkten.