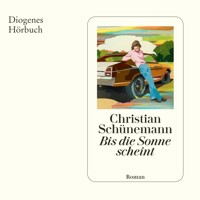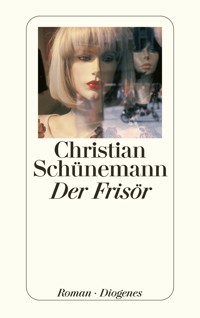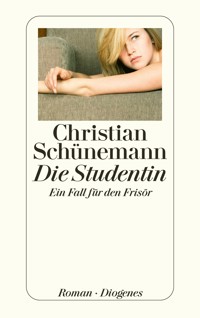9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Frisör
- Sprache: Deutsch
»Unerwartet« heißt das Bild von Ilja Repin, das der Frisör in Moskau gerade noch bewundert hat, und unerwartet ist auch der Besuch eines Mannes, der kurz darauf in seinem Münchner Salon auftaucht: Jakob Zimmermann, Mitte dreißig, mittelloser Kunstmaler, behauptet, sein Halbbruder zu sein. Wer ist Jakob – ein Erbschleicher oder ein vertuschter dunkler Fleck in der Prinz'schen Familiengeschichte?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christian Schünemann
Der Bruder
Ein Fall für den Frisör
Roman
Die Erstausgabe erschien 2008 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Foto von Jens Schünemann unter Verwendung eines Gemäldes von Christopher Winter, ›No Fear‹, 2007 (Ausschnitt)
Mit freundlicher Genehmigung der Galerie Neuhoff Edelmann, New York
Für Sally
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2023
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23723 8
ISBN E-Book 978 3 257 60403 0
[5] 1
Eine Tanne wanderte durch die Hotelhalle. Sie spazierte am Gepäckwagen vorbei bis zur Säule, kippte, schwenkte einen Meter nach rechts, nach links und steckte fest, ein Schlagbaum zwischen Aufzug und Rezeption. Die Gäste mussten kopfschüttelnd Umwege machen, niemand, außer mir, hatte Zeit. Ich saß im Sessel und schaute auf die Uhr. Aljoscha wollte mich abholen. Ich rechnete: Daheim in München würde Kitty, meine Mitarbeiterin am Empfang, gleich den Salon aufschließen, die Kunden begrüßen, zu ihrem Platz führen, würde die netten mit Aufmerksamkeit verwöhnen, und die weniger netten? Die natürlich auch. Aber dass dort, in München, an diesem Morgen etwas anders war, dass ein Mann von draußen in den Salon spähte und Kitty beim Anblick des blassen Gesichts an der Scheibe erschrak, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich war frei und sorglos, mit Kräuterrührei und Krevetten im Bauch, und vor mir ein Tag, an dem alles möglich war. Ich war im Urlaub.
Eine Hotelangestellte lotste den Baum aus der Sackgasse und dirigierte ihn an seinen Platz. Die Tanne wurde aufgerichtet, stand gerade, die Zweige nach oben gestreckt, schmucklos und unbeholfen. Nur noch zwei Wochen bis zum ersten Advent. Zu Hause musste ich mich gleich nach meiner Rückkehr auch um die Weihnachtsdekoration kümmern. Vor den [6] Feiertagen ist im Salon immer der Teufel los. Manche Kunden, die auf Nummer sicher gehen, buchen den Dezembertermin schon im Spätsommer. Ich wollte nicht daran denken. Die Tannennadeln dufteten und weckten Appetit auf Anisplätzchen, Nusskipferl und Spitzbuben.
»Entschuldigung«, sagte eine Frau auf Russisch. »Sind Sie Vladimir Hausmann? Wir sind verabredet.«
»Nein«, antwortete ich mit meinem deutschen Akzent. Seit eineinhalb Jahren lerne ich Russisch, seit aus der Affäre mit Aljoscha eine Beziehung wurde, aber meine Fortschritte sind dürftig. Zwar kann ich das Alphabet in Druck- und Schreibschrift, aber bei der Aussprache mit all den Zischlauten hapert es noch. Ich sagte: »Ich heiße Tomas Prinz.«
Die Frau murmelte eine Entschuldigung. Mir gefiel ihre Kappe, gefärbter synthetischer Pelz, eine flauschige rosa Perücke, unter der kein einziges Haar hervorschaute. Ich wollte eine Unterhaltung probieren und fragte wie im Lehrbuch, Lektion eins: »Und wie heißen Sie?«
Sie schaute sich um. Hatte sie mich nicht verstanden? Ich muss auf die Betonungen achten, mahnt meine Lehrerin daheim in München.
Ich sah zu, wie das Rosakäppchen mit dem Portier diskutierte. Die Hotelangestellte zerrte mit zwei Männern in Overalls an den Kabeln einer Lichterkette, und mir gegenüber redete ein Mann in die Hand an seinem Ohr, die wohl ein Telefon barg. Seine Stimme klang melodisch wie auf meiner Sprachkassette, aber er verschluckte die Endungen, die ich in den Deklinationen mühsam auswendig lerne. Ich verstand kaum etwas. Eigenartig sah er aus. Das Haar ohne [7] Scheitel glatt in die Stirn gekämmt und über den Augenbrauen gerade abgeschnitten. Die Koteletten, die dem runden Gesicht Kontur geben könnten, endeten bereits über dem Ohrläppchen. Der Mann guckte zur Drehtür. Am Hinterkopf dasselbe: Alles auf einer Länge, der flache Schädel betont, statt mit einer Stufung das fehlende Volumen zu kompensieren. Der russische Haarschnitt ist eine Katastrophe. Bei uns treiben die Männer mit Wachs und Gel den größten Aufwand, rasieren und trimmen das Haar an allen Körperteilen, während man hier denkt, mit einem sauber ausrasierten Nacken sei es getan. Seit drei Tagen war ich nun schon bei Minusgraden in der russischen Hauptstadt unterwegs, schaute mir die Menschen an und achtete darauf, den Kreml mit seinen hohen roten Mauern als Orientierungspunkt nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Moskauerinnen auf der Twerskaja Straße sahen aus wie Models – aber was war mit den Männern los? War das die »neue Generation«, von der Aljoscha immer erzählte? Ich überlegte, wie es wäre, hier in Moskau eine Frisör-Filiale aufzumachen, mit meiner Philosophie vom perfekten Haarschnitt. Aber einen Laden mit russischem Personal ohne Disziplin? Eine Schnapsidee, würde Bea, meine Farbstylistin, sagen.
Endlich kam Aljoscha durch die Drehtür, mit einer viel zu dünnen Jacke bekleidet, die Hände tief in den Taschen, aus der das scheußliche rote Schlüsselband hing, das Werbegeschenk, das er bei seinem Münchenbesuch im vergangenen Sommer von der Kaufingerstraße mitgebracht hatte. Das Ersatzband mit den edel eingewebten Pferdeköpfen, das ich ihm gleich darauf von der Maximilianstraße mitgebracht hatte, war wohl perdu. Aber so richtig gefallen hatte ihm das [8] edle Luxusteil, glaube ich, nie. Während Aljoscha das Rosakäppchen begrüßte, steckte der Mann an der Säule sein Telefon weg und ging auf die beiden zu, mit Ziehharmonikafalten im Jackett und Knittern in den Kniekehlen, die Hochwasser machten. Aljoscha lächelte erleichtert, streckte ihm die Hand entgegen und verbeugte sich aus der Hüfte, als ob er auch Anzug und Krawatte trüge. Die Frau bot dem Russen ihre Hand zum Kuss, huldvoll, wie eine Fürstin am Zarenhof. War das ein zufälliges Treffen? Aljoscha winkte. Ich? Er winkte mich zu der Runde.
»Darf ich vorstellen?«, sagte Aljoscha. »Mein Freund Tomas Prinz, zu Besuch aus München. Tomas, das ist Katharina Nikolskaja. Und Vladimir Hausmann, ein Kunde von uns.«
»Freut mich«, sagte die Nikolskaja. »Ich habe schon viel von Ihnen gehört.«
Ich antwortete: »Ganz meinerseits«, sagte zu Hausmann: »Sehr angenehm!«, und schüttelte Hände. Das war also Aljoschas Chefin, die Frau, der eine der wichtigsten Galerien in Moskau gehörte. Aljoscha hatte schon als Student für sie gearbeitet. Und war das etwa der neue Sammler, von dem Aljoscha erzählt hatte, seine größte Sorge sei, dass er nicht wisse, wohin mit seinem Geld? »I like your hat«, sagte ich zu Katharina Nikolskaja.
Sie lächelte, schlug die dunkel schattierten Augenlider nieder, eine Sekunde zu lang, und sah an mir vorbei auf den Weihnachtsbaum. Das Anhängsel von Aljoscha interessierte sie nicht.
»Sei nicht so empfindlich«, sagte Aljoscha, als wir uns durch die Drehtür ins Freie schoben. »Es geht hier ums [9] Geschäft. Ich musste Katharina mit Hausmann bekannt machen, das war’s.« Er stellte mir den Pelzkragen auf. »Jetzt habe ich frei. Wir können heute tun, was wir wollen. Und ich weiß auch schon, was.«
Er hatte recht. Ich war hier nicht die Hauptperson, war auf Urlaub, neugierig auf Aljoschas Leben und die russische Seele, die vielleicht Abgründe hat, wie die der Raskolnikows und Karamasows in den dicken Dostojewskij-Wälzern auf meinem Nachttisch. Der Nieselregen ging in Schnee über, die Flocken schaukelten um uns herum und setzten sich über Umwege auf Aljoschas geknoteten Schal. Ich betrachtete zum hundertsten Mal die bunten Zwiebeltürme der Basiliuskathedrale, das Prunkstück am Roten Platz. Ich hatte gelesen, dass Zar Iwan der Schreckliche den Baumeister dieser Kirche blenden ließ, damit er nie wieder etwas so Schönes erschaffen konnte. Ich finde die Kirche mit den bizarr geformten Dächern und den exzentrischen Farben eher schrill als schön und die russische Geschichte ziemlich brutal.
Aljoscha wartete geduldig. Ich fragte: »Womit verdient dein Russe eigentlich sein Geld?«
»Er handelt mit gefrorenem Fisch.«
»Und ist Kunstkenner?«
»Er legt sein Geld in Kunst an. In moderner Kunst. Das ist für einen russischen Sammler eher ungewöhnlich. Wer Bilder kauft, investiert meistens in die alten Meister, Goya zum Beispiel. Oder die klassische Moderne, Monet, Picasso, Chagall, Dalí. Sie kaufen, was sie kennen und schon einmal im Museum gesehen haben.«
»Aber so ein Dalí ist doch unbezahlbar!«
Aljoscha zuckte die Achseln. »Gegenwartskünstler haben [10] bei uns kaum Chancen, erst recht, wenn sie unbekannt sind. Das macht das Geschäft so schwer. Hausmann ist eine Ausnahme. Er will Maler, die erst im Kommen sind. Das ist schlau. Die Zukunft liegt in der modernen Kunst.«
»Klingt nach einem harten Business.«
»Es ist knallhart, Tomas.« Aljoscha grinste.
»Ist Hausmann etwa einer von diesen reichen Russen?«
»Reich ist er schon. Aber mit diesen schrillen Reichen will er nichts zu tun haben. Er will kultiviert sein. Ich glaube, deswegen versteckt er seine Freundin. Ich habe sie nur einmal gesehen, aber sie hat irgendwie von allem zu viel: zu viel Lidschatten, zu viel Gold, zu viel Pelz. Er zeigt sich nicht mit ihr, weil er sich vor uns mit ihr geniert.«
Wir schlenderten entlang der Moskwa, dem grauschwarzen Moskau-Fluss, durch einen kleinen Park. Unter den Bäumen schauten die kurzen Stoppeln der Grashalme durch eine schüttere weiße Decke. Der Wind arbeitete wie ein Straßenkehrer und fegte den Schnee vor unseren Füßen hin und her. Ein Besen, dachte ich, ein Schneebesen. Ich zog den Kragen enger und fragte: »Wo gehen wir eigentlich hin?«
»In die Tretjakow-Galerie.«
»Wir machen in Kunst?« Das war also die Überraschung.
An einem Denkmal, einer Büste, buchstabierte ich die geschwärzten kyrillischen Lettern im Sockel: Ilja Repin.
»Jetzt komm schon!«, rief Aljoscha.
Wir schlitterten über die Brücke, die im Bogen über die Moskwa führt, und hielten uns aneinander fest. Aljoschas Hände waren ganz rot, ich versuchte sie mit meinem Atem zu wärmen. Diese Gegend kannte ich nicht. Kleinere Straßen, kaum Verkehr, fast eine Münchner Dimension in [11] dieser Zehnmillionenstadt. Immer wieder vergleiche ich Aljoschas riesiges, anonymes Moskau mit meinem kleinen München, wo man sich kennt und die Welt noch ordentlich ist. So dachte ich jedenfalls.
»Schau mal«, sagte Aljoscha. Hinter wackligen Stellwänden aus Beton ragten fünf halbfertige Glastürme in den Winterhimmel. »Das neue, protzige Moskau, gebaut von Architekten aus den Niederlanden. Das ist Putins Zeit. Vorher parkten hier unsere Denkmäler aus der Sowjetzeit, die niemand mehr sehen will – Lenin, Stalin, Dshershinskij und wie sie alle heißen. Sie hatten meistens diesen wehenden Mantel und einen ausgestreckten Arm, heroisch, ungefähr so! Standen in der ganzen Stadt herum, überall auf den Plätzen. Verflixt, dass du sie nie gesehen hast.«
Auf dem Bauschild las ich: »Russische Avantgarde«. Als ob es hier um Kunst ginge.
»Geranien wie bei euch in München, am Rathaus am Marienplatz, kannst du hier vergessen. Die wirst du auch im Sommer nicht finden«, sagte Aljoscha.
Mein Telefon klingelte. Ich benutze es nur auf Reisen, damit man mich im Notfall erreichen kann.
Es war Bea. »Stör ich?«
»Wir gehen ins Museum.«
»Du weißt, wir würden dich nicht anrufen, wenn es nicht dringend wäre, aber ich muss dir etwas erzählen. Vorhin war hier ein Mann im Salon, den wir alle ziemlich merkwürdig fanden.«
»Wieso?«
»Er sah nicht gerade wie ein Penner aus, war aber ziemlich abgerissen. Uns war sofort klar, einen Haarschnitt will [12] der nicht. Aber weißt du, wen er sprechen wollte? Ausgerechnet dich. Wir haben ihn gefragt, um was es geht, aber er wollte nicht mit der Sprache rausrücken.« Bea war ganz atemlos. »Stand da, guckte sich im Salon um und ließ sich einfach nicht abwimmeln. Wir hatten den Eindruck, er kennt dich. Und weißt du, was er gesagt hat? Dass es für dich wichtig ist, mit ihm zu sprechen. Und zwar bald.«
»Bea, stopp! Ich verstehe gar nichts. Wer soll das sein? Ich kenne so einen Mann nicht. Wie sah er denn aus?«
»Na, abgerissen.«
»Das sagt mir überhaupt nichts. Ruf mich bitte an, wenn er noch einmal auftaucht. Und macht euch keine Gedanken.«
»Geht klar.«
Ich steckte das Telefon wieder ein.
»Stimmt etwas im Salon nicht?«
»Ein komischer Typ wollte mich sprechen, und jetzt sind alle aufgeregt. Komm, was soll’s.«
Am Ende der Straße stand eine Wand aus Reisebussen. Einer parkte aus und riss eine Lücke, doch der Nächste rückte gleich nach und stopfte das Loch. Die Frau, die ihren roten Regenschirm in die Luft gestreckt hielt, kümmerte es nicht, dass das Dach ihr keinen Schutz bot vor den Flocken, die immer übermütiger tanzten. Eine Gruppe Anoraks trottete hinter ihr her, durch eine Eisenpforte in einen Hof hinein, in dem andere Gruppen um ihr Zentrum, ihre Reiseführerin, klumpten. Manche hielten Plastiktüten oder Zeitungen über dem Kopf. Ich fragte: »Wo wollen die denn alle hin?«
»Ins Museum, in die Tretjakow-Galerie.«
»Da müssen wir uns jetzt anstellen?«
[13] Der Wind lärmte, und Aljoscha konnte mich nicht hören. Er steuerte auf die Tür zu, hinter der ein Wachmann lehnte, die Mütze in den Nacken geschoben, gestützt vom steifen Stoff seiner Uniform. Den Arm hatte er lässig auf seinem Maschinengewehr abgelegt und ließ die Menschen an sich vorüberziehen, als wären es die Bilder eines Films, den er schon tausendmal gesehen hatte. Aljoscha lief im Galopp die Treppe hinunter ins Untergeschoss, immer an der Wand entlang, auf dem schmalen Pfad, den niemand aus der Masse nutzte, die sich schwatzend nach unten schob. Ich rannte ihm hinterher. Museumsbesuche können eine Strafe sein. Zu viele Menschen, unterirdische Gänge, umständlicher Kartenkauf. Aber ich hatte Aljoscha, der mich ins Museum schleift, mir etwas über die Bilder erzählt und es manchmal schafft, mich für Kunst zu begeistern und vom Salon abzulenken, wo sie sich jetzt wahrscheinlich über den geheimnisvollen Fremden den Kopf zerbrachen und sich fragten, ob ich ihnen nicht etwas verschwieg.
Oder kannte ich den Fremden vielleicht doch?
Aljoscha ging, ohne auf die Schlange zu achten, an einen Schalter, krümmte den Rücken und fragte: »Lenka, hast du zwei Karten für mich?«
Er kannte sich aus. Jemand schob zwei Papierschnipsel durch das kleine Türchen.
Aljoscha zeigte mit dem Finger auf mich: »Das ist Tomas.«
»Hallo«, sagte ich. Ich konnte kein Gesicht hinter der Scheibe erkennen und fragte: »Was macht das?« Meine Brieftasche war voller Papier, man muss die Rubelscheine nach Größe sortieren, um nicht die Übersicht zu verlieren.
[14] »Der Besuch ist umsonst.« Aljoscha lachte, und ich stand da, mit den Scheinen in der Hand und meinem Einwand, ich, als reicher Ausländer, wolle dieses Museum nicht umsonst besuchen. »Ich bin kein Schmarotzer.«
Aljoscha schlug vor: »Dann spendest du unser Eintrittsgeld draußen einem Bettler, okay? Der Preis für Touristen entspricht ungefähr einer Monatsrente.«
Wir durchquerten die Räume mit den Ikonen. Die Gesichter, die aus den goldenen Rahmen schauten, lächelten und wirkten dennoch finster. Dann tote Fische und Federvieh mit Früchten, Zinn und Glas auf Seide dekoriert, ich weiß schon, die holländischen Meister. Weiter, in den nächsten Saal.
»Aljoscha, warte mal!«
Ich blieb vor einem Gemälde stehen. Zerlumpte und verschwitzte Männer, die unter großen Mühen ein Schiff stromaufwärts ziehen, russische Kerle.
»Die Wolgatreidler. Versklavte Menschen.« Aljoscha sprach leise. »Jedem kannst du seine Geschichte, sein Schicksal, seine Qual am Gesicht ablesen, selbst wenn es nur eine Nebenfigur ist. Und siehst du, wie viel Kraft in ihnen steckt? Repin zeigt das, ohne zu idealisieren oder mit irgendeinem Schönheitsideal zu verwässern. Das ist etwas völlig Neues gewesen in der russischen Malerei.«
»Russischer Realismus?« Auch ich flüsterte.
»Das Bild hat er als Student gemalt, so um 1870 herum. Sozialer Protest war auch damals nicht gefragt. Repin hat einfach immer behauptet, er bilde das alltägliche Leben ab.«
Ein Stück weiter erzählte eine Frau ihrer Gruppe mit leisen, eindringlichen Worten eine dramatische Geschichte. Die [15] Leute hörten stumm zu und zogen stumm weiter. Wir rückten nach.
Dieses Bild war viel kleiner als die Wolgatreidler. Ich trat einen Schritt näher. Ein Greis hält einen sterbenden Mann im Arm, drückt den leblosen Kopf mit der blutenden Wunde an seine Brust, das blanke Entsetzen im Gesicht. Der reuige Mörder und sein wehrloses Opfer?
»Iwan der Schreckliche mit seinem sterbenden Sohn, den er erschlagen hat«, sagte Aljoscha.
»Derselbe Iwan, der auch den Baumeister von der Basiliuskathedrale blenden ließ?«
Aljoscha nickte. »Eine wahre Geschichte. Wusstest du eigentlich, dass Iwan auf Russisch gar nicht der Schreckliche ist, sondern der Drohende? Schau mal, wie Repin die Lichter setzt. Und wie das Rot und das Rosa in der Düsternis hervortreten.«
Iwan der Schreckliche war hier nicht schrecklich, sondern selbst zu Tode erschrocken. Ein Mörder, der bereut und die Tat nicht rückgängig machen kann. Ich dachte an den Mord an meiner Kundin, der mich im vergangenen Sommer in Atem gehalten hatte. Warum bringt jemand einen anderen Menschen um? Wie groß muss die Kränkung sein, die Wut, die keine Kontrolle kennt? Und dann das Entsetzen über die eigene Tat. Das alles ist in dem Bild eingefangen. Dieser Repin gefiel mir.
Daneben hing noch ein Bild von ihm, noch eine Geschichte. Ich trat näher. Etwas hielt mich fest. Ein behagliches Zimmer. Ein Mann kommt in die Stube getappt, ausgezehrt sieht er aus, mit tiefen Ringen unter den Augen. Wahrscheinlich kehrt er aus dem Krieg heim. Eine alte Frau in Schwarz [16] geht auf den Mann zu, fassungslos, als hätte sie eine Erscheinung. Vielleicht ist sie die Mutter, die den Sohn für tot gehalten hatte, oder die Ehefrau. Eine Dienstbotin in der offenen Tür ist die stumme Zeugin dieser Begegnung. Ein dramatischer Moment. Rechts, am Bildrand, sitzt ein Geschwisterpaar am Tisch. Der kleine Junge reckt den Hals, betrachtet den Ankömmling neugierig, will nichts verpassen und den Fremden sicher bald mit Fragen bestürmen. Das Mädchen dagegen duckt sich skeptisch und zurückhaltend, beinahe ängstlich. Der Mann muss jahrelang fort gewesen sein, die Kinder erkennen ihn nicht. Irgendwie waren mir die Geschwister vertraut. Ich wusste nicht, woher. Hatte ich das Bild schon einmal gesehen? Wohl kaum. Ich schaute auf das kleine Täfelchen und entzifferte: Neožidanno. Ich hatte das Wort einmal gelernt und suchte nach der Bedeutung. Ich bemerkte eine Museumswärterin, die sich in Pantoffeln zu mir stellte, als wäre ihr das Bild auch schon lange nicht mehr aufgefallen. Unerwartet! Klar, das Bild heißt: Unerwartet. Plötzlich steht jemand in der Stube, von dem man gar nicht wusste, dass er existiert, oder von dem man sogar dachte, er sei tot, und plötzlich verändert sich alles – das ganze Leben.
Aljoschas Stimme: »Tomas, wo bleibst du denn?«
[17] 2
Wann hatte ich eigentlich zum letzten Mal einen Lockenwickler in der Hand gehabt? Ich hatte Aljoscha versprochen, Babuschka die Haare zu machen, als wir im Café gegenüber der Tretjakow-Galerie saßen und heiße Schokolade tranken. Die Sahne lud ich in Portionen auf seine Tasse um, damit sie sich bei mir nicht in Ringen um Bauch und Hüften legt. Aljoscha löffelte die weiße Fracht wie Joghurt und erzählte, dass er als Kind oft mit Babuschka ins Museum gefahren war, mit der Straßenbahn, bei schönem Wetter ein Eis und manchmal zur Kindervorstellung ins Kino, »und alles für einen Rubel«.
Wie anders ich aufgewachsen bin. Ich legte ein paar Scheine auf den Tisch. »Komm, Babuschka wartet.«
Im nassen Ostwind liefen wir durch Schneematsch auf den Pavillon zu, dessen Schwingtüren uns ins Innere der Metrostation wedelten. Vor der Rolltreppe hingen Zeitschriften auf der Leine, wie Wäschestücke zum Trocknen. Ich entdeckte viele westliche Magazine.
»Jetzt komm schon!«, rief Aljoscha.
An der automatischen Schranke zur Metro war ich unsicher, prüfte, wie herum man das Ticket mit dem Magnetstreifen in den Automatenschlitz steckt. Sofort war Gedrängel in meinem Rücken. Ein Uniformierter schrie mich an, [18] ich verstand nicht das Wort, aber die Geste. Aljoscha war schon durchgegangen, vorne in der Menge sah ich seine wirren, dunklen Haare zwischen Mützen aus Pelz und meliertem Strick. Fremde schubsten mit ihren Taschen und Beuteln. Ich machte einen schnellen Schritt, ergatterte den Platz hinter Aljoscha auf der Rolltreppe, die wie eine Sortiermaschine Ordnung in den Haufen brachte, die Menschen rechts stellte, hintereinanderstufte und sie ruhig und zügig viele hundert Meter in die Tiefe transportierte. Links war freie Bahn für Eilige, die entlang der Leuchten galoppierten. Gegenüber, auf dem Weg ans Tageslicht, küsste sich ein Liebespaar, andere lasen, schwatzten oder träumten sich in diesen dreieinhalb Minuten mit glasigen Augen an einen anderen Ort, berieselt von der Stimme aus dem Lautsprecher, die, wenn ich es richtig verstand, für Urlaubsreisen ins Ausland warb und tausend Ohren immer wieder dieselbe Telefonnummer vorsagte, die niemand von hier aus anrufen konnte. Es gab kein Netz.
Unten schritten wir durch hohe Gewölbe, sahen goldene Ornamente und hellen Marmor, Brücken mit verzierten Geländern als Übergang zu anderen Linien. Jeder Bahnhof begeistert mit einer anderen Pracht. Schon gestern war ich mit dem Kopf im Nacken durch die Metrostation ›Majakowskaja‹ gegangen, hatte wie im Museum die runden Mosaikbilder im Deckengewölbe betrachtet: schlanke Körper beim Sprung ins Wasser, pfeilschnelle Flugzeuge am blauen Himmel, lachende Pioniere mit flatterndem Halstuch, beinahe kindliche Visionen von Schönheit, Kraft und Fortschritt. Die Züge fuhren mit Getöse im Zwanzig-Sekunden-Takt ein. Frauen saßen auf einer Bank unter einem kolossalen Leuchter und [19] warteten, dass Zeit vergeht, bevor sie die Reise nach Hause antreten. Achtung! Die Türen werden geschlossen! Wir schossen durch den schwarzen Tunnel von Station zu Station, und eine Stimme verkündete über Lautsprecher die Namen, ›Schabolowskaja‹, ›Nowyje Tscheremuschki‹, ›Tjoplyj Stan‹, näselnd und feierlich, als erwarte einen dort noch etwas anderes als übereinandergestapelte, genormte Wohnungen, in denen Kinder, Ehemann, Großeltern nach Essen, Liebe und sauberer Wäsche verlangen.
Am Ausgang der Metro ließ sich Aljoscha an einem Stand Essiggurken in viel zu kleine Tüten verpacken, ein Mitbringsel für Babuschka. Keine Blumen?
Ich folgte ihm auf dem Trampelpfad in die Hochhaussiedlung. Bei meinem ersten Besuch vor eineinhalb Jahren hatten hier überall Blechbehälter gestanden, russische Garagen, kreuz und quer. Jetzt gingen wir an einer ordentlichen Reihe von Stellplätzen entlang, Garagentor an Garagentor, wie in München, am Hasenbergl.
Ich spürte, wie das Telefon in der Manteltasche klopfte. »Bea?«
»Er war wieder hier, kurz vor Ladenschluss, und weißt du was? Jetzt sah er plötzlich ganz anders aus. Man könnte sagen, fast adrett. Jedenfalls waren seine Haare frisch gewaschen.«
»Ja, und?«
»Er war genervt, dass du immer noch nicht da bist! Tomas, bist du sicher, dass du ihn nicht kennst?«
»Beschreib ihn doch mal!«
»Ziemlich groß, schlank, ein bisschen schlaksig, dunkle Haare. Sagt dir das etwas?«
[20] »Solche Typen sehe ich jeden Tag zu Dutzenden.«
»Aber er hatte so Ringe unter den Augen.«
Ich überlegte. Mein Schwager Christopher hat Augenringe, weil der Computer ihn müde macht. Aber im Salon kennen sie Christopher. Ob ich so einem Typen auf einer Party in London begegnet bin? Vielleicht im ›Tramps‹? Oder bei Mutter in Zürich?
»Bist du noch dran?«, fragte Bea endlich.
»Hat er denn diesmal gesagt, was er will? Ist es geschäftlich?«
»Wir hatten nicht den Eindruck, dass es etwas mit dem Salon zu tun hat.«
»Habt ihr ihm gesagt, wann ich wiederkomme?«
»Nur so ungefähr. Er weiß jetzt, dass du Anfang der Woche im Salon bist. Das mussten wir ihm sagen. Sonst wären wir ihn gar nicht losgeworden.«
»Ist in Ordnung.«
»Bleib bitte dran. Da ist noch etwas. Ich hatte nämlich einen Traum, genau in der Nacht, bevor dieser Typ hier bei uns aufgetaucht ist. Ein Fremder, keine gute Aura. Das hat doch etwas zu bedeuten! Wenn du mich fragst, eine Bedrohung. Es ist zwar nur ein Traum…«
Die wackligen Fahrstuhltüren in Babuschkas Hochhaus schlossen sich hinter uns, die Verbindung brach ab, und die Träume meiner versponnenen Farbstylistin verloren sich im Äther zwischen München und Moskau.
»Gibt es etwas Neues?«, fragte Aljoscha.
»Der Typ war wieder da. Bea klang ziemlich durcheinander. Ob da etwas faul ist?«
»Bei dir im Salon verkehren doch viele komische Vögel.«
[21] Der Fahrstuhl hielt im achten Stock.
»Babuschka«, schrie Aljoscha. »Tomas ist hier. Er macht dir die Haare. Die Haare macht er dir! Für heute Abend.«
Die Gardine mit den groben Maschen schaukelte vor dem Fenster in der Heizungsluft und schluckte das letzte Tageslicht. Auf dem Sofa lagerte ein dunkler Berg, Aljoschas Großmutter, Nina Pawlowna. Sopran und Tenor zankten sich im Radio. Babuschka ist schwerhörig. Sie schaute ihren Enkel an. Hatte sie ihn verstanden?
Sie fragte: »Wo?«
»Im Großen Saal! Du hast doch einen Auftritt. Dein Auftritt mit dem Chor!«
»Wo ist er?«
»Hier«, sagte ich und drückte ihre Hand, gelbe Haut mit braunen Flecken, weich und warm. Ihre trüben Pupillen fixierten mich. Meine Hand ließ sie nicht los.
»Wir müssen die Haare waschen!«, sagte ich. »Haare waschen!«
Ich zog sie hoch. Sie fand die Pantoffeln blind, hatte aber kaum Kraft in den Beinen. Langsam, wie auf Langlaufski, fuhr sie die bekannte Strecke ins Badezimmer. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie heute Abend die Wohnung verlassen, auf eine Bühne treten und Lieder singen würde. Im Badezimmer war ihr der Waschbeckenrand eine Stehhilfe, mit der anderen Hand winkte sie mich heran, immer näher, als ob sie mir ein Geheimnis verraten wollte. Babuschkas Atem kitzelte meine Ohrmuschel, als sie heiser fragte: »Der Hocker?«
Gute Idee. Babuschka kennt einzelne deutsche Wörter, wahrscheinlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ob der [22] deutsche Offizier ihr befohlen hatte, einen Hocker zu bringen und ihm die Stiefel auszuziehen?
Aljoscha schrubbte in der Küche die Lockenwickler wie Kartoffeln, bis unter dem grauen Filz aus Staub und Haaren das fleischfarbene Gitternetz zum Vorschein kam. Die Dinger waren wahrscheinlich seit Jahren in der Schublade der Kommode herumgekullert. Ich holte ein Kissen vom Sofa, legte es auf den Hocker und stellte ihn ans Waschbecken. Babuschka hatte ihr Haar geöffnet, es fiel grau bis über die Schultern. Sie kletterte mit den Knien auf den Hocker, die Krümmung des Rückens half ihr, den Kopf über das Becken zu halten. Ich drehte den heißen Hahn auf, mischte kaltes Wasser dazu, prüfte mit dem Handrücken, wie wir es auch immer im Salon machen. Die Temperatur ändert sich manchmal.
»Ça va?« Nein. Wie sagt man das auf Russisch?
Babuschka murmelte dreifache Zustimmung: »Da, da, da.«
Der Schlauch vom Brausekopf reichte kaum von der Badewanne zum Waschbecken. Quer durchs Porzellan ging ein Sprung mit vielen Ästen. Ein Schrott-Badezimmer.
Auf dem Regal hinter dem Vorhang fand ich zwischen bunten Plastikflaschen und verwaschenen Handtüchern das Shampoo aus meiner Pflegeserie, das über Aljoscha den Weg aus München bis in diesen dunklen Raum gefunden hatte. Die hellgrüne Flüssigkeit glitzert in der Handfläche wie kristallklares Meerwasser, eine Farbe ähnlich dem Anhänger mit dem Topas, den meine Schwester Regula von Mutter zum dreißigsten Geburtstag bekommen hatte. Ich drückte meine Finger mit den Kuppen an Babuschkas Schädel, wanderte in [23] kleinen Kreisen vom Nacken hinter die Ohren, über den Scheitel zum Haaransatz und zurück. Der Schaum legte sich in winzigen Bläschen ums Haar und verströmte den Duft frischer Minze. Babuschka seufzte zufrieden. Früher hatte sie als Chemikerin gearbeitet, Äther gerochen, Natron und Buttersäure. Ich stellte sie mir im weißen Kittel vor, das Haar noch dunkel, unter einer Haube. Aljoscha hatte mir erzählt, dass sie an Insulin geforscht, mit Lachsen experimentiert und auf Kongressen im Ausland Vorträge gehalten hatte. Wahrscheinlich hatte sie auch damals schon im Damenchor der Kriegsveteranen gesungen.
Während ich beim Spülen mit der Hand Ohren und Nacken schützte, dachte ich: Nichts Geschäftliches. Etwas Privates. Tut mir leid, ich kann mit dieser Geschichte von dem fremden Mann nichts anfangen. Wo war eigentlich mein Telefon?
Ob Babuschka schon die Knochen schmerzten? Aber sie kniete stabil auf dem Hocker. Ich beschloss, den Conditioner aufzutragen, den ich vorsorglich eingepackt hatte. Die Spülung mit dem Kokosextrakt schließt die Schuppenschicht. Ich kämmte bis in die Spitzen ein, aber sparsam, und mied die Kopfhaut. Die Frisur würde sonst zu schwer werden. Das Wasser suchte sich seinen Weg durch die Haare, machte sie dunkler, als sie eigentlich sind, und ich dachte an die ›Kascha‹, diesen grauen Brei aus Buchweizen, den Babuschka zum Frühstück kocht, weil er gegen Krankheit helfen soll und angeblich die Widerstandskräfte stärkt. Großmutter und Enkel passen aufeinander auf, das war schon immer so. Früher reisten Aljoschas Eltern als Botschaftsangehörige in andere Länder, und Babuschka achtete daheim bei den [24] Hausaufgaben ihres Enkels auf Schönschrift und zog sonntags weiße Schnürsenkel in die Kinderschuhe. Heute ist Aljoscha zwar oft unterwegs, wie gestern mit diesem Hausmann, immer auf der Suche nach Kunst und Käufern für die Kunst. Aber übernachtet hatte er, statt bei mir im Hotel, wie immer hier draußen im Plattenbau. Das muss man verstehen. Babuschka ist über achtzig, fast taub und hilfsbedürftig. Ich war trotzdem enttäuscht.
Die Heizungsluft hatte das Handtuch hartgetrocknet, und mein Versuch, das Haar damit zu streicheln, war vergebens. Ich half Babuschka vom Hocker, ging mit ihr ins Zimmer und setzte sie auf den Stuhl, der neben ihrem Diwan steht.
Mein Telefon war noch in der Manteltasche, der Klingelton abgestellt. Ich aktivierte ihn, nur für alle Fälle.
Babuschka hatte sich entspannt zurückgelehnt und die Beine übereinandergeschlagen. Sie kennt die Prozedur. Ich rollte die erste Strähne auf den Lockenwickler bis zum Haaransatz und steckte die Nadel eng an der Kopfhaut durch die Rolle. Den nächsten Wickler befestigte ich am ersten und verband so Wickler mit Wickler. Bei der Länge der Haare hatte ich viel zu drehen, fünf Reihen.
Babuschka rief nach Aljoscha. Brauchte sie etwas zu trinken?
Ich montierte am Fön den schlaffen Ballon, der die Trockenhaube simuliert, und entfernte die erste Nadel. Sie würde sonst, von der heißen Luft erhitzt, auf der Kopfhaut glühen und an der Stirn einen Abdruck hinterlassen.
Aljoscha öffnete Schranktüren und brachte Papiere, lose geheftet. Verträge? Nein, Noten.
[25] »Ein Glas Wasser?«, fragte ich. »Möchten Sie ein Glas Wasser?«
Babuschka nickte.
Ich steckte den Fön an die Stange und richtete die Haube dicht über dem Kopf aus. Der Fön surrte. Babuschka fuhr mit dem Finger die Noten entlang und bewegte die Lippen.
Manchmal, hatte Aljoscha erzählt, stehe sie am Fenster und starre in den Himmel. Die Wolken, sagt sie, kennt sie alle. Sie hat sie alle schon einmal gesehen. Die Sonne geht unter, und sie steht immer noch so da, bis es dunkel wird und sie sich auf den Diwan legt. Aljoscha spricht mit ihr, erzählt und fragt, aber sie antwortet nicht. Er isst und trinkt, aber sie rührt den Teller nicht an. Früher, sagte Aljoscha, habe er mit ihr das Sterben geübt. Es war ein Spiel. Beide mussten die Augen schließen und sich konzentrieren. Blinzeln und Sprechen war verboten. Zusammen warteten sie und wünschten den Tod herbei. Was, wenn sie in genau dem Moment gestorben wäre?
Der Fön surrte und surrte. Ein Notenblatt segelte auf den Boden. Aljoscha legte die Füße hoch und schloss die Augen. Mir war, als ob Babuschka leise summte. Und irgendwo in München wartete dieser Mann mit den Augenringen auf meine Rückkehr.
Wir sollten Babuschka ein neues Badezimmer kaufen.
Es war ein Fest in Sonntagskleidern. Die Frauen trugen gebügelte, gestärkte Blusen, die Männer Anzüge mit Polyesteranteil und breiter Krawatte. Viele hatten Blumen in durchsichtiger Folie dabei, langstielige Nelken, bis zu fünf Stück, in Farben wie die bunten Drops aus Mutters Verlust [26] bringender Bonbonfabrik. Ich fingerte in der Innentasche meines dunklen Jacketts nach der Eintrittskarte. Aljoscha war hinter der Bühne bei Babuschka. Eine Krawatte hatte ich nicht umgebunden.
Die Uniformierte beim Einlass musterte mich mit Augäpfeln, die so rosa waren, als wäre sie lange Zeit gegen den Wind gegangen. »Ausländer?«, fragte sie.
Was würde jetzt passieren?
Die Frau riss meine Karte durch und ließ mich vorbei.
Die Frauen standen auf Strümpfen, verstauten ihre gefütterten Stiefel in Plastiktüten und stiegen in mitgebrachte Lackpumps um. Mädchen hüpften umher, dass ihre riesigen Haarschleifen wie Schmetterlinge auf und nieder flatterten. Man begrüßte einander, umarmte sich, winkte. Es war wie bei einem Klassentreffen. Zur Feier des Tages kamen die Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Kindern und Kindeskindern zusammen.
Ich kaufte mir an der Bar einen jener rubinroten Cocktails, die in bauchigen Gläsern auf einem Quadratmeter bereitstanden, und wanderte auf knarrendem Parkett umher. Auf einer Bank hockten kahlköpfige Männer, denen graue Haare aus Ohren und Nasenlöchern sprossen.
Der Saal war ausverkauft. Auf den Sitz neben mir legte eine Frau knisternd ihren Blumenstrauß ab. Ich erklärte ihr mit Gesten und in schlechtem Russisch, dass der Platz besetzt sei. Ob sie mich verstand? Sie lächelte.
Männer im Frack nahmen mit ihren Instrumenten den Orchestergraben ein. Ich klatschte, ein paar Leute klatschten mit. Als das Licht in den elektrischen Kerzen der Kronleuchter erlosch, rutschte Aljoscha neben mich. Seinen [27] Tweedanzug mit Weste hatten wir auf der Münchner Maximilianstraße gekauft, als wir klatschnass vor einem Platzregen in einen der Herrenausstatter mit den messingbeschlagenen Schaufenstern geflüchtet waren. Es war das Ende des Sommers. »Ich bin doch kein Landarzt«, hatte Aljoscha zu seinem Spiegelbild gesagt. Der Verkäufer hatte nur den Kopf geschüttelt, mit einer Abwärtsbewegung den Stoff am Rücken geglättet und klargemacht: Der oder keiner. Von der goldenen Krawatte hatte ich Aljoscha abgeraten, aber jetzt gefiel sie mir.
»Ist sie okay?«, fragte ich. Ich meinte Babuschka.
Aljoscha nickte.
Vorne beendeten Geige, Bratsche, Oboe und Cello ihr schräges Katzenkonzert. Jemand räusperte sich in der Stille.
Die Damen kamen in zwei Reihen auf die Bühne, die eine von rechts, die andere von links. Die Blusen waren smaragdgrün, die Röcke lang und schwarz. Dann eine dritte Reihe Damen, noch älter, noch gebrechlicher, ganz in schwarz. Babuschka stand vorne, als Siebte von rechts, fast in der Mitte. Das Haar hatte ich zu gleichmäßigen Wellen gebürstet, am Hinterkopf toupiert und zur Banane eingeschlagen, ganz klassisch. Aljoscha stieß mich beim Klatschen an. Er lachte, und seine Augen glänzten. Babuschka stand wie ein kleiner, windschiefer Baum, der umgefallen wäre, hätten die Frauen rechts und links sie nicht gestützt. Und was waren das für interessante Stickereien auf der Brust? Ich fragte ihn leise.
»Das sind Orden«, antwortete er.
»Orden?«
Jemand zischte verärgert.
[28] »Orden aus dem Zweiten Weltkrieg, dem Großen Vaterländischen Krieg«, flüsterte Aljoscha.
Die Geigen hoben an, ganz zart, die Stimmen des Chors fielen ein, zerbrechlich und eindringlich. Was diese Frauen alles erlebt hatten! Zar Nikolaus den Zweiten, zwei Weltkriege und Lenin. Ich hatte dicke Bücher über die russische Geschichte gelesen, über den Mythos von Väterchen Stalin und das dunkle Kapitel der Säuberungen. Die Begeisterung von Chruschtschow für die amerikanischen Maisfelder. Zuletzt die Perestrojka, der Umbau, die Freiheit, das Chaos. Babuschka ist heute angewiesen auf die Almosen von Tochter und Schwiegersohn, Aljoschas Eltern, die auf Island leben und jeden Monat Geld schicken. Babuschka klagt nicht.
Der Gesang wurde lauter. Ich beugte mich zu Aljoscha hinüber. »Weißt du, was sie singen?«
Er übersetzte flüsternd: »›Denn wir wissen, was Krieg bedeutet.‹«
Mir war elend. Was wusste ich vom Krieg, was wusste ich von diesen Frauen? Als wir Beifall klatschten, bemerkte ich, dass meine Fingernägel mir kleine Kerben in die Handflächen gedrückt hatten.
[29] 3
Er stand auf der anderen Seite der Hans-Sachs-Straße und schaute herüber, zu mir in den Salon. Ich schnitt an meinem Lieblingsplatz, gleich vorne beim Empfang, mit Blick nach draußen. Der Fremde bewegte sich nicht von der Stelle. Unter seinen Lidern, so kam es mir vor, lagen diese Schatten. Mir war klar, das war der Mann. Er beobachtete mich. Ich hatte ihn schon erwartet.
Gestern Abend war ich mit der vorletzten Maschine in München gelandet, war mit dem Taxi über die regennasse Autobahn in die Stadt gefahren, vorbei an leuchtenden Schaufenstern, jetzt weihnachtlich dekoriert, nach Hause ins Glockenbachviertel, in die Hans-Sachs-Straße. Kein Mensch war um diese Zeit unterwegs. Ich schloss die Haustür auf und ging die Treppe hinauf in meine Wohnung. Vor zehn Tagen hatte ich sie verlassen und beim Packen ein Chaos angerichtet. Jetzt war alles aufgeräumt. Meine Putzfrau Agnes hatte die Espressomaschine auf Hochglanz poliert, das Bett frisch bezogen, Mandarinen in die Schale gefüllt und eine Amaryllis in die Vase gestellt. Danke. Als ich die Gepäckstücke verteilte, krachte das Parkett unter meinen Schuhen und zeigte mir mit jedem Schritt, wie still es war. Die Stimmen auf dem Anrufbeantworter riefen nach mir – meine Schwester Regula, angestrengt vom Geschrei ihrer Kinder, Mutter, [30] mit einem geschäftlichen Vorschlag, mein Freund Stephan, liebevoll umständlich. Ich drehte die Heizung auf und legte das Mobiltelefon in seine Schublade, mein Beitrag, um das Leben zu entschleunigen. Eigentlich war alles wie immer. Nur auf meinem Schreibtisch lag ein Paket.
Ich schaute auf den Absender: Tokio. Das erste Weihnachtsgeschenk von einem Frisör-Freund. Innen viel Verpackung und eine flache Schachtel, darin eine neue Schere aus Titan, dieses edle Wundermaterial, das man niemals zu schärfen braucht. Morgen früh, hatte ich mir vorgenommen, würde ich sie gleich ausprobieren.
Der Mann auf der anderen Straßenseite stand immer noch wie eine Säule am Bordstein. Passanten gingen um ihn herum, Autos hielten, rangierten in Lücken und fuhren wieder weg, doch er blieb. Wenn es an diesem Novembertag geschneit hätte, wäre der Schnee auf ihn gefallen, Flocke für Flocke, und hätte irgendwann eine Haube auf seinem Kopf gebildet, wie auf einer Parkuhr.
Ich musste mich auf den Schopf von Theadoras Ehemann konzentrieren, ein Japaner, dessen Namen ich mir nicht merken kann, ein hohes Tier bei einem japanischen Konzern und Vater von Zwillingen. Kerstin hatte seine Haare für mich vorbereitet, sie mit dem Plätteisen geglättet, damit sie wie ein seidiger, schwarzer Pinsel nach allen Seiten fallen. So lassen sie sich ganz wunderbar schneiden. Beim Gerede über die großen Geldanlagen war ich nicht bei der Sache. Was wollte der Mann da draußen? Wenn er nicht endlich hereinkam, sollte ich ihn vielleicht einfach holen. Ich musste aufpassen, japanisches Haar steht störrisch vom Kopf ab, wenn es zu kurz gerät.
[31]