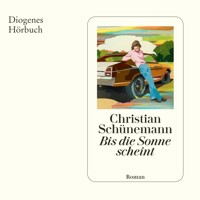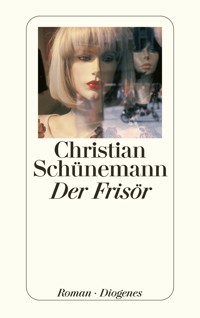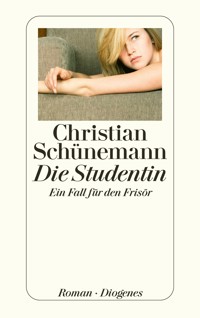9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Milena Lukin
- Sprache: Deutsch
In welche Mühlen geriet das serbische Ehepaar, das sich von falschen Versprechungen und einem verheißungsvollen Rückkehrprogramm in die alte Heimat, das Kosovo, zurücklocken ließ? Die Belgrader Kriminologin Milena Lukin kommt skandalösen Machenschaften auf die Spur, die bis in hohe Kreise der serbischen und europäischen Politik reichen. Wieder ein atmosphärischer, packender Krimi, der ins Herz des Balkans führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Christian Schünemann | Jelena Volić
Pfingstrosenrot
Ein Fall für Milena Lukin
Roman
Diogenes
{5}Der Kriminalfall, der in diesem Roman behandelt wird, beruht auf einer wahren Begebenheit: Im Juli 2012 wurde ein serbisches Ehepaar in seinem Haus in Talinovac, im Kosovo, tot aufgefunden. Beide starben durch einen Genickschuss. Der Doppelmord sorgte in der serbischen Öffentlichkeit für großes Aufsehen und wurde von Regierungs- und Medienvertretern benutzt, um auf serbischer Seite die Stimmung gegen die Kosovo-Albaner anzuheizen und auf kosovo-albanischer Seite gegen die Serben mobilzumachen. Aufgeklärt wurden die Mordfälle bis heute nicht.
Abgesehen von diesem Kriminalfall ist die Handlung im Roman reine Fiktion, und alle auftretenden Personen sind frei erfunden.
{7}1
»Was ist los, Miloš, worauf wartest du? Mach deine Jacke zu, du holst dir noch den Tod!«
Erschöpft wischte er sich mit dem Taschentuch die Schweißtropfen von der Stirn und fuhr sich damit über den Nacken. Jedes Mal zog sich sein Herz zusammen, wenn sie so mit ihm sprach, sich zu ihm umdrehte wie zu einem kleinen Kind und ihn mit dieser Miene anschaute. Das ganze Leid lag darin, und gleichzeitig die Absicht, alles, was passiert war, als gottgewollt hinzunehmen.
Er packte die Henkel und riss die schweren Eimer hoch. Sie hatten gemeinsam so viel erlebt, von dem er gehofft hätte, dass sie es nie erleben würden. Sie hatten ihre Heimat verloren, hatten im Flüchtlingsheim gelebt, hatten ihrer Tochter auf der Tasche gelegen. Jetzt waren sie alt, seine Kraft war am Schwinden und seine Geduld am Ende.
»Es ist gut, Miloš, hörst du? Es gibt keinen Grund zur Klage. Es ist alles bestens.«
Sicher. Sie hatten in der Not immer Freunde gehabt. Auch jetzt wieder, unten in der Siedlung, Menschen, die ihnen zur Seite standen und mit diesem und jenem aushalfen. Wenn die Freunde nicht wären, hätten sie ja nicht einmal diese Eimer! Aber je mehr Ljubinka redete und versuchte, ihn zu beschwichtigen, desto wütender wurde er. {8}Er war bereit, nach allem, was gewesen war, wieder bei null anzufangen, einverstanden, aber er war nicht bereit, sich dabei immer wieder neue Steine in den Weg legen zu lassen.
Ljubinka, ganz kurzatmig, schnappte beim Reden nach Luft. Er sah, wie geschwollen ihre Gelenke waren, wusste, dass ihr die Beine weh taten und das Kreuz und dass sie sich über die Schmerzen nie beklagen würde. Er hasste sich dafür, dass er nicht mehr tun konnte, als täglich die verdammte Pappe in längliche Streifen zu schneiden und ihr um die eisernen Henkel zu wickeln. Ljubinkas Hände waren nicht dafür gemacht, zweimal täglich Wasser zu holen und die Eimer dreieinhalb Kilometer durch die Landschaft zu schleppen. Den Hügel mussten sie noch hinauf, durch den Wald, und die Pappe war schon zerrieben!
»Wir müssen dankbar sein.« Ljubinka keuchte. »Hörst du, Miloš? Hörst du mir zu?«
Die Henkel quietschten rhythmisch, Wasser plätscherte über die Ränder und klatschte in Pfützen auf den Weg und ihre kaputten Schuhe. Wenn er das rissige Leder sah, könnte er heulen. Was hatte Ljubinka früher für Schuhwerk getragen: feine Sandaletten aus geflochtenem Leder mit schmalen Riemchen. Er hatte den Klang ihrer Pfennigabsätze immer schon von weitem gehört, diesen entschlossenen, zuversichtlichen Rhythmus, der ihm heute noch im Ohr war. Er erinnerte sich, wie sie zum ersten Mal so vor ihm stand, auf diesen Absätzen, und ihm bis zum Kinn reichte. Er wollte sie von Anfang an beschützen und auf Händen tragen. Gut war ihr gemeinsames Leben gewesen, voller Zufriedenheit, prall und duftend wie die Pfingstrose in der Abendsonne.
Bis es anfing mit diesem seltsamen Ton. Anfangs schwer {9}zu orten, kam er aus verschiedenen Richtungen, war zuerst leise, aber schon hysterisch, wurde immer lauter und zunehmend aggressiv. Wie Stechmücken, die sich nicht vertreiben ließen. Es gab Nächte, da fand er keinen Schlaf.
Er schrieb damals Briefe und Artikel, empörte sich über die Selbstherrlichkeit, mit der Bürgermeister, Direktoren und andere serbische Entscheidungsträger ihre Macht vor allem dazu gebrauchten, den Cousin, den Schwager und den alten Schulfreund mit Posten und Pöstchen zu versorgen. Angehörige der albanischen Mehrheit wurden systematisch aus ihren Ämtern gedrängt. Auch seinen Vorgesetzten und geschätzten Kollegen, den Albaner Ismail Cama, traf es. Er wurde von hier auf jetzt von seinem Posten als Schuldirektor suspendiert und konnte sich glücklich schätzen, einen Vertretungsjob an der Volkshochschule im Süd-Kosovo zu ergattern. Die freie Stelle als Direktor des Gymnasiums in Priština wurde ihm, Miloš Valetić, angeboten. Ob er die Fähigkeiten mitbrachte, ob er die Mindestanforderungen erfüllte, interessierte niemanden. Er war serbisch, und das war die beste Qualifikation, die man sich zu der Zeit wünschen konnte.
Er lehnte den Posten ab und blieb, was er immer gewesen war: Griechisch- und Lateinlehrer. Ljubinka verstand es nicht. Seine hilflosen Aktionen stempelten ihn zum Querulanten, in den Augen gewisser Kreise sogar zum Verräter, ohne dass irgendetwas von dem, was er tat, sagte oder schrieb, eine besondere Wirkung gezeigt hätte. Zu tief waren bereits die Gräben zwischen Serben und Albanern, zu laut das nationalistische Gegröle. In der aufgeheizten Stimmung demonstrierten junge Albaner immer entschlossener {10}gegen die serbische Politik. Sie wurden verhaftet und im Gefängnis grün und blau geprügelt. Mit allen Mitteln bleute die Belgrader Politik ihnen ein: Wir Serben bestimmen, wo es langgeht; ihr Albaner habt zu gehorchen und euch zu fügen. Und wem das nicht passt, wer sich nicht unterordnet, soll verschwinden.
»Hör auf zu grübeln, Miloš. Wir werden keine Not leiden. Reicht das nicht?«
Schweigend trottete er hinter seiner Frau auf der Grasnarbe entlang. Dort drüben, wo schief der Postkasten stand, waren sie mit dem Bus angekommen, eine Odyssee: über Prizren, mit Umsteigen in Ferizaj, das früher Uroševac hieß, damals, als man sich hier als Serbe noch nicht schämen musste. Mit ihren beiden Koffern und dem Kleidersack waren sie aus dem Bus gefallen, hatten wie zwei Idioten in dieser gottverlassenen Gegend gestanden und nicht gewusst, wohin. Wenn die Kinder nicht gekommen wären und ihnen den Weg gezeigt hätten, hätten sie dort drüben in der Scheune übernachtet, genau dort, wo er später das Stroh für die Matratzen holte. Was für eine Schande. Nach fünfzehn Jahre kamen sie zurück in das Land, aus dem sie einmal hatten fliehen müssen, um ihr Leben zu retten – und das Erste, was er tat: Er wurde zum Dieb. Später hatte der Bauer ihm nachträglich die Erlaubnis erteilt und sie sogar mit dem Nötigsten versorgt: ein paar Decken, Töpfe und – auf Rechnung – Eier, Tomaten und Käse.
Ja, sie hatten Glück gehabt. So wie damals, vor fünfzehn Jahren, als sie mit ihren Koffern in Belgrad ankamen und einen Platz im Flüchtlingsheim am Avala-Berg ergatterten. Wahre Glückspilze waren sie! All die Jahre hatten sie in {11}dieser Notunterkunft gehaust, morgens um einen Platz an der Waschrinne gekämpft, mittags um eine Herdplatte, und abends hatten sie sich das Gezeter und Geschrei der Ehe- und Liebespaare in den Zellen rechts und links angehört. Das Schlimmste: In jeder Sekunde hatte er gewusst, dass daheim, in ihrem Haus in Priština, fremde Leute wohnten, dass sie ihre Möbel benutzten, den Schuhschrank, Ljubinkas Frisierkommode, sein Bücherregal, dass sie aus ihren Tassen den Kaffee tranken und aus ihren Gläsern den Selbstgebrannten. Vielleicht hätten sie sich aufgehängt, wenn die Decke im Flüchtlingsheim nicht so niedrig gewesen wäre und wenn es in ihrem Zimmer zwei Fensterkreuze gegeben hätte – eines für ihn, eines für Ljubinka. Denn in einer Sache waren sie sich immer einig: Wenn sie in den Tod gingen – dann nur gemeinsam.
»Zieh nicht so ein Gesicht, Miloš. Hauptsache, wir haben ein Dach über dem Kopf, und wo Löcher sind, werden wir sie stopfen – es ist ja nicht das erste Mal.«
Im Mondlicht zeichneten sich gegen den fast klaren Himmel die Bäume ab, schwarze Fichten und Buchen. Wenn er erst einmal die Handschuhe hatte und eine Sense, wäre seine erste Tat, das Gras zu schneiden und die Brennnesseln, und wenn er eine Leiter hätte, kämen im Herbst die Obstbäume dran. Und Holz musste er sammeln, jeden Tag so viel, wie es seine Kräfte zuließen. Noch war es lange hin bis zum Winter, aber wenn die kalte Jahreszeit kam, wollte er vorbereitet sein. Ein Leben wie in der Steinzeit. Er dachte an die Worte von Vuk, dem Nachbarn unten in der Siedlung, in der es fließend Wasser gab, Strom, Schuhschränke, Bücherregale, ein gedecktes Dach und alles, was man sonst {12}noch für ein menschenwürdiges Leben brauchte. »Ich spreche zu dir als Freund, und ich warne dich«, hatte Vuk zu ihm gesagt. »Verhalte dich ruhig. Lass die alten Geschichten ruhen und schau nach vorn.«
Alle duckten sich, machten sich klein und hielten das Maul, aber er hatte sich geschworen, eines Tages mit Ljubinka Seite an Seite, ohne Angst, wie früher, vor ihrem eigenen Häuschen zu sitzen und in die vertrauten Sterne zu gucken.
»Vergiss nicht, Miloš, wir haben einen Garten. Wir werden Gemüse anpflanzen, Obst einkochen, Hühner halten, vielleicht eine Kuh. Dann haben wir Eier, machen Schinken, Käse und Marmelade. Du wirst sehen, Miloš, alles wird sich finden.« Er sah, wie sie fragend zu ihm aufschaute, sah die feinen Linien in ihrem Gesicht. War es nicht ein Wunder, dass sie nach fünfzehn Jahren und allem, was passiert war, wieder hier in der Heimat waren?
Er küsste Ljubinka auf die Stirn. »Morgen pflanzen wir eine Pfingstrose«, sagte er und strich ihr über die Wange.
Im Hausflur stellte er müde die Eimer ab, tastete im Dunkeln nach den Streichhölzern, die er griffbereit neben die Kerze auf das Fensterbrett gelegt hatte. Sein Kreuz schmerzte, und seine Finger zitterten von der Anstrengung, er verriss ein Hölzchen ums andere. Ungebremst wehte der Wind durchs Haus, als wären sie auf dem freien Feld. Hatte er die Tür zur Küche nicht zugemacht?
»Liebling?« Keine Antwort. Er fröstelte. Er konnte die Geräusche nicht zuordnen, er fand sich in diesem Haus immer noch nicht zurecht. Seltsam war die Stille.
Er sah den Schatten – zu groß, als dass Ljubinka ihn {13}füllen könnte. Die Schachtel mit den Streichhölzern entglitt seinen Händen und fiel zu Boden. Durch das Loch in der Wand sah er im Mondlicht die Silhouette. Er taumelte, verlor die Orientierung und spürte plötzlich einen Schmerz, seinen Arm auf dem Rücken und eine fremde Kraft.
Er presste die Zähne zusammen. Er wusste, dass sie eines Tages kommen würden, aber er hatte nicht gedacht, dass es schon so bald sein würde. Er fürchtete sich nicht. Nur Ljubinka, seine geliebte Ljubinka sollten sie in Ruhe lassen.
Sie stießen ihn an die Wand, schubsten ihn in den Winkel, in dem auch Ljubinka kauerte, und zwangen ihn auf die Knie. Jetzt würden sie ihm jeden Knochen im Leib brechen. Im Sturz versuchte er, sich abzufangen, schürfte sich die Haut. Er hatte Angst, dass Ljubinka verletzt war, er wollte sie fragen, trösten, beruhigen, sie umarmen und schrie auf. Er spürte etwas Kaltes im Nacken. Er ahnte, was es war, und plötzlich wurde er ganz ruhig. Er durfte Ljubinka nicht erschrecken. Die Gewissheit, dass sie auch diesen letzten Weg zusammen gehen würden, dass Ljubinka nicht allein und schutzlos zurückblieb, erleichterte ihn.
Er griff nach ihrer Hand, die kalt war und feucht und zitterte, und flüsterte: »Hab keine Angst.«
{14}2
Der Wind peitschte in Böen über den Save-Platz, trieb den Regen vor sich her und die Menschen, die aus dem Bahnhof kamen und von dort, wo die Überlandbusse hielten. Mit Regenschirmen, Tüten und Taschen hasteten die Leute an den gelben Taxis vorbei, sprangen über Pfützen, kaputten Asphalt und verrostete Schienen, bis sie die Haltestelle erreichten. Hintereinander schlüpften sie unter das stabile Dach und drängelten sich hinter dem gläsernen Windschutz, der seitlich mit dem Belgrader Stadtwappen verziert war. Nagelneu war dieses Häuschen und dabei so sauber und modern, dass man sich ohne weiteres vorstellen konnte, es würde genau so auch in Berlin, Paris oder einer anderen europäischen Metropole stehen.
Milena Lukin hatte Mühe, sich zwischen all den Leuten hindurchzuschieben, benutzte hier und da sogar ihren Ellenbogen, bis sie so viel Platz hatte, dass sie ihre Tragetasche und die vollgepackte Tüte zwischen ihre Füße stellen konnte. Leider war die schmale Bank so kurz, dass nicht mehr als drei erwachsene Menschen darauf sitzen konnten, und auch nur, wenn sie Körperkontakt hielten. Milena lockerte das Tuch, das sie sich zu eng um den Hals gebunden hatte, und klappte die Bügel ihrer Brille auseinander.
Die Zwölf war die einzige Linie, die auf direktem Weg {15}zum Städtischen Klinikum fuhr. Wenn man dem Fahrplan glauben durfte, verkehrte sie im Zehnminutentakt. Milena ging im Geiste noch einmal die Liste durch: Bananen und Orangen hatte sie eingepackt. Ebenso den Weißkäse, den besonders kräftigen aus Zlatibor. Maisbrot, Petersilie und Paprika. Zwei Stücke von der Blaubeerpita. Und weil Calcium für den Knochenaufbau jetzt besonders wichtig war: Zimtmilch – eine ganze Kanne voll.
Die Straßenbahn rumpelte über die Weiche, und kreischend kam die Zwölf um die Kurve gekrochen. Milena griff rechts und links nach den Schlaufen ihrer Taschen, synchron mit den Leuten und allen anderen im Land, die um diese Uhrzeit den Proviant in die Krankenhäuser schleppten. In allen Krankenhäusern Serbiens war die Besuchszeit auf zwei Stunden am Nachmittag beschränkt, auf die Zeit von zwei bis vier.
Fünfundzwanzig Minuten später stieg sie am Boulevard der Befreiung aus, aber erst auf Höhe der Fakultät für Tiermedizin, ging ein Stück zurück und bog in die Louis-Pasteur-Straße. Die einzelnen Kliniken verteilten sich auf verschiedene Gebäude, die in einer parkähnlichen Anlage standen und früher einmal von einer hohen Mauer umgeben waren. Die Mauer war mit den Jahren und Jahrzehnten durchlässig geworden, aber die Eingangstore, eines in jede Himmelsrichtung, waren geblieben.
Sie betrat das Gelände durch das Nordtor, über die Jovan-Subotić-Straße, benannt nach dem berühmten Chirurgen, der am Ende des neunzehnten Jahrhunderts die Beinschiene erfunden und dieses Krankenhaus gegründet hatte. Die alten Gebäude mit ihren hohen Decken und riesigen {16}Zimmern, Treppen mit hohen Stufen und klapprigen Doppelkastenfenstern, durch die der Wind pfiff, waren für den modernen und effizienten Krankenhausbetrieb ungeeignet, und selbst der Neubau – achtzehn Etagen aus kiesbestreutem Waschbeton –, der in den siebziger Jahren hochgezogen wurde und das Gelände hässlich dominierte, war inzwischen nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Seit dem Zusammenbruch des Sozialismus landete auf dem angrenzenden Hubschrauberlandeplatz kein einziger Hubschrauber mehr, stattdessen parkten dort ungeniert die Autos von Besuchern, Krankenschwestern und Ärzten, als gäbe es kein Fahrverbot.
Sie schleppte ihre Taschen an den Pappkartons der Straßenverkäufer entlang, die hier ein Sortiment aus Unterhosen, Seife und Zahnpasta verkauften, besorgte am Kiosk noch die neueste Tageszeitung und ging zwischen den beiden hohen Pfeilern und blühenden Forsythien zur Orthopädischen Klinik hindurch. Als sie die Stufen der kleinen Freitreppe hinaufstieg, mit dem Ellenbogen die schmiedeeiserne Klinke herunterdrückte und mit der Schulter die schwere Holztür aufstieß, klingelte ihr Telefon.
Schwer atmend lehnte sie ihr Gepäck an den Treppenabsatz und schaute auf das Display. Siniša Stojković, der Anwalt, ihr guter Freund, der sich seit Tagen nicht gemeldet hatte.
Sie drückte auf den grünen Knopf. »Was gibt’s?«
»Hör zu«, sagte Siniša am anderen Ende. »Jetzt habe ich jemanden. Mein Trauzeuge der ersten Ehe. Ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm.«
»Trauzeuge?« Sie trat einen Schritt zur Seite, um den {17}Leuten Platz zu machen, die hinter ihr durch die Eingangstür kamen.
»Genau. Er ist Orthopäde und – jetzt kommt’s: seit neuestem Chef des Klinikzentrums in Novi Sad. Was sagst du nun? Heute Abend rufe ich ihn an. Er soll sich mal hier mit unserem Chefarzt in Verbindung setzen. Damit wir sicherstellen, dass unser Patient eine angemessene Behandlung bekommt und die nicht auf die Idee kommen, bei ihm irgendwelche billigen Ersatzteile zu verbauen.«
»Die Operation war vorgestern.«
»Wie bitte?«
»Aber bis er wieder auf die Beine kommt, wird es noch ein Weilchen dauern. Die Ärzte sagen, er hätte eine gute Konstitution und ausgezeichnete Knochen. Ich glaube, er ist hier in ganz guten Händen. Mehr Sorgen mache ich mir im Moment, ehrlich gesagt, um Vera.«
»Wieso? Geht’s deiner Mutter nicht gut?«
»Du kennst sie ja. Sie kocht, brutzelt und backt wie verrückt, überall stehen Fläschchen mit Tinkturen und liegen Tütchen mit Tee, nur damit ihr Liebling so schnell wie möglich auf die Beine kommt.«
»Immer kampfbereit. Eine echte Partisanin.«
»Aber sie ist nicht mehr die Jüngste! Ich habe Angst, dass sie sich übernimmt.« Milena seufzte. »Ich muss jetzt rein, schauen, wie es ihm geht und ihn ein bisschen päppeln. Ich halte dich auf dem Laufenden.«
»Wenn ich irgendetwas tun kann, lass es mich wissen.«
»Danke, das ist lieb. Mach’s gut.«
Statt den Fahrstuhl zu benutzen, hob sie die Taschen an und machte sich über die Treppe an den Aufstieg.
{18}Die Männerstation lag im zweiten Stock hinter einer breiten Tür aus geriffeltem Glas, das Schwesternzimmer gleich dahinter, rechts. Milena klopfte.
Die Stationsleiterin, Schwester Dunja, hatte den Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt und massierte sich den Fuß. Müde sah sie aus, wie sie hochguckte und sagte: »Ich muss Schluss machen. Sei brav und mach keine Dummheiten, hörst du?«
An der Wand blinkte eines von vielen Lichtern, und synchron war ein unterdrücktes Brummen zu hören. Schwester Dunja achtete nicht darauf. Sie schlüpfte zurück in ihre Sandale und sagte: »Kommen Sie herein, Frau Lukin. Ich muss Sie sowieso sprechen.«
Erschrocken blieb Milena in der Tür stehen. »Ist etwas passiert? Sind Komplikationen aufgetreten?«
»Mit Ihrem Onkel ist alles in Ordnung. Es geht um Ihre Mutter.« Sie rückte ihre Schwesternhaube zurecht und schloss hinter Milena die Tür. »Beziehungsweise um dieses Hausmittel, das sie ihm gestern mitgebracht hat.«
Milena atmete erleichtert auf. »Er hat über Rheuma geklagt. Und meine Mutter schwört bei Knochenschmerzen auf dieses alte Rezept.«
»Pflaumenschnaps, versetzt mit Kampfer, Rosmarin und irgendwelchen Wurzeln, richtig?« Schwester Dunja nickte grimmig. »Hat den Herren hervorragend gemundet.« Sie nahm einen Notizzettel zur Hand. »Laute Gesänge, und Herr Stojadin hat hyperventiliert. Erst als die Nachtschwester ihm eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hat, konnte er wieder normal atmen.« Sie knüllte das Papier zusammen und warf es in den Papierkorb. »Wir wollen aus einer {19}Mücke keinen Elefanten machen. Trotzdem: Wenn das Schule macht, bin ich meine Stelle los. Also bitte: kein Alkohol auf der Station, in keiner Form. Sagen Sie das Ihrer Mutter, und kontrollieren Sie in Zukunft ihre Mitbringsel. Wir sind so dünn besetzt, wir können unsere Augen nicht überall haben.«
»Natürlich.«
»Ich muss mich auf Sie verlassen.«
»Selbstverständlich. Es kommt nicht wieder vor.« Unangenehm war ihr die Standpauke dieser Frau, die sich hier für das Wohl der Patienten und wenig Geld abstrampelte. Ganz schmal war ihr Gesicht, und sie war noch gar nicht alt, höchstens dreißig. Kein Ehering, wahrscheinlich alleinerziehende Mutter. Milena wandte sich beschämt zum Gehen. In der Tür besann sie sich.
»Fast hätte ich es vergessen.« Sie setzte die Taschen wieder ab und suchte nach einem bestimmten Behälter, dem mit dem roten Deckel. »Ich habe Ihnen von unserer Blaubeerpita mitgebracht«, sagte sie. »Selbstgemacht, mit gesundem Honig. Zum Dank für all die Mühe, die Sie mit meinem Onkel haben.«
Schwester Dunja nahm kopfschüttelnd die Plastikdose entgegen, und ein kleines Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Das wäre aber nicht nötig gewesen.« Kurz wog sie den Behälter und stellte ihn dann auf den Tisch zu den zerfledderten Zeitschriften. »Ihr Onkel ist übrigens – das muss man auch mal sagen – ein sehr netter, charmanter und eigentlich auch ganz pflegeleichter Patient.«
Sein Krankenzimmer befand sich am Ende des Flurs, vorletzte Tür links. Der Raum war mit sechs Betten belegt, {20}auf jeder Seite drei. Vera hatte keine Ruhe gegeben, bis ihr Bruder aus Niš hierher verlegt wurde, wo die besten Spezialisten Serbiens sich um seinen Oberschenkelhalsbruch kümmerten. Dass es ein glatter, unkomplizierter Bruch war, den die Ärzte in Niš auch sehr gut hätten behandeln können, interessierte Vera in keiner Minute. Das Nachsehen hatte Tante Isidora. Sie musste jetzt immer die Reise aus Südserbien antreten, um ihren Mann zu sehen.
Onkel Miodrag hatte den Fensterplatz hinten rechts und einen schönen Blick in die alten Bäume. Ein Nachteil war die Zugluft. Vera hatte deshalb den Raum zwischen den Doppelkastenfenstern mit »Kriegswürsten« ausgestopft – alte Bettbezüge, gefüllt mit Lumpen – sehr zum Verdruss der Schwestern, die, immer wenn sie lüften wollten, erst einmal diese Würste herumwuchten mussten.
Dann war da noch der Fußboden, altes Linoleum und an den Rändern rissig, besonders unterhalb der metallenen Fußleisten – Brutstätten für Ungeziefer und Bakterien, die von Vera regelmäßig desinfiziert wurden. Aber noch größer war ihre Angst, dass ihr geliebter Bruder sich wundliegen könnte, so ans Bett gefesselt, ausgerechnet er, der es doch gewohnt war, immer in Bewegung zu sein und zwischen seinen Bienen, Rosen- und Weinstöcken herumzuspringen. Vorbeugend hatte Milena eine genoppte Spezialunterlage besorgen müssen, die sie mit Hilfe der Schwestern zwischen Matratze und Bettlaken gebracht hatte und die nun für eine bessere Durchblutung sorgen sollte. Falls nicht, lagen zu Hause, im Apothekenschränkchen, schon die guten silbernen Wundpflaster aus Deutschland bereit.
»Du bist spät!«, rief Onkel Miodrag.
{21}Sie küsste ihn auf die Wange, und er murrte: »Ich dachte, Adam würde mitkommen. Wo ist er?«
»Beim Nachmittagsunterricht.«
Er hatte sich rasiert und duftete nach gutem Rasierwasser. Sie legte ihm die Tageszeitung auf die Decke und begann auszupacken. »Wie geht’s dir, was hast du gegessen?«
Er zählte an den Fingern ab: »Ein Stück Fleisch, klein wie ein Plätzchen und hart wie Schuhsohle. Dazu irgendeinen Brei, ich glaube, es war Gemüse. Vorweg die übliche Suppe, Boško ist überzeugt, es ist aufgewärmtes Spülwasser. Aber der Pudding war anständig.«
Milena wickelte Teller, Glas und Besteck aus dem karierten Geschirrtuch, zog das Nachttischchen heran und deckte. Onkel Miodrag nahm sich ein Stück vom Käse und sagte leise: »Dimitrije da hinten redet den ganzen Tag nur von Raps. Er will auf Raps umstellen, weil er glaubt, wenn die EU kommt, wird er mit Rapsöl reich. Aber da kann er lange warten.«
»Iss die Petersilie, die ist gut für deinen Blutdruck.« Milena goss von der Zimtmilch ein. »Ich meine es ernst. Nicht dass sie dir am Ende doch die Betablocker geben. Vera würde einen Anfall kriegen.« Sie begann, Käsebrote zu schmieren.
»Heute gar nichts Süßes?« Onkel Miodrag griff zur Zeitung.
»Mit der Blaubeerpita musste ich Schwester Dunja beruhigen. Weil ihr hier gestern so herumkrakeelt habt! Kompressen gibt’s in Zukunft keine mehr, und wenn dir die Knochen noch so schmerzen. Wie ist es? Hast du Schmerzen?«
{22}Die Besucher, die mit Blumen und Bonbonnieren ins Zimmer traten und höflich grüßten, wollten, wie immer, alle zu Kosta Popović, ein kleiner, gepflegter Mann mit gebräunter Stirn und meliertem Haarkranz, der eine neue Hüfte bekommen hatte. Vielleicht war dieser Trubel der Grund, warum Boško, der Fabrikarbeiter aus Kragujevac, so schnell geflüchtet war, wie ihn seine Krücken tragen konnten. Irgendwie waren ihr all diese Männer ans Herz gewachsen: Herr Stojadin, durchsichtig wie Papier, wie immer zur Besuchszeit mit Ohrenstöpseln in die europäische Sozialgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts vertieft. Der Mann mit dem gestutzten Oberlippenbart in der Reihe ganz am Ende bekam nie Besuch und redete kein Wort. Onkel Miodrag behauptete, er sei Araber und seine Sippe weit weg. Milena hatte das Gefühl, dass sie ihn irgendwo schon einmal gesehen hatte.
Sie fegte die Brotkrümel zusammen und packte das benutzte Besteck in ein Stück Küchenpapier. Unausgesprochen war klar, dass bis zur nächsten Besuchszeit alles aufgegessen sein musste und dass Onkel Miodrag, der diese Mengen unmöglich allein bewältigen konnte, mit seinen Zimmergenossen teilte. Morgen kam ja schon wieder Nachschub.
»Wie gesagt.« Milena goss noch einmal Milch nach. »Am Sonntag kommt Tante Isidora. Wir holen sie vom Bahnhof ab und kommen dann direkt hierher.«
Onkel Miodrag war hinter der Zeitung wie hinter einer Wand verschwunden, die rechts und links fest an den Händen seiner ausgestreckten Arme verankert war.
»Onkel Miodrag?« Milena beugte sich vor. »Ist alles in {23}Ordnung?« Vorsichtig legte sie ihm eine Hand auf den Arm und wiederholte: »Onkel Miodrag?«
Wie aus weiter Ferne schaute er sie ausdruckslos an und öffnete den Mund. Aber kein Laut kam heraus. Er reichte ihr die Zeitung. In großen Lettern sprang ihr die Überschrift entgegen: Mord an serbischen Landsleuten im Kosovo. Darunter, etwas kleiner: Polizei tappt im Dunkeln. Ethnisches Motiv nicht ausgeschlossen.
Milena setzte stirnrunzelnd ihre Brille auf und las: Ein serbisches Ehepaar ist in der ehemals serbischen Teilrepublik Kosovo Opfer eines tödlichen Überfalls geworden. Nach Angaben der örtlichen Polizei soll sich der Vorfall bereits am Freitag vergangener Woche ereignet haben. Beide Personen starben in ihrem Haus im Dorf Talinovac bei Ferizaj (serbisch Uroševac) durch einen Genickschuss. Ein Sprecher teilte mit, dass Patronenhülsen des Kalibers 7,62 Millimeter gefunden wurden. Der kosovo-albanische Regionalstaatsanwalt übernahm unter Aufsicht der multinationalen Schutztruppe KFOR (Kosovo Force) die Ermittlungen. Mehr auf Seite 4, Zeitgeschehen; Kommentar auf Seite 7.
Auf einem Farbbild war eine grüne, hügelige Landschaft zu sehen, in der malerisch, wie hingestreut, ein paar Häuser lagen. Daneben, in Schwarzweiß, zwei Fotos, klein wie Passbilder, auf denen, etwas unscharf, zwei ältere Leute abgebildet waren. Bildunterschrift: Miloš und Ljubinka Valetić gingen zurück in ihre Heimat und direkt in den Tod.
»Sag mir bitte«, stieß Onkel Miodrag heiser hervor, »steht da wirklich Ljubinka Valetić?«
Milena ließ die Zeitung sinken und schaute ihn überrascht an. »Du kennst die Frau?«
{24}»Sie hatte die schönsten Augen der Welt. Ich wollte sie heiraten.«
»Wie bitte?«
»Das war lange vor deiner Tante Isidora.« Onkel Miodrag sprach ganz leise. »Ljubinka Višekruna. Leider war ich ihr nicht gut genug. Sie hat den Valetić genommen.« Ächzend setzte er sich auf. »Und jetzt soll sie tot sein? Ermordet?«
Milena schaute auf das Foto. Eine alte Frau mit locker nach hinten frisierten Haaren, der Mund etwas schief, als würde sie ein Lächeln andeuten, was ihr etwas Schüchternes, Mädchenhaftes verlieh – soweit man das auf der grobkörnigen Abbildung erkennen konnte. Der Mann auf dem Foto daneben wirkte strenger, entschlossener, aber nicht unfreundlich. Er hatte etwas Edles, Aristokratisches. Vielleicht war es seine Haltung oder die schmale Nase, die ein wenig zu lang geraten war.
»Miloš und Ljubinka Valetić«, murmelte Milena und blätterte zur Seite vier. »Bist du sicher, dass du sie nicht verwechselst?«
»Ich weiß, dass sie damals mit ihm nach Priština gegangen ist«, sagte Onkel Miodrag. »Ich glaube, er hatte dort eine Stelle. Ganz unscheinbarer Typ, dieser Valetić, an ihn habe ich überhaupt keine Erinnerung.«
Milena strich die Seite glatt. »Miloš und Ljubinka Valetić gehörten zu den Rückkehrern, steht hier. Sie waren Teilnehmer an diesem EU-Programm. Erst 2000 sind sie aus dem Kosovo raus und nach Belgrad gekommen. Sie sind damals geflohen.«
»Sie waren als Flüchtlinge hier in Belgrad, der schönsten {25}Stadt der Welt, und sind freiwillig wieder in diesen Hexenkessel zurückgegangen?« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Warum? Wegen eines ›EU-Programms‹? Hatten sie denn hier kein Leben?« Er streckte die Hand nach der Zeitung aus. »Steht da nicht noch irgendetwas? Über die Täter, oder was genau da vorgefallen ist?«
Milena fuhr mit dem Finger über die Zeilen: »Die kosovo-albanische Regierungssprecherin verurteilt den Mord und fordert eine rückhaltlose Aufklärung der Straftat, die im Widerspruch zu den Werten der Gesellschaft des jungen Staates Kosovo steht.«
»Hört, hört.«
»Die Rechte und Freiheiten jedes Individuums und jeder Ethnie müssen respektiert und geschützt werden. Auch der kosovo-albanische Premierminister und der Parlamentspräsident verurteilen diesen Akt der Gewalt. Es wurde eine Durchsuchung der benachbarten Häuser von serbischen und albanischen Familien angeordnet und durchgeführt, relevante Spuren wurden nicht gefunden. Von Konflikten zwischen dem getöteten Rentnerpaar und den dort ansässigen Kosovo-Albanern ist nichts bekannt.«
Onkel Miodrag presste Daumen und Zeigefinger gegen seine Nasenwurzel und sagte, als würde er zu sich selbst sprechen: »Warum hat sie sich nicht bei mir gemeldet, als sie in Not geraten war? Die ganze Zeit war ich in Südserbien, ganz in ihrer Nähe, immer in Prokuplje, nie woanders. Isidora und ich – wir hätten ihnen doch geholfen.«
Milena betrachtete noch einmal die Fotos. Idyllisch war die Landschaft, und so viel Platz. Wie groß musste der Hass der Leute dort sein, um zwei alte Menschen, die das Leben {26}hinter sich hatten und ganz sicher niemandem etwas zuleide taten, auf so brutale Weise umzubringen? Sie schaute zum Fenster, zu den Ästen und den ersten grünen Blättern.
»Weißt du eigentlich, ob die beiden Kinder hatten?«, fragte Milena.
Onkel Miodrag antwortete nicht. Er war ganz bleich und starrte an die Decke, wo die große, runde Lampe hing.
Sanft drückte sie seinen Arm. »Ruh dich aus.« Sie faltete das Geschirrhandtuch und verstaute es mit dem Besteck in ihrer Tasche.
»Sie war so …« Er suchte nach Worten, drehte den Kopf und schaute Milena an. »Sie war ganz anders als deine Tante Isidora.«
Zärtlich betrachtete sie ihren Onkel, seine Falten, diese feingezeichnete Landkarte um seinen Mund, die Nase und Augen herum. Seine Lippen waren trocken, die Wangen eingefallen, und eine Fülle von Altersflecken kam hier mit der Krankenhausblässe zum Vorschein, die ihr vorher noch nie aufgefallen waren. Vorsichtig strich sie ihm das dünne Haar aus der Stirn. Alles würde sie für ihren Onkel tun, um ihm den Kummer zu nehmen.
»Jetzt geh, mein Kind. Es ist Zeit. Adam wartet auf dich.«
Sie nickte und faltete die Zeitung zusammen.
Onkel Miodrag hob die Hand. »Die lass bitte hier.«
Widerstrebend legte sie die Blätter zurück auf seinen Nachttisch, beugte sich zu ihm und küsste ihn auf die Stirn. »Morgen bekommst du Blaubeerpita.«
Sie war bereits auf dem Flur, hatte die Tür fast schon hinter sich zugezogen, da schaute sie noch einmal zurück.
Onkel Miodrag hatte den Blick in die Bäume gerichtet, {27}die rechte Hand zur Faust geballt und vor den Mund gepresst. Noch nie hatte sie ihren Onkel weinen sehen.
Leise zog Milena die Tür ins Schloss und ging den Flur hinunter. Sie lief schnell, fast rannte sie.
Von Westen her schien die Sonne in die Fürst-Michael-Straße und brachte die bunten Fassaden zum Leuchten, den Stuck, die Ornamente und Pilaster – die ganze Pracht des neunzehnten Jahrhunderts, als man die Habsburger schon lange zum Teufel wünschte, aber in der Architektur immer noch ihren Stil pflegte.
Milena ging im Zickzackkurs um die Leute herum, die in den Feierabend bummelten und sich die Nasen an den großen Schaufensterscheiben platt drückten. Touristen wippten im Takt mit der Musik, den Ohrwürmern der englischen Pop- und russischen Volksmusik, die der Straßenmusikant mit rauher Stimme, Gitarre und Verstärker zum Besten gab und dabei nicht schlecht von dem Wechselgeld profitierte, das die Leute an der Popcornbude herausbekamen und ihm in den verbeulten Hut warfen. Milena bog in die Seitenstraße, die stillere Vuk-Karadžić-Straße.
Am Ende der Straße befand sich rechts der ›Rote Hahn‹. Lange würde es nicht mehr dauern, bis die jungen Leute dort alle wieder unter freiem Himmel an der Bar saßen, Espresso Macchiato und Aperol-Sprizz tranken und eine Atmosphäre von Coolness, Erfolg und Wohlstand verströmten. Nur das Gebäude im Hintergrund wollte nicht so recht dazu passen.
{28}Wenn die Sonne so niedrig stand, nahm der Kasten dem Platz das Licht, und das triste Braungrau schlug aufs Gemüt. Die Löcher im Putz – teilweise quadratmetergroß – entstellten die Fassade, die früher einmal sehr schön gewesen sein musste. Große Spanplatten ersetzten im Erdgeschoss manche der morschen Fenster und waren die einzige Maßnahme, die darauf hinwies, dass es überhaupt jemanden gab, der von dem Verfall Notiz nahm – ausgenommen natürlich die bedauernswerten Menschen, die dort arbeiteten, wie Milena und all die anderen Leute vom Institut für Kriminalistik und Kriminologie.
Dafür wusste Milena, was andere nicht mal ahnten: dass sich über der Eingangshalle ein wunderschönes Glasdach wölbte und die Wände im Treppenhaus und in den Fluren in einem zarten Hellgelb gestrichen waren. Wenn man die stuckverzierten Decken betrachtete und über das knarrende Parkett ging, gab es Momente, da konnte man denken, man wäre in einem Schloss. Milena fühlte sich in diesem Institut zu Hause. Und sie würde sich hier noch wohler fühlen, wenn es in ihrem Büro im ersten Stock, dem vorletzten Zimmer am langen Gang, dem ehemaligen Abstellraum, eine Heizung gäbe.
Sie machte die Tür hinter sich zu, hängte ihre Tasche an den Stuhl und ihren Mantel an den Haken. Während der Computer hochfuhr und die Programme lud, kroch sie unter den Schreibtisch und knipste den Heizstrahler an. Dann startete sie das Internet, setzte ihre Brille auf und öffnete die Seite vom Kurier.
Tod im Kosovo, titelte das Boulevardblatt. Rentnerpaar brutal ermordet. Die Fotos von Miloš und Ljubinka Valetić {29}waren dieselben, die sie auch in der Tageszeitung Politika gesehen hatte, nur waren sie hier noch größer und grobkörniger. Milena scrollte durch den Text. Bei den Repressionen gegen die serbischen Mitbürger im Kosovo sei ein neuer Höhepunkt erreicht, die Sicherheit der serbischen Bürger im Kosovo nicht gewährleistet. Der Kommentar in Vreme fiel staatstragend aus: Man appellierte an die internationalen Vertreter und lokalen Institutionen, dieses Verbrechen schnellstmöglich aufzuklären und den serbischen Bewohnern in Talinovac und an allen anderen Orten im Kosovo ein ruhiges, sicheres und menschenwürdiges Leben zu gewährleisten. Milena klickte weiter zu Blitz, auch so ein Revolverblatt. Wieder sprangen ihr die Gesichter von Miloš und Ljubinka Valetić entgegen. Serbisches Ehepaar hingerichtet – Warum? Es klopfte.
Boris Grubač war kein Chef, der auf ein »Herein« wartete, und Milena hatte längst den Versuch aufgegeben, einem Mann von fast sechzig Jahren noch Benimmregeln beizubringen. Lieber starrte sie auf den Bildschirm, zählte bis fünf und drehte sich mit einer Miene zu ihm herum, die ihm hoffentlich deutlich sagte, dass sie sehr beschäftigt war und er sich besser kurzfasste.
Sein Hemd saß im Bund so stramm, als hätte er gerade noch eine riesige Portion von dem bosnischen Eintopf verdrückt, den seine Frau Itana so hervorragend zubereitete. Sein Gesicht war ungewöhnlich rot, und das Haar, das bei ihm wohl nirgends so üppig sprießte wie in den Ohren und Nasenlöchern, klebte verschwitzt, in dünnen Lagen, an Schädel und Schläfen. »Liebe Frau Lukin!«, trompetete er, und ein feiner Sprühregen ging auf Schreibtisch und {30}Tastatur nieder. »Es freut mich außerordentlich, dass Sie sich entschlossen haben, heute doch noch vorbeizuschauen.«
Es war sinnlos, Grubač daran zu erinnern, dass sie sich heute schon an der juristischen Fakultät mit Studenten und Professoren herumgeschlagen hatte, von denen die einen chronisch faul waren, die anderen wahnsinnig wichtig. Grubač war das beste Beispiel dafür, dass der Faulpelz und der Wichtigtuer sich zu einer Person vereinigen konnten. Aber heute war irgendetwas passiert, was das Gleichgewicht störte. Grubač war wie ein Dampfkessel, aus dem erst einmal die heiße Luft herausmusste, je schneller, desto besser.
»Was ist denn los?«, fragte Milena in einem Ton, als würde sie sagen: Jetzt beruhigen Sie sich doch erst einmal!
»Der Minister hat angerufen!« Seine Hände kneteten die Luft, und Milena angelte vorausschauend nach dem Schnellhefter. Ein Anruf von so weit oben war, ohne Frage, etwas Besonderes, aber für Boris Grubač war es ein Ereignis, das ihn offensichtlich aus der Fassung brachte. »Der Minister ist sehr ungehalten«, schrie er, »weil wir nicht im Zeitplan sind. Und warum sind wir nicht im Zeitplan? Weil Sie nicht aus dem Quark kommen!«
»Wir hatten doch ausführlich darüber gesprochen.« Milena blätterte. »Hier. Paragraph sieben.«
Grubač presste die Lippen zusammen.
»Wir müssen nach Bologna drei Bereiche definieren: Humanitäres Völkerrecht, Internationale Gerichtsbarkeit …«
»Hören Sie auf. Ich kenne das Papier in- und auswendig.«
»Dann wissen Sie auch, dass wir die Kriterien Punkt für {31}Punkt erfüllen müssen, wenn wir in der EU den Status einer gleichberechtigten wissenschaftlichen Einrichtung erlangen wollen.« Milena klappte den Hefter wieder zu.
»Drei promovierte Dozenten in Vollzeit – Frau Lukin, ich bitte Sie! Haben Sie sonst noch irgendwelche frommen Wünsche?«
»Ich habe die Regeln nicht gemacht. Aber wenn Sie sich erinnern: Ich habe eine Ausschreibung vorbereitet, die seit vergangener Woche auf Ihrem Tisch liegt und so schnell wie möglich raus sollte.«
»Machen wir uns doch nichts vor: Ihre werten Kollegen in Kopenhagen, Den Haag, Brügge und wo auch immer sie alle sitzen, werden nicht gerade Schlange stehen, um sich für eine Dozentur bei uns in Belgrad zu bewerben.«
»Warum eigentlich nicht? Ich würde hinter den Kulissen versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten.«
»So kommen wir nicht weiter.« Grubač schob erschöpft eine Strähne zurück an ihren Platz, die sich durch eine hektische Bewegung vom Schädel gelöst hatte. »Wir vertun unsere Zeit. In Ihrem eigenen Interesse: Wir müssen das jetzt hinkriegen. Wir müssen die Fristen einhalten und ran an die Fördertöpfe.«
»Was schlagen Sie vor?«
»Haben Sie schon einmal an das Naheliegende gedacht, an unsere eigenen Leute, an Ihre Studenten? Dieser eine, zum Beispiel, der bei Ihnen schon so lange promoviert, dieser Langhaardackel.«
»Milan Miljković?« Milena schüttelte den Kopf. »Der ist noch nicht so weit.«
»Frau Lukin, Sie mauern. Was ist mit Ihnen los? Sie {32}wissen: Ich bin auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Jetzt lassen Sie mich nicht hängen. Seien Sie zur Abwechslung mal ein bisschen kreativ!«
»Ich überleg mir etwas.«
»Bevor Sie zu lange überlegen – kleiner Tipp: Biegen Sie die Dinge einfach mal ein bisschen zurecht. Sie wissen ja: Papier ist geduldig.« Er legte eine Hand auf ihre Rückenlehne, beugte sich zu ihr herunter und starrte auf den Bildschirm. Sein Atem roch nach Pfefferminz.
»Einverstanden«, sagte Milena. »Ich biege etwas zurecht. Sonst noch etwas?«
»Jetzt verstehe ich«, murmelte er. »Da sind Sie also mit Ihren Gedanken. Die beiden alten Leutchen.« Er streichelte betroffen seine Krawatte. »Schlimme Geschichte. Hat der Bildungsminister übrigens auch gesagt.«
»Tatsächlich?« Milena schaute überrascht zu ihm hoch. »Wissen Sie denn etwas Genaueres?«
»Zwei Genickschüsse aus den Pistolen albanischer Nationalisten – wie genau wollen Sie es denn noch wissen?«
»Die Hintergründe«, sagte Milena, »wie es dazu kommen konnte. Alle sind empört, aber es gibt überhaupt keine Fakten.«
»Frau Lukin, wir reden hier vom Kosovo. Was für Fakten brauchen Sie? Das Kosovo ist ein von Verbrechern gegründeter Staat, ein Verbrecherstaat. Wir Serben sind da unten Freiwild. Die Rentner hätten nie einen Fuß ins Kosovo setzen dürfen.«
Milena schob den Schnellhefter zurück in die Ablage. »Darf ich Sie erinnern: Die serbische Regierung und die EU unterstützen, dass die Kosovo-Serben zurückgehen.«
{33}»Was nützt das schönste Recht auf Rückkehr, wenn es von niemandem geschützt wird? Unsere Polizei darf im Kosovo ja nicht mal ermitteln!«
»Darum werden unsere Verbündeten sich dafür einsetzen, dass dieser Mord so schnell wie möglich aufgeklärt wird.«
»Welche Verbündeten?«
»Die EU.«
»Ihre Verbündeten interessieren sich – mit Verlaub – einen Scheißdreck für zwei tote Serben im Kosovo.«
Milena schob ihren Stuhl zurück. Natürlich hatte Grubač recht. Kosovo-Serben hatten keine Lobby und waren überall ein Ärgernis: in Serbien unerwünscht, bei den Albanern verhasst und in Europa ein Problem, das sich auf keiner Konferenz wegdiskutieren ließ. Darum war man auch dazu übergegangen, das Thema besser von der Tagesordnung zu streichen.
»Was ist, Frau Lukin? Habe ich recht, oder habe ich recht?« Er sah zu, wie sie auf dem Bildschirm die Seiten schloss, mit dem Cursor zum Bildschirmrand fuhr und auf den Ausschalt-Button klickte.
»Wo wollen Sie denn hin?«, fragte er.
»Nach Hause.«
»Und Bologna? Was sage ich dem Minister?«
Sie setzte ihre Brille ab. »Ich lasse mir etwas einfallen.«
»Ich fürchte, das ist dem Minister zu vage.«
Sie klappte ihr Brillenetui zu. »Die Staatskanzlei für die Angelegenheiten des Kosovo und das Ministerium für Bildung – die sitzen doch in einem Gebäude, oder?«
»Warum? Wollen Sie da jetzt persönlich vorsprechen?«
{34}Milena hängte sich die Tasche um und nahm ihre Schlüssel vom Tisch. »Gar keine schlechte Idee, Herr Grubač.«
Es war so seltsam still, als sie nach Hause kam. Der Fernseher war aus, und statt Adam lümmelte bloß die Katze im Sessel. Verwundert hängte Milena ihren Mantel auf. »Ich bin’s!«
Sie schlüpfte in ihre Pantoffeln. Es duftete nach geschmorten Zwiebeln, nach Gebratenem und nach etwas, das sie nicht genauer identifizieren konnte. Die Tür zu Adams Zimmer war geschlossen.
»Habt ihr schon gegessen?« Milena ging ins Bad. Beim Händewaschen schaute sie in den Spiegel, in zwei rote Kaninchenaugen. Nun gut, irgendwann würden die sich auch wieder zurückverwandeln. Echte Sorgen machten ihr die steilen Falten zwischen den Wangen und der Mundpartie. Sie öffnete das Badezimmerschränkchen und holte den kleinen Topf mit der Gesichtscreme hervor. Das Produkt hatte sie sich am vergangenen Wochenende geleistet, und es hatte ein Vermögen gekostet. Der schwere Deckel war aus schwarzem Glas und wunderschön, die Creme selbst noch unangetastet und vom silbernen Papier geschützt.
Sie schraubte den Deckel wieder drauf und stellte den kostbaren Topf vorsichtig zurück ins Schränkchen, nach ganz oben, hinten.
Auf dem Küchentisch standen ein Teller und ein Weinglas, daneben lagen Besteck und Serviette. Vera hatte die Brille auf der Nase und löste Kreuzworträtsel.
{35}»Wo ist Adam?« Milena hob einen Deckel von der Schüssel. Im Ofen brannte Licht. »Schläft er schon?«
»Du hättest zwischendurch mal anrufen können.« Vera schaute mit hochgezogenen Brauen auf die kleinen Kästchen und schrieb Buchstaben. »Oder warst du gar nicht bei Onkel Miodrag? Wir haben uns Sorgen gemacht.«
»Mit Onkel Miodrag ist alles in Ordnung.«
»Und sein Rheuma?«
»Besser.« Milena nahm die Topflappen, öffnete die Ofenklappe und hob den Deckel von der feuerfesten Form. In einem Sud aus Olivenöl, Petersilie und feingehackten Schalotten lagen kleine, in Mangold gewickelte Pakete. Milena bemerkte, wie hungrig sie war. Sie bugsierte drei Röllchen auf den Teller und nahm aus der Schüssel einen Löffel Sauerrahm.
»Im Kühlschrank ist Weißwein. Bedien dich, bitte.«
Milena gehorchte, zwängte den Korken zurück in den Flaschenhals und setzte sich. Behutsam stach sie mit der Gabel in das Mangoldblatt und teilte das Röllchen in zwei Hälften. Die dampfende Füllung aus Reis und gehacktem Rindfleisch war mit Rosinen und Mandelsplittern angereichert, der kühle Sauerrahm aus kräftiger Schafsmilch dazu genau die richtige Ergänzung. »Mama«, sagte Milena und tupfte sich mit der Serviette den Mund, »diese Röllchen sind ein Gedicht.«
»Nicht zu viel Muskat?«
»Köstlich.«
»Es ist genug da.«
Entweder hatte der kleine Zettel oberhalb ihres Tellers eben noch nicht dort gelegen, oder Milena hatte ihn einfach {36}nicht bemerkt. Sie trank einen Schluck Weißwein. Die Zahlenfolge auf dem abgerissenen Stück Papier kam ihr bekannt vor.
»Zorans Mama«, sagte Vera, ohne aufzuschauen. »Sie bittet um Rückruf.«
Zoran war Adams Kumpel aus dem Basketballverein und einer seiner besten Freunde. »Haben die beiden etwas ausgefressen?«
Vera bewegte lautlos die Lippen, buchstabierte und zählte Kästchen. Endlich sagte sie: »Irgendein Streit. Aber lass den Jungen. Er ist müde. Er hatte einen anstrengenden Tag.«
Er lag im Bett und blätterte in seiner Kinderzeitschrift. Den linken Arm hatte er trotzig unter den Kopf gelegt.
Milena setzte sich auf die Bettkante und reichte ihm das Glas Kräutertee, in das Vera noch einen großen Löffel Honig gerührt hatte. »Hier, trink ein bisschen.«
Er gehorchte.
Sie nahm ihm das Glas ab. »Und jetzt erzähl. Was ist das für ein Streit mit Zoran?«
Es ging um Adams Fahrrad, ein Geschenk seines Vaters aus Deutschland. Milena hatte von Anfang an gewusst, dass es damit Ärger geben würde. Feinste deutsche Mechanik, sieben Gänge, federleicht, mit dicken Reifen, hervorragend geeignet, um im Tašmajdan-Park in einem Affenzahn zwischen alten Leuten, Hunden und Kinderwagen herumzukurven. Zoran, erfuhr Milena, hatte dieses Fahrrad, das beste Fahrrad aller Zeiten, genommen und Adam, seinem Freund, vor die Füße geschmissen.
»Warum?«, fragte Milena verblüfft.
{37}Adam fuhr mit dem Zeigefinger über die schmalen Streifen auf dem Bettbezug. »Ich habe ihm gesagt, er soll aufpassen, vor allem mit der Schaltung, und das Fahrrad gut behandeln. Aber er hat das Gegenteil getan. Da habe ich ihm gesagt, er soll absteigen.«
»Und weiter?«
Wieder reichte sie ihm das Glas.
Adam trank und lehnte sich zurück: »Und außerdem habe ich ihm gesagt, dass er ein serbischer Bauer ist, und serbische Bauern können eben nur Esel reiten.«
Milena seufzte. »Warum sagst du so etwas?«
»Zoran hätte mein Fahrrad nicht so auf die Erde schmeißen dürfen. Und dann heulen und wegrennen. Das ist typisch. Typisch serbisch.«
»Zoran war gekränkt. Weil er nicht so ein schönes Fahrrad hat, und weil du die Serben schlechtgemacht hast. Dabei bist du selbst ein halber.«
»Habe ich geheult, als er mein Fahrrad hingeschmissen hat?«
»Du weißt ja auch, dass Papa dir, wenn alle Stricke reißen, ein neues kaufen würde, und wenn nicht er, dann wahrscheinlich Oma Bückeburg.« Sie strich ihm das weiche Haar aus der Stirn. »Vergiss nicht, dein Großonkel ist auch ein serbischer Bauer. Er hat nach dir gefragt.«
»Ich weiß.«
»Du kannst ihn morgen mit Oma besuchen gehen.« Sie gab ihm einen Kuss. »Entschuldigst du dich bei Zoran?«
»Ich überleg’s mir. Ja, vielleicht.«
»Schlaf jetzt. Und träum etwas Schönes.«
In der Küche saß Vera, den graumelierten Krauskopf {38}über das kleine Oktavheft gebeugt und murmelte: »Karotten, Rote Beete …«
Milena spülte das Geschirr und stellte die Gläser und Teller zum Abtropfen in das Drahtgestell.
»Soll ich Onkel Miodrag morgen Pfannkuchen mit Käse machen?«, fragte Vera. »Oder lieber Käsekipfel mit Joghurt?«
Milena trocknete das Besteck ab. »Wie wäre es mit Arme Ritter und Kajmak?«
»Kajmak?« Überrascht schaute Vera hoch. »Dann hättest du welchen vom Markt mitbringen müssen. Hast du?«
Milena schob im Kühlschrank Behälter und Packungen zusammen und stellte die Schüssel mit dem Sauerrahm hinein. »Mach ihm Pfannkuchen mit Käse.« Sie hängte die Topflappen an den Haken. Gerne hätte sie noch kalten Kaffee getrunken, aber es war keiner mehr da.
»Was ist los?« Vera legte den Kugelschreiber zwischen die Seiten. »Du verschweigst doch etwas. Sind bei Miodrag Komplikationen aufgetreten? Braucht er die Wundpflaster?«
Milena setzte sich. »Erinnerst du dich an Ljubinka Valetić?«
»Ljubinka Valetić?« Vera schaute Milena fragend an. Der Name sagte ihr nichts.
»Damals hieß sie anders …«
»Du meinst die Višekruna? Ja, die kenne ich. Ich meine, damals kannte ich sie, aber das ist eine Ewigkeit her. Warum, was ist mit ihr?«
»Sie ist tot.«
Vera klappte das Heft zu.
»Wir haben es heute aus der Zeitung erfahren.«
{39}»Das tut mir leid«, Vera nahm ihre Brille ab. »Wirklich, aber auch Ljubinka war wohl nicht mehr die Allerjüngste.«
»Sie wurde erschossen.«
»Wie bitte?«
Milena erzählte, was sie aus der Zeitung und dem Internet erfahren hatte. Dass Ljubinka und ihr Mann nach Jahren, die sie in Priština gelebt hatten, nach Belgrad geflohen und jetzt, im Rahmen eines EU-finanzierten Programms, ins Kosovo zurückgekehrt und dort mit einem Genickschuss getötet worden waren.
Vera hörte mit unbewegter Miene zu. Dann stand sie auf und ging aus dem Raum. Milena hörte, wie nebenan im Wohnzimmer die Schranktür ging.
Kurz darauf stellte Vera eine Flasche und zwei kleine Gläser auf den Küchentisch. Wortlos schenkte sie ein. Der klare Schnaps duftete nach den Pflaumen aus Onkel Miodrags Garten. Sie tranken, starrten auf das Tischtuch und spürten, wie sich im Körper mit dem Alkohol die Wärme ausbreitete. Dann fragte Milena: »Was war zwischen Onkel Miodrag und Ljubinka?«
Vera lehnte sich zurück. Fiona sprang ihr auf den Schoß. »Sie war eine schöne Frau. Sie hat ihm den Kopf verdreht.« Sie strich der Katze über das dicke Fell. »Ich unterstelle mal, dass es nicht nur ihre schönen Augen waren, die es deinem Onkel angetan hatten. Miodrag hätte alles für sie getan. Von München war damals die Rede, und dass sie dort ein neues Leben anfangen wollten. Aber stell dir nur mal vor, wie es damals bei uns war: Der Papa – lange tot. Srećko in Osnabrück im KZ umgekommen. Radoslav zum Studieren in Belgrad, und Miodrag, der letzte Mann bei uns {40}daheim, will mit dieser Frau nach München. Nein, das wäre nicht gegangen. Du kannst mir glauben, deine Großmutter war gottfroh, als dieser andere kam, dieser …«
»Miloš Valetić.«