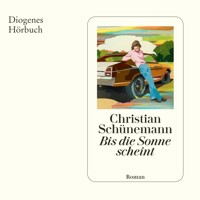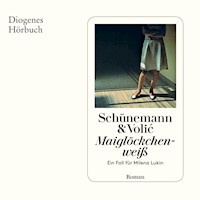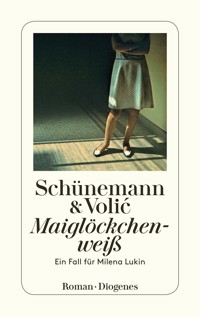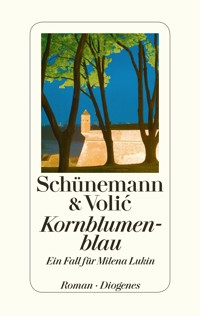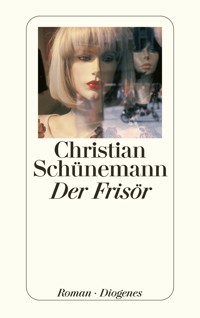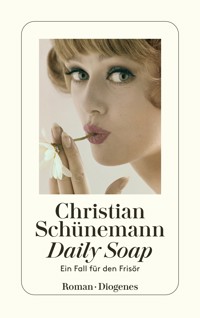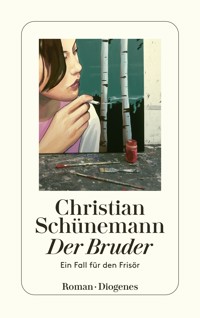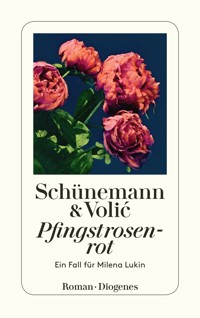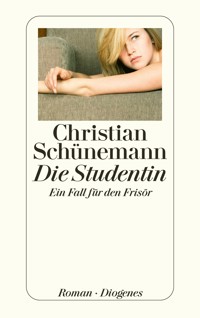21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist das Jahr 1983. Daniel steht kurz vor seiner Konfirmation und träumt von blauem Samtsakko und grauer Flanellhose. Doch seit er die Eltern belauscht hat, schwant ihm, dass daraus nichts wird. Hormanns sind pleite und wissen nicht mehr, wie sie die sechsköpfige Familie über die Runden bringen sollen. So erfinderisch die Eltern auch sind, eines können sie nicht: mit Geld umgehen. Was sie dagegen beherrschen: den Schein wahren, selbst als der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christian Schünemann
Bis die Sonne scheint
roman
Diogenes
Ihre Absätze hallten auf den Kunststeinfliesen, als würde sie einen Saal betreten und nicht die Poststelle von Frau Pieper am Amselweg.
Sie habe es schrecklich eilig, sagte die Frau und wedelte mit einem schmalen Umschlag. Sie wolle nur schnell diesen Brief aufgeben.
Ich stand vor ihr mit der Geschäftspost meiner Eltern, wie immer einem ganzen Stapel, und rührte mich nicht von der Stelle, während Frau Pieper vorschlug, die Frau mit dem einzelnen Brief vorzulassen.
»Klar«, sagte ich und trat zur Seite.
Frau Pieper rückte erst mal ihre Brille auf der Nase zurecht, klappte in aller Ruhe das große Album auf und ließ ihren Blick gemächlich über den Bogen mit den Standardmarken schweifen, als könne sie sich nicht entscheiden, welchen von den dunkelgrünen Gustav Heinemanns sie nehmen sollte.
Ich tat, als würde ich mir die Gesichter derRAF-Terroristen auf dem Plakat an der Wand einprägen, und schielte verstohlen auf die dunkelblaue Jacke dieser Frau neben mir, auf den feinen Stoff, die weiße Umrandung und den blonden Haarschopf, der im künstlichen Licht der Neonröhre schimmerte. Ihre Haarspitzen drehten sich auf Kinnhöhe ein und wippten ungeduldig, während Frau Pieper hinter dem Tresen beim Aufkleben und Abstempeln der Briefmarke bummelte und bis zur Herausgabe des Wechselgelds hartnäckig versuchte, ein Gespräch anzuknüpfen.
Die Fremde ließ sich auf nichts ein, sagte nicht viel mehr als »danke«, »gut« und »schön« und verließ den Postraum.
Frau Pieper und ich blieben in einer zarten Parfümwolke zurück, schauten ihr hinterher und beobachteten, wie sie draußen über Steine und Schlaglöcher zu ihrem Auto stöckelte.
Der silberne Chevrolet war mir schon ein paarmal aufgefallen, wie er durch unsere Siedlung glitt. Anders als die anderen amerikanischen Autos im Landkreis hatte er kein US-Kennzeichen, sondern eines wie wir mit OHZ. Das breite Rücklicht blinkte rot und träge, als er in den Sandbergweg einbog und Richtung B6 aus unserem Blickfeld entschwand.
Frau Pieper donnerte Stempel für Stempel auf unsere Drucksachen und sagte, das sei Frau Schlüter gewesen. Sie wohne auf der anderen Seite, arbeite als Avon-Beraterin und käme aus derDDRwie auch ihr Mann, der irgendetwas bei Radio Bremen sei.
»Und bei euch zu Hause?« Frau Pieper kritzelte ihre Unterschrift auf den Beleg. »Deine Mutter lässt sich ja gar nicht mehr blicken.« Ihre grauen Augen verschwammen hinter den dicken Brillengläsern zu Pfützen. »Ist alles in Ordnung?«
»Bei uns?«, stotterte ich und nahm den Zettel. »Bei uns ist alles okay.«
»Und dein Vater?« Frau Pieper beugte sich vor und stützte sich auf dem Tresen ab. »Hat er gut zu tun?«
»Und wie«, antwortete ich, steckte den Beleg ein und verabschiedete mich.
Ich war schon in der Tür, als ich mich noch einmal umdrehte: »Wirklich! Alles bestens.«
1
Je länger der Regen anhielt, desto tiefer suchten wir in den Schränken nach geeigneten Behältern für das Wasser, das sich auf dem Flachdach zu einem großen See staute, aufs Gebälk drückte und durch die Nähte der Dachpappe sickerte. Es durchnässte im Dachzwischenraum die Isolierwolle und die Nester der Mäuse und fand im Flur, im Bereich der Oberlichter zwischen Stromleitungen und Sechzigwattglühbirnen, seinen Weg durch die Deckenverkleidung, marmorierte an den Styroporplatten in Gold- und Bronzetönen und fiel in Tropfen herunter.
Auf dem Teppichboden entstand ein Landkartenmuster aus kleinen und großen Inseln, die anwuchsen und sich über die gesamte Länge des Flurs zu riesigen Kontinenten vereinigten. Wir stellten immer mehr Eimer und Töpfe auf, darunter auch Rühr- und Puddingschüsseln, Auflauf- und Backformen, liefen Slalom um die Hindernisse und leerten sie regelmäßig ins Klo.
In der weißen Porzellanschüssel wurde erst sichtbar, was sich über unseren Köpfen zusammenbraute und aus unserem Dach geflossen kam. Der Anblick der braunen Brühe war beschämend und empörend zugleich und der Ausfluss so undefinierbar, dass nicht mal unsere Hunde ihre Nase hineinstecken wollten.
»Siegfried, denk dran, das Dach zu reparieren«, mahnte meine Mutter, wenn der Regen aufhörte, und wiederholte die Ansage stereotyp mit immer sorgenvollerem Blick in den norddeutschen Himmel, der schon wieder dabei war, sich zuzuziehen, bis mein Vater seine Hausschuhe gegen die Gartenschuhe tauschte und meinen Bruder aufforderte, das Gleiche zu tun. Gemeinsam holten sie den Bunsenbrenner aus dem Schuppen und wuchteten ihn mit der schweren Gasflasche und der Teerpappe über die lange Leiter aufs Dach hinauf.
Auf der Suche nach den Löchern erzitterte das Haus unter ihren Schritten. Das Dach knackte auch dort, wo sie nicht ihren Fuß hinsetzten, und in der brüchigen Pappe enstanden neue Risse, die mit bloßem Auge oft gar nicht zu erkennen waren.
In jener Nacht war es ein besonders großes Konzert, das in seiner Vielstimmigkeit ganz harmonisch klang. Jeder Tropfen hatte seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Geschwindigkeit und produzierte seinen eigenen Ton, abhängig von Fassungsvermögen, Füllstand und Material des Eimers oder Topfs, in den er fiel.
Der Missklang, ein sattes und schmatzendes Geräusch, war nur mit geübten Ohren zu hören und erzählte, dass das Wasser wieder einmal ein neues Loch gefunden hatte und der Nadelfilz sich an einer Stelle zwischen den Behältern mit Wasser vollzusaugen begann.
Ein weiterer Eimer oder Topf musste her, und von meinen Geschwistern in ihren Zimmern rührte sich niemand. Dass alle schon schliefen, bezweifelte ich. Eher stellten sie sich taub, hörten über Kopfhörer Musik, schrieben Tagebuch oder mikroskopierten, und was außerhalb ihres Zimmers passierte, war ihnen scheißegal. Ich schlug meine Decke zurück.
Am Ende des langen Flurs machte ich die Tür zum Korridor auf, an dem links der Windfang mit Gäste-WC lag, geradeaus die Küche und rechts das Wohnzimmer. Die Glastür war geschlossen, wie immer, wenn für uns die Schlafenszeit angebrochen war und meine Eltern bis Sendeschluss vor der Flimmerkiste sitzen blieben.
Jetzt war es still da drinnen, der Fernseher stumm. Durch die getönte Scheibe fiel das Licht der Wohnzimmerlampe. Die Umrisse meiner Eltern auf der Polstergarnitur zeichneten sich nur undeutlich ab. Beide saßen ein wenig vornübergebeugt, als betrachteten sie auf dem niedrigen Tisch mit der runden Marmorplatte ein Problem, ein großes Rätsel, das vor dem Schlafengehen noch gelöst werden musste. Ich ahnte, dass es nicht darum ging, was nach Veröffentlichung der ersten Hochrechnung bereits ausgiebig beklagt und kommentiert worden war: dass Helmut Kohl tatsächlich die Bundestagswahl gewonnen hatte.
Das Schweigen meiner Eltern und das Schweigen des Fernsehers mussten eine andere Ursache haben und etwas sein, das noch obendrauf kam. Die Stille und Abwesenheit jeglicher Geräusche war ungewohnt und bleiern und gab mir das Gefühl, dass es da drinnen um etwas ging, das uns alle, die ganze Familie, direkt und unmittelbar betraf und das meine Eltern vor uns – meinen Geschwistern und mir – verheimlichen wollten.
Ich huschte barfuß auf Zehenspitzen in die Küche hinüber. Bevor ich vorsichtig das Topfkarussell in Bewegung setzen konnte, um möglichst lautlos den nächstbesten Behälter herauszunehmen und so schnell wie möglich wieder in mein Zimmer und mein Bett zu verschwinden, hörte ich hinter der Durchreiche die Stimme meiner Mutter. Sie klang mutlos.
»Was machen wir jetzt?«, fragte sie.
Von meinem Vater kam keine Antwort. Niemand rührte sich, auch nicht die Hunde in ihren Körben, als hätte die Frage eine Lähmung ausgelöst. Nur am Geschirrspüler blinkte unablässig das grüne Lämpchen und zeigte an, dass der Trockenvorgang beendet war.
»Nehmen wir uns einen Strick?«, fragte meine Mutter.
Den Kühlschrank durchlief ein Zittern. Die Flaschen in seinem Inneren klirrten leise. Im Wohnzimmer wurden Kaffeetassen und Aschenbecher ineinandergestellt – das Signal, dass das Gespräch und der Abend beendet waren und vielleicht auch das Leben, das wir bisher geführt hatten.
2
Ich benutzte das kleine Vokabelheft, das in die Gesäßtasche passte und gut überallhin mitzunehmen war. Links vom blassrosa Strich trug ich die deutschen Wörter ein, rechts die französische Entsprechung aus dem Langenscheidt-Wörterbuch. Wenn ich das Vokabelheft aufschlug und die klare Rechts-links-Einteilung sah, dazu die Linien, gefüllt mit Wortpaaren und meinem gleichmäßigen Schriftbild, überkam mich ein Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit.
Die Aufgabe war klar, übersichtlich und beherrschbar. Ich lernte drei Wortpaare am Stück, wiederholte sie im Kopf oder im Flüsterton so lange, bis ich sie einigermaßen fehlerfrei draufhatte. Dann nahm ich mir die nächsten drei Wortpaare vor, wiederholte alle sechs zusammen plus die nächsten drei und arbeitete mich auf diese Weise die Seite runter und – unten angekommen, nach demselben Muster – die Seite wieder rauf.
»Verstanden?«, fragte ich. »Compris?«
»Compris«, antwortete Jean-Philippe, mein französischer Gastbruder, der wie jeden Abend dabei war, den Spalt unter meiner Zimmertür mit einem Handtuch abzudichten.
Schon beim ersten Abendbrot, er hatte sich kaum hingesetzt, strich er mit der Messerklinge waagerecht über die Butter, sodass die Zähne ein gekämmtes Muster auf der Oberfläche hinterließen. Bis zu seiner Abreise führte er die Bewegung selbstbewusst, mit gespreiztem Ellenbogen, mehrmals hintereinander aus, ohne sich darum zu kümmern oder sich dafür zu interessieren, dass wir die Messerklinge anders handhabten, als es anscheinend bei ihm zu Hause in Frankreich der Fall war. Wir führten sie mit einem senkrechten Schnitt durch die Butter.
Ich übernahm die Technik von Jean-Philippe, die Butter horizontal abzustreichen, was äußerst praktisch war, wenn die Butter aus dem Kühlschrank kam und noch hart war wie Stein. Es war der Bruch mit einer Gewohnheit, die ich bis dahin nicht hinterfragt hatte.
Mein Vater sagte nichts und beschränkte sich darauf, die Butter auf seiner Seite nur noch exakter und sauberer abzuschneiden. Wenn es nach ihm ginge, würden wir die Butter nicht nur senkrecht, sondern auch nur von einer Seite anschneiden. So hatte er es einmal versucht anzuordnen und diese Anordnung mit dem üblichen »nebenbei gesagt« eingeleitet, als wollte er damit bereits dem Widerstand entgegentreten: Wir sollten aufhören, aus dem rechteckigen Butterklotz zuerst ein Fünfeck, dann ein Sechseck und schließlich ein Achteck zu machen, bis irgendwann überhaupt keine Form mehr zu erkennen war.
»Das kann ja wohl nicht so schwer sein«, beendete mein Vater seine Ausführungen.
»Wie soll das in die Praxis umgesetzt werden?«, fragte Boris, und Angela wollte wissen: »Sollen wir uns bei jedem Stück Butter auf eine Seite einigen und dann die Butter von dieser Seite Stück für Stück abtragen?«
Sie bezeichneten seine Vorstellungen als »faschistoid«.
Auch wenn ich bei der Diskussion meine Klappe hielt, konnte ich meinen Vater insgeheim gut verstehen. Ein frisches, unangetastetes Butterstück erinnerte ihn vermutlich an einen Backstein, und seine planlose Zerstückelung widersprach seinem Empfinden für Material und beleidigte sein Architektenauge. Er dachte in rechten Winkeln, wie er auch seine Häuser zeichnete: grundsätzlich von allen vier Seiten, akribisch vermaßt, technisch und schwarz-weiß. Die Darstellung von Natur als schmückendem Beiwerk, an der er sich versuchte und bei der er auf kein Lineal und keinen rechten Winkel zurückgreifen konnte, erinnerte dagegen an seine Handschrift: hingeworfene, gekritzelte Schnörkel – und das sollten dann Blumen, Büsche und Bäume sein.
Ich zeichnete damals, inspiriert von meinem Vater, ebenfalls Häuser, arbeitete dabei mit Filzern und starken Farben und steckte die Stifte nach Gebrauch zurück in ihre Verpackung nach ihrer farblichen Reihenfolge.
»Naiv« nannte Boris meine Bilder, die teilweise immer noch im Wechselrahmen im Flur hingen, und Oma Lydia sagte, als wäre sie bereit, auch diesen Schicksalsschlag hinzunehmen: »Vielleicht wirst du ja auch eines Tages Architekt.« Und seufzte: »Wie dein Vater.«
Jean-Philippe streute Dope in den Tabak, während ich rasch und routinemäßig die dunklen Ecken im Zimmer kontrollierte, die Lücke zwischen Schreibtisch und Wand, die dunklen Innenräume von Kleiderschrank und Bettkasten und zum Schluss den Bereich hinter der Gardine.
»Ça va?«, fragte Jean-Philippe.
Der krumpelige Glimmstängel, den er mir reichte, fühlte sich feucht an, wo er ihn beim Anzünden mit seinen Lippen benetzt hatte, und unsere Schultern berührten sich, als wir nebeneinandersaßen. Die Zweige der Zierkirsche draußen vor dem Fenster verbanden sich mit dem Gardinenmuster zu buckligen Gestalten und unheimlichen Gesichtern, verstärkt durch die Hintergrundbeleuchtung, das Lampenlicht, das durchs große Wohnzimmer auf die Terrasse fiel.
Es dauerte ein bisschen, aber dann konnte Jean-Philippe sie auch sehen, die knochige Hand, den langen Finger mit dem krummen Nagel und schließlich die Hexe komplett in ihren Lumpen, mit den zotteligen Haaren, die unter dem spitzen Hut hervorschauten. Sie war damals aus den Kulissen des Niederdeutschen Theaters in Bremen-Walle gehumpelt, ließ ihren stechenden Blick von der Bühne herunter durch die Zuschauerreihen wandern und tat genau das, was ich befürchtet hatte und auch durch Weggucken nicht verhindern konnte: Sie fixierte mich, streckte ihren Arm aus und zeigte mit ihrer knochigen Hand und einem langen, krumm gewachsenen Fingernagel auf mich, meinen Seitenscheitel und gestreiften Pullunder. Dabei stieß sie eine Verwünschung aus, die das gesamte Publikum – also alle Schülerinnen und Schüler meiner Grundschule und anderer Grundschulen im norddeutschen Raum – erschauern ließ.
Obwohl ich wusste, dass es Hexen nur in Märchenbüchern oder auf Schallplatten gab, konnte ich es drehen und wenden, wie ich wollte: Die Hexe, die ich gesehen hatte, war aus Fleisch und Blut gewesen. In der Sekunde, in der sich unsere Blicke getroffen hatten, war zwischen uns eine Verbindung entstanden, die ich nicht mehr kappen konnte. Sie kam mit mir nach Hause, nistete sich zwischen meinen Schränken und Schubladen ein, und ich war anscheinend bis an mein Lebensende dazu verdammt, die dunklen Ecken in meinem Zimmer in immer genau dieser Reihenfolge zu kontrollieren: zuerst die Lücke zwischen Schreibtisch und Wand, dann den Innenraum vom Kleiderschrank, den Bettkasten und zum Schluss den Bereich hinter der Gardine.
Selbst als die Angst verblasst und verschwunden war, führte ich die Kontrollrunde weiter durch. Sie war eine Angewohnheit aus grauer Vorzeit, ein Überbleibsel aus meinen Kindergarten- oder Grundschultagen, die wie das Vokabelheft zu einem funktionierenden System gehörte, das ich zwanghaft beibehielt und vor dem Schlafengehen so gehorsam absolvierte wie das Zähneputzen, Schultaschepacken und Vokabelnlernen.
»C’est fou«, sagte Jean-Philippe.
»Ja«, bestätigte ich. »Das ist verrückt.«
Als Jean-Philippe zwei Tage später abreiste, hinterließ er eine tiefe Kuhle in der Butter, die von uns nun von allen Seiten Stück für Stück weggeschnitten wurde, bis nichts mehr von ihr übrig war.
Die französischen Zeiten waren vorbei. Beim neuen Stück Butter war das horizontale Abstreichen und Kämmen mit den Messerzähnen mit sofortiger Wirkung untersagt.
3
»Wir brauchen Geld«, sagte meine Mutter und knallte mit der Schranktür. »Will jemand mit?«
Der Ford Capri parkte auf der gepflasterten Fläche hinter der Pforte. Meine Mutter schloss im Vorbeigehen für mich die Beifahrertür auf, warf ihre Handtasche rein, ging ums Auto herum und stieg auf der Fahrerseite ein.
Der erste Streckenabschnitt auf der Fahrt über die B6, bis zur großen Kreuzung und zum Abzweig nach Osterholz-Scharmbeck, dauerte normalerweise ziemlich genau eine Zigarettenlänge – wenn man nicht gerade hinter einem Laster hing. Meine Mutter trommelte nervös mit den Fingern auf dem Lenkrad, pustete ungeduldig den Zigarettenrauch zum Seitenfenster hinaus und stützte sich mit dem Ellenbogen auf das breite Türpolster. Überholen war praktisch unmöglich, zu viel Gegenverkehr.
Der Tabak am Ende der Zigarette glühte und knisterte. Der linke Reifen touchierte den Mittelstreifen. Dann setzte meine Mutter den Blinker und gab Gas.
Ich stemmte auf dem Beifahrersitz meinen Fuß auf den Boden. Wir befanden uns auf der falschen Fahrbahnseite, konnten nur noch auf die Kraft des Motors vertrauen und rasten immer schneller dem Auto entgegen, dessen Fahrer bereits die Lichthupe betätigte. Endlich scherten wir rechts ein und ließen mit 120 km/h den Laster und das Tempo-70-Schild hinter uns zurück.
Zu beiden Seiten der Bundesstraße lagen Felder und Wiesen, vereinzelt Einfamilienhäuser und Bauernhöfe und in der Ferne, leicht erhöht, ein rotes Backsteingebäude, die Dorfschule, die ich nach meinen Geschwistern als Letzter besucht hatte. Die meisten Mitschüler von damals waren schon lange aus meinem Blickfeld verschwunden, Kinder in kurzen Hosen und Gummistiefeln, die nach Kuhstall rochen, unbeholfen mit dicken Filzern eierförmige Kringel malten und dabei das Papier zerknickten, als ich schon mit Füller schrieb, und bei denen schon damals klar war, dass sie es niemals aufs Gymnasium schaffen würden.
Ich hielt Abstand zu diesen Kindern, als würde noch etwas anderes von ihnen ausgehen als bloß der Geruch nach Kuhstall, begann, Fleißsternchen und Sauberkeitspunkte zu sammeln und den Erwartungen gerecht zu werden, die meine Eltern in meine Geschwister und mich setzten. Wir waren der Beweis, dass wir uns auf der Erfolgsspur befanden und zu den Klugen gehörten. Wir würden aufs Gymnasium gehen, studieren, und unsere Zukunft würde großartig sein, eine einzige Bestätigung für unsere bereits großartige Gegenwart.
Meine Mutter drückte den Zigarettenstummel aus und klappte geräuschvoll den Aschenbecher zu, als wäre von allen Dingen, die noch zu erledigen waren, diese Sache schon mal geschafft. Ein Hauch von Zuversicht breitete sich aus, als hätte sich mit Rauch und Nikotin vorübergehend auch ein Ärger verflüchtigt, der proportional zur Menge an ungeöffneten Briefen anwuchs, die plötzlich, in einem nicht näher definierten Moment, spontan von meinem Vater oder meiner Mutter unwillig, fast trotzig und gleichzeitig mit dem Mut der Entschlossenheit aufgerissen, auseinandergefaltet und stumm, mit einem spöttischen Gesichtsausdruck und einer Zigarette im Mundwinkel gelesen wurden.
Meistens wurden sie ebenso stumm wieder zusammengefaltet und irgendwo an einem anderen Ort, bei den Telefonbüchern oder den Handschuhen und Mützen, abgelegt, manchmal mit einer verächtlichen Bemerkung.
Die Scheibenwischer quietschten auf der Windschutzscheibe, der Fahrtwind drückte die Regentropfen beiseite, und ich spürte, dass jetzt eine Gelegenheit wäre zu sagen, dass ich die Bemerkung mit dem Strick gehört hatte, um dann beiläufig zu fragen, ob meine Eltern ernsthaft mit dem Gedanken spielten, Selbstmord zu begehen – und wenn ja, was genau das Problem war. Mit dem neuen Kanzler, der neuen Regierung und der geistig-moralischen Wende hatte es wohl nichts zu tun, sondern eher mit der Post von Finanzamt, Steuerberater und Amtsgericht. Hatten sich inzwischen so viele Briefe angehäuft, dass es keine Lösung mehr gab?
Andererseits war der Freitod noch in derselben Nacht verworfen und fürs Erste kein Strick geknüpft worden. Falls der Selbstmord dennoch eine Option war, würde ich wissen wollen, ob meine Eltern sich Gedanken darüber gemacht hatten, was dann aus uns werden würde, aus mir und meinen drei älteren Geschwistern. Wer würde für uns sorgen? Oma Lydia als alte Frau mit schwachen Nerven und vorsintflutlichen Ansichten und Erziehungsmethoden? Oder Angela, als die Älteste von uns, die gerade volljährig geworden war, aber auch keine Ahnung hatte?
Vielleicht würde Tante Ingeborg aus Amerika anreisen und alles regeln. Aber was genau würde sie regeln? Sie würde uns wohl kaum alle mitnehmen können in ihr Haus im Vorort von Chicago zu Onkel, Cousin und Cousine. Das Flugticket kostete ja schon ein Vermögen. Vielleicht könnte ich, wenn ich mich besonders kooperativ, nett und freundlich zeigte, als Einziger von uns die Erlaubnis erwirken mitzukommen.
Am Ende würden wir doch alle ins Waisenhaus gesteckt werden, zum Beispiel ins SOS-Kinderdorf bei Worpswede, für das wir einmal gespendet hatten und seither jedes Jahr in der Adventszeit schaurig-schöne und irgendwie sehr traurige, naiv bemalte Postkarten geschickt bekamen.
Wir näherten uns bereits dem gelben Ortsschild der Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck. Mir lief die Zeit davon, und ich überlegte fieberhaft, wie ich es am besten anstellen könnte, den richtigen Ton zu treffen und vernünftige Worte zu finden, ohne gleich einen Anschiss zu bekommen oder einen Aufruhr zu provozieren, der zeigte, wie blank bei uns die Nerven lagen. Eines war klar: Wenn ich den Mund aufmachte, würde alles, was mir durch den Kopf schoss und mir im Moment noch völlig irrsinnig vorkam, sehr real im Raum stehen, und wir müssten damit umgehen.
Als würde meine Mutter meine schrägen Gedanken und Sorgen spüren, tastete sie auf der Mittelkonsole nach der Pfefferminzrolle und sagte in unternehmungslustigem Ton: »Hör mal.« Sie betätigte den Blinker. Der vertraute Rhythmus und der stupide Ton wirkten beruhigend. »Brauchst du noch etwas?«
Ich war überrascht. Mit einem solchen Angebot aus heiterem Himmel hatte ich am wenigsten gerechnet. Schließlich hatte ich weder Geburtstag, noch hatte ich mich in der letzten Zeit durch besondere Leistungen hervorgetan. Ich verwarf auf der Stelle alle Fragen, Anschuldigungen und anklagenden Worte und überlegte stattdessen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, den Konfirmationsanzug sicherzustellen. Mir schwebte eine Kombination aus einem nachtblauen Samtjackett, weinroter Fliege und steingrauer Flanellhose vor, wie sie im Schaufenster vom Kaufhaus Reuter zu besichtigen war und in den Augen meiner Eltern und Geschwister als extrem spießig galt.
Obwohl ich bereits angekündigt hatte, das Samtsakko tagein, tagaus zu tragen, vermutlich mit aufgekrempelten Ärmeln, wollte meine Mutter mich mit Hose und Jacke aus dunkelblauer Popeline abfinden, eine sportliche und unfeierliche Variante, um zu verhindern, dass der Konfirmationsanzug, einmal getragen, hinterher im Schrank verschimmeln würde, wie es vor drei Jahren mit dem Konfirmationsanzug von Boris aus olivfarbenem Cord passiert war. Dass ich mit meinem Undercut-Haarschnitt anders tickte und auch nicht in Latzhosen auf Friedensdemos ging, war bei meiner Mutter anscheinend noch nicht angekommen.
Ich beschloss, meine Forderungen nicht zu hoch zu schrauben, um nicht etwa am Ende leer auszugehen, und sagte, während meine Mutter in die Parklücke vor der Deutschen Bank setzte: »Ich brauche eine neue Hose.«
»Eine neue Hose?«, wiederholte meine Mutter, stellte den Scheibenwischer und die Scheinwerfer aus und schaute gedankenverloren über das verstaubte Armaturenbrett. Dann riss sie die Handbremse hoch. »Gute Idee«, lobte sie.
Wir hatten einen Plan und eine Aufgabe, die dem Nachmittag einen Sinn und dem Leben eine Normalität geben würden.
Meine Mutter langte in den Fußraum nach ihrer Handtasche und stieß, nach einem kurzen Blick in den Rückspiegel, entschlossen die Tür auf.
4
Wenn wir die Deutsche Bank betraten, breitete sich auf dem Gesicht von Frau Zellermeyer normalerweise das schönste Lächeln aus. Dann griff sie in den Plexiglasaufsteller und holte ein Auszahlungsformular hervor. Unsere Kontonummer kannte sie auswendig.
Während ihr silberner Kugelschreiber auf dem Formular Feld für Feld vorrückte, erkundigte sie sich in vertraulichem Plauderton nach dem Befinden meines Vaters, fragte nach unseren Plänen fürs Wochenende und mit gespielter Empörung, was in diesem Frühling eigentlich vom Wetter zu halten sei. Dabei klirrten ihre Armreife wie eine leise Musik auf dem Granit. Die Farbe ihres Nagellacks korrespondierte mit der Farbe ihres Lippenstifts, ihren Ohrclips, ihrer Bluse und überhaupt mit allem: ihrem schönen Dekolleté, dem kastanienbraunen Lockenkopf und dem warmen Klang ihrer Stimme.
Dann hatte der Kugelschreiber sein Ziel erreicht und schwebte so lange über dem rot umrandeten Kästchen fragend in der Luft, bis meine Mutter den Betrag nannte, den wir haben wollten.
Die Unterschrift meiner Mutter war eine Kette von kleinen, schräg nach rechts geneigten Buchstaben, jedes Glied mit dem anderen verbunden, ein gleichmäßiger Rhythmus, der von ihr eisern durchgehalten wurde, bis der Strich am Ende – statt zu verläppern – noch einmal entschlossen hochgerissen wurde.
Der Kassierer in seinem Glaskasten zählte zügig die blauen und braunen Scheine in die silberne Lade, fächerte sie dabei so präzise wie künstlerisch nebeneinander auf, betätigte dann den schwarzen Knauf und beförderte das Geld in einem halbautomatischen Vorgang unter der Panzerglasscheibe zu uns hindurch.
Meine Mutter nahm die Scheine, klopfte sie zurecht, dankte und verstaute den Packen im Portemonnaie.
Wir verließen die Bank mit dem schönen Gefühl, dass alles möglich sei. Wir könnten, zum Beispiel, den Topas kaufen, der uns beim Juwelier ins Auge gesprungen war. Oder uns das Teeservice zulegen und damit dem verregneten Nachmittag eine edle englische Note verleihen. Oder mit der kupfernen Bodenvase aus dem Gartencenter den kargen Windfang verschönern. Oder wenigstens ein Paar Schuhe kaufen – alles Dinge zum Anschauen und Anfassen, die bewiesen, dass unser Lebensstandard hoch war, ständig wuchs und weit über dem lag, was andere Leute sich leisten konnten.
Heute lächelte Frau Zellermeyer hinter der Theke nicht. Sie griff auch nicht zu den Zahlscheinen oder machte irgendeine nette Bemerkung. Nicht einmal ein freudiges »Frau Hormann« kam ihr zur Begrüßung über die Lippen.
Stattdessen versteinerte ihre Miene, bevor ihre Mundwinkel mechanisch nach oben wanderten, wo sie maskenhaft in der Lächelposition verharrten, während sie, als würde sie uns gar nicht kennen, wie ein sprechender Automat verkündete: »Einen Moment, bitte.«
Sie wandte sich an die Grünpflanzen und Blumenkübel, hinter denen der Schreibtisch des Filialleiters stand. Ihre Lippen über den Blättern von Gummibaum und Graslilien formten lautlos die Vokale in unserem Nachnamen, das O und das A.
Im Vergleich zu den Chefs von Sparkasse und Volksbank, die mit gemütlicher Wampe, altmodischen Spitzbärten und Schuppen auf den Schultern daherkamen, war Herr Baumgart drahtig, glattrasiert, rosig und auf eigentümliche Weise porentief rein. Er hatte rote Haare, helle Augen, helle Wimpern, und wenn er mit federndem Schritt auf meine Mutter zukam, rief er mit heller Stimme, in der normalerweise immer auch ein Lachen perlte: »Frau Hormann, Sie sehen ja wieder umwerfend aus! Wenn Sie hereinkommen, geht die Sonne auf!«
Meine Mutter lachte dann geschmeichelt und berichtete beim Abendbrot amüsiert, während sie eine Scheibe Lachsschinken vom Wurstteller angelte, von Herrn Baumgarts neuesten Komplimenten.
Mein Vater konnte Mimik, Gestik und sogar den Tonfall von Herrn Baumgart perfekt imitieren. Er stellte dafür bloß seine schönste Singstimme an, hob affektiert den Arm, wiederholte das Kompliment, das Herr Baumgart meiner Mutter gemacht hatte, und knickte sein Handgelenk genau in dem Moment nach unten ab, als seine Stimme im höchsten Flötenton beim »O« von »Frau Hormann« angekommen war.
Wir kringelten uns vor Vergnügen. Ohne dass es ausgesprochen wurde, war klar, dass Herr Baumgart das war, was man hinter vorgehaltener Hand einen warmen Bruder nannte, also zu den Männern gehörte, die manchmal abends im Fernsehen auftauchten, zum Beispiel bei Derrick, Männer im Rüschenhemd in zwielichtigen Münchner Bars, die Stefan Derrick und Harry Klein so lüstern ins Visier nahmen, dass die beiden froh sein konnten, wenn sie – nachdem sie ihre ermittlungstechnischen Fragen gestellt hatten – mit heiler Haut davonkamen.
Herr Baumgart mochte noch so zackig auftreten und sich in der Bank zum Filialleiter hochgearbeitet haben – am Ende konnte er nicht verheimlichen, dass er auch so ein Mann war. Und niemand wusste, wie er außerhalb der Schalterhalle unter seinesgleichen war, ob er sich dann immer noch so ausnehmend freundlich verhielt oder eine ganz andere Seite zum Vorschein kam, die ihn vielleicht unberechenbar machte.
Ich lachte bei den Showeinlagen meines Vaters besonders laut, um jeden Verdacht auszuräumen und von vornherein klarzumachen, dass ich ganz bestimmt nicht zu diesen Witzfiguren gehörte – auch wenn ich früher mit Puppen gespielt hatte und nicht nur Frau Petersen überzeugt gewesen war, dass ich ein Mädchen sei. Ich musste aufpassen, nicht in den Kreis der Verdächtigen zu geraten und auch als krankes Subjekt abgestempelt und ausgelacht zu werden.
Die Geste, mit der Herr Baumgart heute meine Mutter begrüßte, war überaus knapp. Eigentlich bewegte er nur zwei Finger, mit denen er sie an seinen Schreibtisch zitierte. Meine Mutter gab mir mit einem Blick zu verstehen, dass ich bei der Tür warten solle.
Sie verschwand hinter den Pflanzenkübeln und rückte dabei so widerwillig ihre Tasche auf der Schulter zurecht, als wäre sie auf dem Elternsprechtag und gezwungen, sich vom Lehrer anhören zu müssen, was sie sowieso schon wusste. Sie musste Interesse heucheln und hatte am Ende doch bloß ihre Zeit vergeudet, die sie auch für etwas Besseres, Schöneres hätte nutzen können.
Ich setzte mich auf den Stuhl am Fenster und beschloss zu ignorieren, dass hier irgendetwas Schräges vor meinen Augen ablief. Gleichzeitig sah ich schon kommen, dass es mit der Hose wahrscheinlich doch nichts werden würde. Oder hatte ich geträumt? Hatte meine Mutter mir nicht vor wenigen Minuten eine neue Hose in Aussicht gestellt? Und hatte ich nicht im Gegenzug darauf verzichtet, ihr mit unangenehmen Fragen zu kommen? Ich hatte meinen Teil der Abmachung erfüllt. Und sie?
Es war immer dasselbe: Ankündigungen wurden gemacht und wieder kassiert, Versprechungen geleugnet und vergessen.
Ich beschloss, egal, was da komme, auf meinem Recht zu bestehen und die Hose einzufordern, und zwar in Weinrot mit kleinkariertem Innenfutter.
Die weißen Lamellen, die so ordentlich senkrecht vor den Fenstern hingen, beruhigten mich ebenso wie der Blattglanz, der blaugraue Teppich und der Kassierer hinter dem Panzerglas, der als Einziger hemdsärmelig arbeitete und auf seinem Planeten – isoliert von seinen Kollegen – eine Unabhängigkeit zu haben schien und vielleicht eine ganz eigene Sicht auf die Dinge hatte. Es war nicht das erste Mal, dass ich mich in diesen Glaskasten träumte und – den Traum zu Ende gedacht – zu einem logischen Schluss kam, den ich einmal laut formuliert hatte, als ich sagte: »Ich glaube, ich mache nach dem Abi eine Banklehre und werde Kassierer.«
Meine Mutter hatte mich spöttisch angeschaut und geantwortet: »Da findet sich bestimmt noch etwas Besseres.«
Als sie wieder hinter den Grünpflanzen hervorkam, waren ihre Wangen hochrot, als hätte sie rechts und links eine gescheuert bekommen. Die Partie unter den Augen war ein dunkler Halbmond, der deutlich hervortrat. Sie sah aus wie nach einem Kampf, den sie verloren hatte, und gleichzeitig wütend und enttäuscht, sich für dieses Mal geschlagen geben zu müssen.
Wir verabschiedeten uns, ohne dass Frau Zellermeyer einen Zahlschein ausgefüllt hatte oder beim gemurmelten »Auf Wiedersehen« auch nur aufschaute. Auch der Kassierer war beschäftigt und wandte uns den Rücken zu.
Draußen zündete meine Mutter sich eine Zigarette an und pustete verächtlich den Rauch in die Luft. Schaute stumm über die Straße in den gekachelten Raum vom Fischgeschäft und dann hinüber ins goldene Licht der festlich illuminierten Auslagen vom Juwelier.
Nach zwei Zügen warf sie ihre Zigarette weg und sagte, als hätte die Sache auch ein Gutes: »Wenigstens wissen wir jetzt Bescheid.«
Wir fuhren ohne Hose zurück, aber mit einem Kuchenkarton: Windbeutel, Sahnebaiser, Zitronenrolle, Bienenstich und Obstschnitte – von jeder Sorte zwei, hübsch arrangiert auf einer kreisrunden Papierserviette, die mit dem Lochmuster aussah, als wäre sie eine Spitzendecke.
Als wir über die Betonstraße fuhren, sagte meine Mutter: »Kein Wort zu Oma Lydia. Verstanden?«
5
Der Linienbus war in der Ferne zuerst nur in seinen Umrissen zu sehen: Die große Windschutzscheibe, dann kam die cremefarbene und dunkelgrüne Lackierung zum Vorschein, und schließlich blitzten die Chromleisten und die silbernen Radkappen. Wie die Reifen vom glatten Asphalt auf die kopfsteingepflasterte Haltebucht rollten – das war der Sound der Großstadt. Mit einem Zischen öffneten sich die Ziehharmonikatüren.
Oma Lydia hatte sich von ihrem Sitz in der ersten Reihe erhoben und verabschiedete sich ohne Eile vom Fahrer. Dabei zerrte sie an ihrer großen Reisetasche und dem vollgestopften Einkaufsbeutel, um die Zeit zu gewinnen, die sie brauchte, um eine begonnene Erzählung zu Ende zu führen.
Man konnte davon ausgehen, dass sie den Mann mit der Strickjacke über dem Fahrersitz während der gesamten Reise – von Bremen-Hauptbahnhof über Walle, Burgdamm, Ihlpohl bis zu uns nach Heilshorn – zugetextet und mit Fakten beballert hatte, die, für sich betrachtet, grundsätzlich richtig, aber insgesamt extrem geschönt und teilweise auch hingebogen waren. Ihrer Version zufolge hatte ihr Schwiegersohn eine florierende Baufirma und bestückte als Architekt halb Norddeutschland mit den schönsten Traumhäusern. Ihre Tochter kümmerte sich derweil um das große Haus mit Garten und einem Swimmingpool, der noch im Bau war, und schmiss nebenbei das Büro. Und ihre vier Enkel, einer hübscher als der andere, lernten den Schulstoff im Schlaf und hatten Tischmanieren, von denen andere in unserem Alter sich getrost eine Scheibe abschneiden konnten. Darüber hinaus waren die Kinder ihr in tiefer Liebe zugetan, wofür ich, der jüngste Enkel an der Bushaltestelle, als lebender Beweis herhielt.
Der Fahrer schaute Oma Lydia nachsichtig hinterher, wie sie – schwer beladen, von einem Bein aufs andere schaukelnd – das Treppchen hinunterstieg und mit etwas Anlauf den letzten großen Schritt machte.
Wir küssten uns auf die Wange, und der Geruch von Kölnisch Wasser mischte sich mit dem Diesel des abfahrenden Busses.
»Und?« Oma Lydia hakte sich ein und drückte meinen Arm. »Mein Herz. Was gibt’s Neues?«
Ich hängte mir ihre schwere Reisetasche über die Schulter und berichtete. Es ging darum, Oma Lydia auf dem Weg von der Bushaltestelle zum Haus möglichst positiv auf ihren Besuch bei uns einzustimmen und jeden Verdacht, es könnte irgendetwas nicht in schönster Ordnung sein, im Keim zu ersticken. Ohne dass es laut ausgesprochen wurde, fiel diese Aufgabe mir zu.
Ich hob wie immer zuerst mich und meine Erfolge