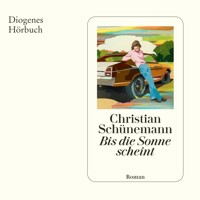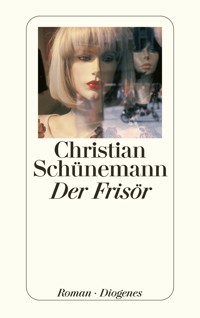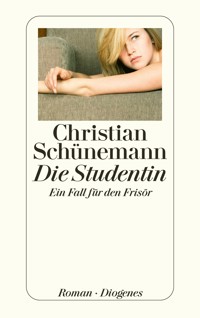
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Frisör
- Sprache: Deutsch
Eine Leiche stört die Ruhe der Geisteswissenschaften – es ist mords was los an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität! Ein neuer Fall für Tomas Prinz, Starfrisör und Detektiv wider Willen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Christian Schünemann
Die Studentin
Ein Fall fürden Frisör
Roman
Die Erstausgabe erschien 2009
im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von Dennis Galante (Ausschnitt)
Copyright © Dennis Galante /
Corbis
Für Jelena, Nina und Luca
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23915 7 (2.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60050 6
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] 0
Am Fahrradständer fand ich keine Lücke. Ich schob weiter zur Hauswand und entdeckte den Seiteneingang zum Anglistik-Institut, eine Abkürzung, die den Umweg über den Haupteingang erspart. Vielleicht wäre mir sonst das Blaulicht aufgefallen.
Auf den Sitzbänken im Foyer hockten heute nur vereinzelt Studenten. Die anderen waren wohl alle in der Vorlesung, bis auf die Kindsköpfe, die im Garten um die Tischtennisplatte rannten und alles daransetzten, mit einem Hechtsprung den Ball zu erwischen und dem Gegner vor den Latz zu schmettern. Als ob es nichts Wichtigeres gäbe. Ich überlegte, ob ich zuerst das Buch zu Sebastian in die Bibliothek tragen oder kurz bei Franz im Anglisten-Café vorbeischauen sollte.
Nein, ich wollte zuerst gucken, wie es Rosemarie ging, nach der Aufregung um die eingeworfene Scheibe gestern. Da sah ich die Polizisten.
Mir kam es vor, als folgte ich den Männern in Uniform, dabei gingen sie mir nur voraus. Wir hatten dasselbe Ziel. Es war derselbe Gang, wo ich in der vergangenen Woche mit Steffi Zahn über ihre Promotion geplaudert hatte, vor dem Büro der Professorin Mara Markowski, in dem seit einiger Zeit eine Reihe merkwürdiger Ereignisse die Ruhe der [6] Geisteswissenschaft störte. Was wie ein alberner Streich begann, hatte sich zu gemeinen Anschlägen gesteigert.
Die Polizisten bogen ab ins Sekretariat. Irgendwo wurde leise gemurmelt, ein Schluchzen, Geräusche hinter geschlossenen Türen. Hinter mir kam jemand den Gang entlang gelaufen, sehr schnell, es war Rosemarie, die da einen Sprint hinlegte, an mir vorbei, bis an die Tür. Der Durchgang war mit einem Band versperrt. Rosemarie stand still, öffnete Augen und Mund so weit, dass ich dachte, sie lacht gleich los. Doch nichts dergleichen geschah. Jemand nahm sie beiseite und führte sie weg.
Ich trat näher. Von hier konnte ich quer durchs Sekretariat ins Büro sehen. Hinter dem Schreibtisch lag ein sperriges Hindernis, über das sorgfältig ein Tuch gebreitet war. Aus der stillen, weißen Landschaft aus Hügeln und Tälern ragte eine kleine Erhebung empor, eine Spitze, die Nase eines Toten. Mir wurde übel. Wieder hatte der Unbekannte zugeschlagen, und dieses Mal hatte er getroffen.
Ich war unfähig, einen der Uniformierten zu fragen: Ist es die Professorin Mara Markowski, die da tot am Boden liegt?
»Aus dem Weg!«
Zwei Männer stellten dem Toten als letzte Dienstleistung den Sarg bereit.
»Was machen Sie denn hier, Herr Prinz?«
Ich kannte die Stimme. Wie ertappt drehte ich mich zur Kriminalkommissarin um. Wie sollte ich ihr in wenigen Worten erklären, was ich, der Münchner Frisör, am Anglistik-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität im Büro bei einer Leiche verloren hatte? Dass ich Vorlesungen besuchte, Fahrrad fuhr statt Taxi, für einen lockigen [7] Studenten schwärmte und in der Bibliothek englische Literatur auslieh. Ich sagte: »Frau Glaser, das ist eine gute Frage.«
Alles hatte mit Rosemarie angefangen, vor etwas mehr als einem Monat in London, genauer gesagt, in der Royal Albert Hall. Rosemarie war damals noch keine Studentin und mir völlig unbekannt. Und ich hatte ganz andere Sorgen.
[8] 1
Ich sah auf die Uhr. Noch vier Stunden bis zum Auftritt. Meine Tänzer reihten sich zur Musterung. Alles so weit sehr schön. Den Cowboyhut lässig im Nacken, damit man über Stirn und Ohren das Konzept der Schnittkonturen erkennt, das Dennis, mein Top-Stylist, dringend noch besser herausarbeiten musste. Dazu die enganliegenden Leggins als violett schimmernder Kontrast zu den silbernen Cowboystiefeln – genau so hatte ich es mir vorgestellt. Aber bitte nicht mit diesem Gekräusel: »Ich hatte gesagt: Keine Brusthaare!«
»Rasierschaum für Henry und Jimmy.« Kitty notierte.
Ich sagte: »Und für Archie etwas zum Ausstopfen. Ich will nicht, dass ihm die Stiefel ins Publikum fliegen.«
»No problem«, meinte Kitty.
Diese Kleinigkeiten gehören zur Vorbereitung der Show wie Lavendel in die Pflege für strohiges Haar. Den ganzen Tag schufteten die weltweit besten Frisöre hinter den Kulissen mit Perücken, Schminke und Stoffen für eine Drei-Minuten-Show, damit am Abend, draußen auf der Bühne, nichts haken und alles glatt durchlaufen würde. Aber nicht so: Was, bitte schön, sollte ich mit diesem Haarteil anfangen?
Bea, meine Farbstylistin, hatte es noch in München vor unserer Abreise für dieses Styling eingefärbt. Raffiniert [9] schimmerte es in einem leuchtenden Orange, aber um glatt zu liegen, war es zu dick, im Ansatz zu wulstig, und in den Spitzen franste es struppig aus. Wozu castete ich ein Supermodel mit Beinen bis zum Mond und Augen wie der tiefblaue Himmel, wenn ich es mit diesem Lappen auf dem Kopf über die Bühne schickte? Totlachen würden sich die Modejournalisten und Fotografen, die mit Stielaugen und riesigen Objektiven lauerten und abschätzten, was der große Tomas Prinz ihnen hier, bei der diesjährigen Alternative Hair Show, als den letzten Schrei präsentierte. Ich war unter Druck und behindert von dem Kerl, der mit geschulterter Kamera fürs Fernsehpublikum einfing, wie ich hier bei der Vorbereitung ratlos das Haarteil drehte und wendete.
»Bea, was ist da passiert?«, fragte ich streng.
»Das Haar ist nicht richtig geknüpft.« Bea war ganz sachlich. »Mir kam es gleich komisch vor. Darum hatte ich dich gestern ja auch gebeten, dass du es dir noch einmal anschaust.«
Mein Fluch war nicht mehr als ein Schnalzen im Geschrei und Gelächter. Meine Konkurrenten hatten keine Probleme, arbeiteten zügig und wussten genau, was sie taten. Das Kerlchen aus der Chicago-Truppe besprühte mit Hingabe die Sohlen von extravaganten Stiefeln. Wie Zipfelmützen wurden sie von seinen Kollegen mit Nadel und Faden auf das Resthaar eines weißgeschminkten Schädels geheftet. Keine leichte Aufgabe. Die Römer montierten in einem Nest aus meterlang geschweißtem Kunsthaar eine asymmetrische Styroporvorrichtung. Und der Kollege aus Wien drückte einen Strubbelkopf mit sanfter Gewalt in eine Gummimaske mit erbsengroßen Warzen. Auch eine hübsche Idee. Die [10] Frage bei diesem Wettkampf lautete: Wer bekommt vom Publikum – fünftausend angereiste Frisöre, die einmal im Jahr die Besten der Besten erleben wollen – heute Abend am meisten Jubel und Applaus? Wir wohl kaum. Wir hatten einen verknüpften Lappen und eine handfeste Krise. Ich schmiss das Haarteil in den Müll.
Bea zog sich wie ein Statist in den Hintergrund zurück, und Dennis ließ die Schere sinken. Ich musste entscheiden, wie es weiterging, müsste, wie Mutter es mit lauter Stimme in ihren Sitzungen tut, meine Leute auf Spur bringen und augenblicklich die richtige Entscheidung treffen. Ich sagte: »Kurze Pause.«
Erst einmal raus hier.
Was gelang mir überhaupt? Nicht mal, Aljoscha am Telefon zu überreden, von Moskau nach London zu kommen und sich meine Show anzusehen. Wir hatten heftig gestritten, gestern Abend. Ich stolperte.
»Tommy, how does it look like?« Julia, meine Choreographin, hatte es sich mit ausgestrecktem Bein und einem Becher Kaffee unter einem Tisch bequem gemacht und ein Haarteil mit barocken Locken in ihren praktischen Kurzhaarschnitt gehängt. Das Ding musste sie in einer der Taschen gefunden haben, die vollgestopft waren mit Lurex- und Klebebändern, Sonnenbrillen und Verlängerungsschnüren. Sie wollte mich aufmuntern und fragte kichernd: »Isn’t it like Marie Antoinette?«
Wie viele Shows wir schon gemeinsam durchgezogen hatten: Die herbe Frida-Kahlo-Performance mit den bunten Blumen in den Hochsteckfrisuren. Die farbige Choreographie mit den Smileys. Und der Coup mit den Jungs in weißen [11] Unterhosen, lange bevor die Amerikaner mit ihren Wäschemodels anfingen. Aber womit konnte man heute noch Aufsehen erregen?
»It’s nice«, sagte ich zu Julia und ging Richtung Bühnenausgang.
Weil ein Mosaikstein fehlte, musste ich völlig umdisponieren und alles über den Haufen werfen, was ich mit einem großen Model und einem kleinen Haarteil geplant hatte.
»Entschuldigung!«, sagte eine Frauenstimme. Ein hochgewachsener, schmaler Körper drückte mich gegen den Türrahmen. Die junge Frau wollte rein, ich raus. Ihr blasses Gesicht bestand nur aus Brille, aber ihr Haar war außergewöhnlich: dick, kräftig, rotblond und so viel, dass man sofort hineingreifen und Sachen damit anstellen wollte. Die Tür schlug hinter ihr zu.
Ich stand draußen und atmete durch. Wie hoch der Londoner Himmel war. Das ist nicht oft so.
»He, Alter, Platz da!«, schnauzte ein Rowdy von der Hebebühne eines Lastwagens.
Ich ging um den kreisrunden Kuppelbau herum und überquerte die Kensington Road zum Denkmal von King Albert, der beständig unter seinem Dach zwischen den Säulen residiert. Bei den Stufen half ich einer Nanny mit dem Kinderwagen. Ihre Uniform und der Fratz, der mich aus spitzenbesetzter Kapuze anglotzte, waren wie aus einer anderen Zeit. Ich nahm den Hauptweg durch Kensington Gardens, die gerade Verbindung über den See in den Hyde Park hinein.
Nicht weit von hier, in der New Bond Street, hatte einmal mein Leben als Frisör angefangen, beim größten Frisör [12] aller Zeiten, Vidal Sassoon. Mit dem Mut eines 18-Jährigen war ich einfach reingegangen, zu ihm in den Laden, und nicht wieder weg, bis ich bekam, was ich wollte: Lernen, was ein guter Frisör ist – mit dem Auge für die Genauigkeit, dem Maß für Proportion und der Fingerfertigkeit für den perfekten Schnitt. Fast fünfundzwanzig Jahre ist das jetzt her. Damals konnte ich mir gerade mal ein Paar Schuhe mit Ledersohlen leisten, und Maßhemden interessierten mich noch nicht. Ich bewunderte die Kreativität der Chelsey-Punks, die auf der Kings Road abhingen, und träumte in meinem kleinen Zimmer in der Lincoln Street von der großen, starken Liebe und manchmal von einer Zugehfrau wie heute meine Agnes. Jeden Penny Trinkgeld kratzte ich zusammen, um bloß keines der Musicals auf der Shaftesbury Avenue zu verpassen. Ich glaube, es waren gar nicht die schrillen Kostüme und Frisuren, die mich bannten, sondern die Spielwut der Menschen, die da oben auf der Bühne alles gaben. Wir im Publikum dankten es ihnen Abend für Abend mit kreischender Begeisterung.
Damals wurde mein Talent entdeckt, die Lässigkeit, kreativ mit dem Haar, dem phantastisch seidigen Material, umzugehen, Moden zu erspüren und Trends zu setzen. Ich war dann auch derjenige, der für Vidal Sassoon um die Welt reiste und den Frisören die Philosophie vom perfekten Schnitt erklärte und ihnen diese Kunst vorführte. Und die Nanny, die da hinten jetzt die Enten fütterte und ihren Pagenschnitt für meinen Geschmack einen Fingerbreit zu kurz trug, war nicht die Einzige, die keine Ahnung hatte, wie revolutionär wir nach der düsteren Zeit des Ondulierens, Toupierens, der Dauer- und Wasserwellen gewesen waren.
[13] Aber mit den Gummimasken, dem Styropor und den Lackstiefeln der Kollegen-Frisöre im Theater hatte ich nie etwas am Hut. Mir ging es immer um die Haare.
Die Familien spazierten im Sonntagsstaat in der Sonne durch den Hyde-Park, und jeder Scheitel hatte seinen Platz.
Ich ging zurück. Ich hatte eine Idee, wie wir auch ohne Haarteil punkten könnten.
Dennis arbeitete an den Konturen, Bea polierte die silbernen Stiefel. Und Kitty war immer noch auf der Suche nach Rasierschaum.
»Wie viel Zeit haben wir?«, fragte ich.
»Bis zur Generalprobe – eineinhalb Stunden«, sagte Bea.
Jetzt kam es auf jede Minute an, und jeder Handgriff musste sitzen.
»Tommy«, schrie die Disponentin mit Headset und Klemmbrett durch die Garderobe. »Draußen ist eine junge Dame. Die will dich unbedingt sprechen.«
»No way«, sagte Dennis.
Und Bea: »Claire, bitte setz dich.«
Das Model starrte in ihr Spiegelbild, als wollte sie das Ergebnis erahnen, das ich in dieser Minute genau vor mir sah.
Eineinhalb Stunden später stand die Choreographin Julia auf der Bühne und klatschte kurz und energisch in die Hände. Jeder weiß, was das in der Sprache der Turnlehrer und Choreographen heißt. Claire bezog oben auf der Treppe unter dem Spotlight Position und senkte den Kopf, während sie den Fuß vorstellte. Dann hob sie das Kinn. Sie war jetzt die Königin. Die Tänzer verkrümelten sich in die Kulissen, und ich schlich ins Parkett, um aus dem Halbdunkel mit dem Zuschauerblick die Probe zu beobachten.
[14] »Musik!«, rief Julia.
Jeder Schritt von Claire die Treppe hinunter war begleitet von einem Hammerschlag aus der Lautsprecheranlage. Streng ihr Pony, locker die gebügelten, in sich verdrehten Partien, die mit unsichtbaren Haarnadeln und etwas Spray zu einem kunstvollen Gebilde aufgesteckt waren. Mädchenhaft und gleichzeitig verrucht sah es aus, aber die eigentliche Krönung war das bunt glitzernde Diadem. Wunderbar zu beobachten, mit welcher Leichtigkeit die Haare im Nacken sprangen und jede noch so kleine Bewegung mitmachten. Dieser Effekt lässt sich nicht chemisch herstellen, sondern nur durch die Kunst, winzige Millimeter schräg in die Spitzen zu schneiden, ohne dabei die gerade Linie zu gefährden. Eine zeitraubende Arbeit, aber das Ergebnis ist unglaublich. Claire präsentierte sich im Zentrum der Bühne: Mit dem raffiniert geschürzten Rock aus glänzender Seide schien sie nur aus Beinen zu bestehen, die sich in den Schühchen von Vivienne Westwood noch einmal um zwei Handbreit verlängerten. Ein toller Auftakt.
Die Musik änderte jäh das Tempo. Die zarten Geigenklänge hatten wir extra komponieren lassen. Claire badete im weichen Licht. Sie beherrschte perfekt die charmanten Kleinigkeiten, diese Abfolge von Drehung, Blick, Lächeln, und das Timing, mit dem sie die zentimeterlangen Wimpern mit dem feinen Muster – mein Mitbringsel aus Japan – auf- und niederschlug, kleine Vogelschwingen, auf denen sich sanft die Schneeflocken niedergelassen hatten. Claire tanzte Striptease, ohne Haut zu zeigen, sexy und selbstvergessen nur für sich. Bis die Jungs kamen – hier wurde die Musik wieder ruppig. Breitbeinig stiefelten sie glitzernd und halbnackt aus den Kulissen, als würden an ihnen rechts und links [15] schwere Colts hängen. Ich liebte diese Parodie. Und Dennis hatte mit seiner Arbeit gezeigt, was ein Top-Stylist aus einem Frisurenkonzept machen kann, auch wenn zu befürchten war, dass das Publikum es bei den breiten Schultern und knackigen Hintern nicht groß beachten würde. Die Männer tanzten an Claire heran, und das sah so weit ganz passabel aus. Dann stolperten sie und lagen ihr irgendwie zu Füßen. Aus.
»Hübsch«, sagte ich. »Wirklich, ganz hübsch.«
Aber eben nur hübsch.
Julia hielt sich die schmalen Hüften, als hätte sie nach einem anstrengenden Lauf Seitenstechen, und schaute misstrauisch zu mir herunter in den Zuschauerraum.
»Nur das Ende gefällt mir nicht«, sagte ich. »Das Ende macht alles kaputt. Es ist einfach langweilig. Mir fehlt der Clou, versteht ihr? Es gibt keinen Höhepunkt.«
Die Truppe da oben ließ ratlos die Schultern hängen. Mit meiner Kritik hatte ich ihnen den Saft abgedreht.
»Okay, ihr Süßen.« Ich wusste jetzt, wie die Choreographie sein musste. »Wir wollen doch eine kleine Geschichte erzählen. Vielleicht so: Du, Claire, ignorierst zuerst die Jungs. Und Henry, Jimmy und Archie – ihr verlasst euch nicht nur auf eure hübschen Ärsche, sondern legt euch mal richtig ins Zeug. Ihr müsst immer wieder an Claire rantanzen, und du, Claire, reagierst. Sie gehen dir auf die Nerven. Du willst sie nicht. Sie sollen abhauen. Gib ihnen einen Tritt, einen Schlag, einen Hieb – extra und mit voller Kraft. Dann, Jungs, fallt ihr um, und das war’s.«
»Okay«, sagte Julia. Und noch einmal: »Okay. Wir machen Comedy.«
Meine Choreographin hatte mich verstanden.
[16] »Kommt, probieren wir es! Auf die Plätze!«
Claire unter das Spotlight, die Tänzer in die Kulissen.
»Musik!«
Claire schreitet forsch die Treppe herunter, ins Zentrum der Bühne. Tempowechsel. Claire wiegt sich, klimpert mit den Wimpern, tanzt selbstvergessen ihren Beinahe-Striptease – und jetzt die Jungs! Tanzen an Claire heran, während sie ihre Verehrer nicht zu bemerken scheint. Henry, Jimmy und Archie posieren und tun alles, um einen Blick von ihr zu erhaschen, aber Claire – viel besser! – bleibt ganz bei sich, erteilt, ohne es anscheinend auch nur zu bemerken, Archie einen Hieb – der geht empfindlich getroffen zu Boden – versetzt Henry einen Schlag – der rollt gekonnt zur Seite – und jetzt kriegt Jimmy seinen Tritt – extra und mit voller Kraft. Zu viel Kraft.
Ich glaubte zu hören, wie der Absatz brach.
Claire schrie.
Bei meinem Sprung auf die Bühne ging die Musik aus.
Sie lag am Boden. Der Absatz war völlig in Ordnung. »Claire, bist du okay?«
Sie stöhnte. Natürlich war sie nicht okay.
»Einen Arzt!«
Schon jetzt konnte man sich nicht mehr vorstellen, dass dieser Knöchel noch vor einer Minute einmal schlank und schön gewesen sein soll.
»Fuck!«
Das war’s. Game over. Wir hatten einfach kein Glück.
»Entschuldigung«, war eine Stimme zu hören, laut und ganz schön forsch.
Dieses Gesicht, das nur aus Brille bestand, umrahmt von [17] wunderschönen rotblonden Haaren, sah ich jetzt schon zum zweiten Mal. Sie trat ins Scheinwerferlicht. Ich kniff die Augen zusammen.
»Finde ich hier Tomas Prinz?«, fragte sie.
Vielleicht gab es eine letzte Möglichkeit, wie ich versuchen könnte, meine Show zu retten.
Claire wurde jetzt mit Martinshorn ins Krankenhaus geliefert, und die Chicago-Truppe hatte erfolgreich den siebten Schuh als Zipfelmütze auf einem Schädel verankert. Die Ärzte würden bei Claire einen Bänderriss oder einen glatten Bruch diagnostizieren, und die Römer drechselten mit Kunsthaar die letzte Windung um die Styroporvorrichtung. Und während die Österreicher eine ganze Herde echsenartiger Gestalten mit riesigen Sprungfedern unter den Füßen an den Start brachten, hatten wir perfekt geschnittene Formen zu bieten, glitzernde Leggins, silberne Stiefel und ein paar Brusthaare, die wir noch rasieren oder ondulieren könnten. Aber die Hauptperson war weg, und die Arbeit eines Nachmittags für die Katz. Teatime.
Dieses fremde Mädchen mit den roten Haaren hatte sich hier im Trubel einen Stuhl ergattert und hingesetzt. Sie hielt die Tasse, die Archie ihm gebracht hatte, und fragte nach Milch und Zucker. Die Tänzer Henry und Jimmy zogen los, um das Gewünschte zu besorgen.
Ich hörte nicht richtig zu, als sie sagte: »Ich dachte, Frau Seidlein, Ihre Schwester, hätte Ihnen Bescheid gegeben. Wir hatten ein date am Bühneneingang – schon vergessen?«
Ihr Haar war wirklich ganz erstaunlich. Wie gesagt: zum Reingreifen und Unsinn machen. Was man damit alles anstellen konnte!
[18] »Entschuldigung«, sagte ich und stand auf. »Darf ich?«
Gesund, fest und unglaublich viel.
Sie lächelte, als würde ich sie streicheln, und sagte: »Ins Schlafzimmer der Queen zu kommen, ist jedenfalls einfacher als hierher, in die Albert Hall.«
»Nimm doch bitte mal die Brille ab.« Ich griff vorsichtig an die Bügel.
Grüne Augen kamen zum Vorschein, die unter geschwungenen dunklen Brauen in eine Welt hinausschauten, als hätten sie sie so noch nie gesehen. Und Sommersprossen vergnügten sich auf einer Nase, die so schmal war, dass sie dieses große Brillengestell eigentlich gar nicht schultern konnte.
»Schon besser, oder?«, fragte Dennis.
»Allerdings«, sagte Bea. »Überhaupt kein Vergleich.«
»Geh doch bitte mal ein paar Schritte.«
Sie fragte nicht, warum, und stand auf. Dieses Lächeln, sie war einfach anmutig. Nur merkwürdig, wie sie den Becher in der ausgestreckten Hand hielt, als würde sie auf einem Schwebebalken balancieren. Ich nahm ihr den Becher weg.
»Mister«, sagte sie. »Ich kann nichts sehen.«
»Hast du keine Linsen?«
»Nein.«
»Hast du überhaupt schon einmal auf einer Bühne gestanden?«
»Na klar! Ich habe bei Top-Shop gemodelt, rauf und runter.«
»Kannst du tanzen?«, fragte ich.
»Und singen.«
Bea sah mich an. Wir dachten dasselbe: Das könnte die [19] Lösung sein. Blieb nur noch das Problem mit der Kurzsichtigkeit.
»Ich weiß nicht einmal, wie du heißt«, sagte ich.
»Rosemarie.«
»Wie bitte?«
»Rosemarie Clifford. Ich komme aus Ipswich.«
»Und warum platzt du in meine Generalprobe?«
»Du sollst mich zu deiner Schwester nach München bringen…«
»Weißt du was?«
»…ich bin das Au-pair-Girl.«
»Nein, du bist engagiert. Ich brauche dich für meine Show.«
[20] 2
Rosemarie hatte noch nie in ihrem Leben Peking-Ente gegessen! Bea nahm ihre Hand.
Ich hatte nach der Vorstellung zu meiner Mannschaft gesagt: Wir gehen ins Restaurant ›Maze‹, feiern beim Starkoch Gordon Ramsay und essen Slow Cooked Prawns und Roasted Orkney Sea Scallops. Ich fand das angemessen. Nur der russische Techniker, der zum ersten Mal in London war, entschuldigte sich. Er wollte vor seinem Rückflug, morgen, in aller Herrgottsfrühe, unbedingt noch die Tower Bridge und Houses of Parliament sehen. Das konnte ich gut verstehen. Ich gab ihm fünfzig Pfund fürs Taxi. Die Jungs dagegen hatten sich blitzschnell umgezogen und halfen Dennis, unser Zeug von der Garderobe ins Hotel zu schaffen, während wir schon im Taxi unterwegs waren, diese rollende Kabine, in der man einander mit angezogenen Knien gegenübersitzt, immer Sir oder Lady bei einer Besprechung oder beim Kaffeeklatsch.
Ich schob das kleine Fenster zum Fahrer auf. Wir waren fast schon am Hyde Park Corner, und diese Information von Rosemarie änderte alles.
»Wir fahren nach Chinatown«, sagte ich. Der Fahrer wechselte die Spur, und Kitty gab die Routenänderung telefonisch an Dennis durch. Doch die Jungs beschlossen: keine Lust auf Peking-Ente. Denen war nicht zu helfen.
[21] Bea hielt sich Rosemaries Hand unter die Augen, als müsste sie einen winzigen Stachel aus der Fläche entfernen. Im fahrenden Hell-Dunkel-Geflacker konnte man nicht gut sehen. »Wie eng deine Handlinien beim kleinen Finger zusammenlaufen!«, sagte Bea.
Rosemarie betrachtete ihre Hand, als hätte sie diesen Körperteil da, am Ende ihres Arms, noch nie zuvor gesehen. Und mit dieser Entdeckung stand sie nicht allein da. Seit sich herumgesprochen hatte, dass Bea nicht mehr nur in den Sternen, sondern auch in Händen liest und ganz verblüffende Behauptungen über Stärken und Schwächen eines Charakters aufstellt, kam es mir vor, als ob immer mehr Kunden im Salon ihre Hand mit Bedacht auf die Lehne des Frisörstuhls legen. Doch Beas neuer Tick bereitete mir heimlich Kummer. Eines Tages, fürchtete ich, könnte meine Farbstylistin den Pinsel hinschmeißen und nur noch diese Beratungen machen.
Bea studierte die andere Hand von Rosemarie: »Du überlegst oft, was andere Menschen über dich denken, und willst dich kontrollieren. Aber heute Abend, das hast du selbst gemerkt, war alles anders. Überleg mal: Bis jetzt hattest du noch nie vor Tausenden Zuschauern im Rampenlicht gestanden. Du hast noch nie Peking-Ente gegessen. Jetzt merkst du, du kannst alles – wenn du nur willst.«
Nun kam wieder die Sache mit den Fingerkuppen. Bea nahm Rosemaries Hand und probierte, an jedem einzelnen Finger die Kuppe zu biegen. Je biegsamer, desto größer die Flexibilität. Meine Fingerkuppen sind zirkusreif biegsam, aber was meine Flexibilität betrifft, würden viele Menschen die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Und bei Rosemarie? Ebenfalls problematisch.
[22] »Ich verstehe schon«, sagte Bea, »du suchst nach einem Prinzip, und wenn du es gefunden hast, willst du daran festhalten. Du willst es zum Teil deiner Persönlichkeit machen und nie mehr aufgeben. Das ehrt dich natürlich. Andererseits…«
Auch Kitty prüfte jetzt ihre Fingerkuppen.
»…bist du sehr selbstbewusst, Rosemarie. Aber du solltest, bevor du loslegst, ruhig einmal tief Luft holen und überlegen, welche Konsequenzen dein Handeln hat. Du musst lernen abzuschätzen, ob das, was du tust, auch wirklich das Richtige ist. Und dann kannst du deine Fähigkeiten und Talente frei ausleben.«
»Welche Fähigkeiten und Talente meinst du denn?«, fragte Rosemarie.
Für meine Schwester Regula hoffte ich, dass Rosemaries Fähigkeiten und Talente als Au-pair-Mädchen im Zubereiten von Plumpudding und Ham and Eggs liegen würden. Aber was wusste ich, was im Kopf einer Achtzehnjährigen vorgeht, die eben noch auf einer Bühne von fünftausend Menschen beklatscht worden war und in deren Brillengläsern jetzt die bunt verlockenden Leuchtreklamen blinkten? Und Bea las nichts als Flausen in der ausgestreckten Hand, die Rosemarie nun, Gott sei Dank, benutzen musste, um den Türöffner zu betätigen. Das Taxi hatte angehalten.
»Bist du Waage?«, fragte Bea. »Nein, du bist Löwe.«
»Falsch«, sagte Rosemarie und sah beim Aussteigen in die Sterne, als verkündete sie ihren besten Freunden ihre hervorragendste Eigenschaft: »Ich bin Wassermann!«
Bea guckte verwundert, ich suchte in meiner Hosentasche nach Geldscheinen, und Kitty rief: »Hopp!«
[23] Hier, in Chinatown, mag ich die fransigen Bommeln an den roten Laternen, das Gepinsel der unlesbaren Schriftzeichen, die winkenden Pfoten der Grinse-Katzen, all das Billige, Goldene. Dazu die Enten und Hühner in den Fenstern, die ihre gerupften Flügel hängen ließen und so bleich waren wie die blanken Beine der Frauen, die in dieser kalten Herbstnacht schnatternd und ineinander eingehakt die Straße entlangtrippelten, als wären die Nächte lau und die Männer, die ihre erhobene Bierflasche angrölten, ihr Schicksal, das sie in dieser Nacht nichts anging. Für sie war Chinatown nur ein Durchgang. Wahrscheinlich gingen sie zu Piccadilly Circus, wo es rund um die Uhr kreiselt und wirbelt und vielleicht das einzig wahre Vergnügen wartet. Lee Ho-Fook stand in seiner Tür und winkte aus dem Menschenstrom die Hungrigen in sein Lokal. Den Gastraum im ersten Stock mit den ungastlichen Neonröhren und den abwaschbaren Speisekarten kenne ich in- und auswendig. Schließlich bin ich hier seit Jahren – oder waren es Jahrzehnte? – Stammgast.
Eilig wurde ein sauberes Papier über unseren Tisch gebreitet. Ich fuhr mit dem Finger die Abteilungen ab und bestellte Peking-Ente und Gemüse, Suppen und Saucen in süßsauer und scharf, Reiswein, Weißwein, Bier, Wasser – alles und für jeden etwas.
Rosemarie hatte den Arm aufgestützt und folgte den Strichen und Linien, eine Art Weltkarte der Chirologie, die Bea auf das Papiertuch zeichnete. Das Mädchen hatte darauf bestanden, heute Abend noch ihre Frisur aus der Show zu tragen, mit der ich sie komplett verändert hatte. Sie war schön. Wie könnte ich ihr Styling sonst beschreiben? Sie war aus einer anderen Zeit, naiv, aber auch frech. Ein [24] strenger Mittelscheitel, ein glatter Oberkopf, aber die Haare rechts und links zu einem großen, abstehenden Afro gezupft. Ich hatte eine genaue Vorstellung von jeder einzelnen Locke gehabt. Zu dritt hatten wir um sie herumgestanden und das Haar mit sechs Händen in Rekordzeit gebürstet und geschnitten, hatten es um Haarnadeln herumgewickelt, immer in Form einer Acht, und jedes Haarnadelpaket mit dem Glätteisen gedämpft, und das hundert Mal. Das Ergebnis ist extrem. Eine solche Krause kennt die Natur nicht.
Vor ihrem Auftritt durfte Rosemarie noch ein Mal in den Spiegel gucken, dann hatte ich ihre Brille, das hässliche Ding, kassiert und Rosemaries Kopf unter einem Schleier versteckt, den Dennis zusammen mit einem Kleid aus Gaze aufgetrieben hatte. Wenn alle skeptisch sind, verlasse ich mich auf meinen Instinkt. Ich machte Rosemaries Sehschwäche einfach zum Konzept und kreierte einen dramatischen Auftakt. Und dramatischer ging es nicht: Ich schubste sie auf die Bühne und betete heimlich, es möge kein Unglück geschehen, bis die Tänzer ihr den Schleier wegreißen. Rosemarie tappte, perfekt ausgeleuchtet, zu den Sphärenklängen, die Dennis auf seinem mp3-Player gespeichert hatte, im weißen Gewand umher, schlafwandlerisch statt kurzsichtig. Rosemarie liebte ihr Styling und ich das Wesen, das ich erschaffen hatte. Die Person, die sich dahinter verbarg, kannte ich nicht, und vielleicht war sie mir zu diesem Zeitpunkt auch egal. Erst später, als die Ereignisse über uns hereinbrachen und mir klar wurde, wozu Rosemarie imstande war, würde ich anfangen, mir Vorwürfe zu machen. Ich würde mich fragen, ob nicht die Wandlung, die wir an diesem Abend in London an ihr vorgenommen hatten, sie zu all dem Unsinn [25] anspornte, den sie anstellen würde. Aber so weit war es noch nicht. Noch lief alles gut.
Bei Lee Ho-Fook kam, wie immer, alles auf einmal und von allen Seiten. In Sekunden war der Tisch voll mit Schüsseln, Schalen und Tellern und Beas Gekritzel darunter verschwunden. Ich hob mein Glas und sagte: »Liebe Rosemarie, herzlichen Dank, dass du alles so klaglos mitgemacht hast. Wie ein Profi. Es ist einfach so: Ohne dich hätten wir alt ausgesehen. Auf dein Wohl, Rosemarie!«
Sie lachte glücklich.
»Warst du eigentlich schon einmal in München?«, fragte ich.
»Nicht mal in Deutschland.«
»Aber du sprichst so hervorragend deutsch!«
»Meine Großmutter war aus München. Aus der Petticoat-Straße.«
»Du meinst wahrscheinlich: Pettenkoferstraße. Die ist bei mir um die Ecke, auf der anderen Seite vom Sendlinger-Tor-Platz. Ich wohne im Glockenbachviertel, in der Hans-Sachs-Straße, eine der schönsten Straßen Münchens. Mit vielen Cafés, Kneipen, Bars und interessanten kleinen Geschäften. Ich zeige dir die Gegend bei Gelegenheit, wenn du magst.«
»Ist das weit von da, wo ich wohne?«, fragte Rosmarie.
»Regula wohnt ganz woanders, in Nord-Schwabing. Da ist alles ein bisschen ruhiger.«
»Und wie weit ist es von Nord-Schwabing ins Glockenbachviertel?«
»Mit dem Taxi eine Viertelstunde, höchstens. Es sei denn, auf der Leopold ist wieder Stau.«
[26] »Und zu Fuß? Oder mit dem Fahrrad?«
»In München ist eigentlich nichts richtig weit. Jedenfalls im Vergleich zu London oder Moskau. Aber wenn du aus Ipswich kommst, ist München natürlich riesig.«
»Nichts gegen Ipswich!«, meinte Rosemarie. »Aus Ipswich kommt der Erfinder von James Bond. Und Thunderball hat auch bei uns gespielt.«
»Jetzt erinnere ich mich«, sagte ich. »Auf dieser Beauty-Farm in Shrubland Hall sind Bea und ich sogar schon einmal gewesen. Da war ein Masseur… – Entschuldigung.«
Kitty, meine Managerin, schob mir, wie zur Erinnerung, das Mobiltelefon über den Tisch.
Ich wählte. »Nur ganz kurz…«, sagte ich. Doch statt Aljoschas Stimme hatte ich bloß ein Tuten im Ohr. Mein Freund in Moskau hatte mich einfach weggedrückt. Ich war irritiert. Aber vielleicht stand er sich bei einer der Vernissagen, die für ihn Pflichtveranstaltungen sind, die Beine in den Bauch, oder er war einfach müde. Schließlich hatte er im Moment ganz schön viele Rennereien mit unserem gemeinsamen Projekt: Wir schenkten seiner Großmutter, Babuschka, für ihre Wohnung im Moskauer Plattenbau ein neues Badezimmer. Aljoscha kümmerte sich um Material und Handwerker, ich mich um die Finanzierung. Doch der Umbau zog sich hin. Nachdem die rustikale Kachel aus Portugal vom Tisch war, ging es nun um das italienische Glasmosaik, mit dessen farbigen Steinen sich ganz phantastische Muster und Motive verlegen lassen. Ich hatte das Budget erhöht und stellte mir vor, wie Babuschka inmitten der heruntergekommenen Hochhauswüste in einem fensterlosen Raum im achten Stock, umgeben von gefliesten Seerosen, [27] ein Vollbad nahm, in einer Sitzbadewanne mit Haltegriff und bequemem Einstieg.
Am dritten Oktober, so hatten wir geplant, wenn alles ausgestanden war, würde Aljoscha nach München kommen. Und er hatte keinen blassen Schimmer, dass sich der Kurztrip für ihn zu einem verlängerten Wochenende in Rom auswachsen würde. Gerne hätte ich mich jetzt an Aljoschas Schulter gelehnt.
Für einen Moment schloss ich die Augen und versuchte alles auszublenden: das laute Gerede im Lokal, das Lachen, den Dunst, die Hektik. Den Fön bei der Show, die Luft elektrisch, Nieselregen aus den Zerstäubern, Härchen, die wirbeln, Puderstaub überall.
Ich öffnete die Augen, sah Rosemaries Brille und hörte ihr Lachen, helle Töne, zu einer endlosen Kette aneinandergereiht. Sie steckte mich an damit.
»Und deine Eltern?«, fragte ich. »Hast du Geschwister?«
»Zwei Schwestern.«
»Älter oder jünger?«
»Ich bin ein Nachzügler, sagt man nicht so?«
»Wie alt bist du? Achtzehn?«
»Schon fast neunzehn.«
»Das Nesthäkchen.«
»Stell dir vor, mein armer Daddy: mit der Großmutter fünf Frauen! Er ist dann auch zurück nach Irland. Dass wir zu Hause immer deutsch gesprochen haben, hat ihm den Rest gegeben. Behauptet meine Mutter jedenfalls.«
»Warum habt ihr Deutsch geredet?«
»Wegen meiner Großmutter. Daher auch mein Name, nach meiner Großmutter, Rosemarie. Wie findest du ihn?«
[28] »Rosemarie, Rose – ich weiß nicht, ob ich mein Kind so nennen würde, aber ich mag ihn. Doch, ich finde deinen Namen schön.«
»Hast du keine Kinder?«
»Nein, auch keine in Sicht.«
»Und bist du verheiratet? Oder hast du eine Freundin?«
»Ich habe einen Freund. Aljoscha heißt er. Er lebt in Moskau. Vielleicht lernst du ihn bald kennen.«
»Das heißt also, du siehst ihn nicht oft?«
»Das gehört, glaube ich, zu unserer Beziehung.«
Es sah nicht so aus, als ob sie meine Theorie verstanden hätte. Sie kannte noch nicht den Versuch, für eine Beziehung diese wackligen Krücken zu konstruieren, mit denen man hofft, ohne Bruch über alle Klippen zu kommen, die, wie in einem Horrorfilm, jederzeit aus dem Nichts auftauchen können. Manchmal hätte ich die Dinge gerne einfach und stabil. Ich sagte:
»Bei meiner Schwester wird es dir gefallen. Die Seidleins sind nett. Nicht nur Regula, auch Christopher, ihr Mann. Und Anna und Jonas, die Kinder, natürlich sowieso« – und stellte mir Rosemarie am Herd in der Küchenschürze vor, im Park an der Schaukel im wetterfesten Anorak und barfuß bei der Überschwemmung im Bad. Vermutlich würde sie mit allem klarkommen. Aber vielleicht würde dieses Leben sie langweilen. Immerhin war sie gerade bejubelt worden.
Als würde sie meine Bedenken ahnen, sagte sie: »Und wenn es langweilig wird, bist du ja auch noch da – der Onkel!«
Das Telefon rutschte brummend zwischen den leeren Schüsseln umher. Der Rückruf von Aljoscha.
[29] »Hallo?«
Nein, nur Dennis. Er sei mit den Jungs ins ›Tramps‹ gegangen. Ob wir auch kommen wollten? Am anderen Ende war Radau.
»Okay«, entschied ich. »Wir kommen.«
Lee Ho-Fook riss das Papiertuch mit Beas chirologischem Kunstwerk vom Tisch, noch bevor wir die Treppe hinunter waren.
»Kennst du das ›Tramps‹?«, fragte ich Rosemarie.
»Schon mal gehört«, antwortete sie mit einem Achselzucken, als könne sie sich unmöglich all die Orte merken, die gerade angesagt sind und von ihr besucht werden wollen.
Als wir im ›Tramps‹ ankamen, war es weit nach Mitternacht. Wir schoben uns an Flaschen und Gläsern vorbei, die in den Händen der Menschen buntglitzernde und tropfnasse Trophäen waren. All diese Menschen waren von einem beinahe unbestechlichen Türsteher erwählt worden und mit einem Plastikband ausgezeichnet, das am Handgelenk baumelnd anzeigte, dass sie hier und heute Abend gegen eine beachtliche Menge Geld nach Herzenslust trinken, tanzen, gaffen und sich frei bewegen durften, wenigstens bis zum Bereich der Very Important Persons.
Ich versuchte, bei den Barkeepern vor der dramatisch illuminierten Wand meine banale Bestellung aufzugeben. Aber die Herren mit den gemeißelten Gesichtern reagierten nicht, und sie einfach an der seidenen Krawatte zu zupfen, die sie klug zwischen zwei Knöpfen ins weiße Hemd gesteckt hatten, ging auch nicht. Rosemarie hatte es da besser, ihr flogen von allen Seiten die Blicke zu, Arme schossen in die Höhe [30] und Blitzlichter auf sie nieder, auf Rosemaries Frisur – mein Kunstwerk, diese fizzy-lockige Haarpracht, in rechts und links seitlich abstehenden Pyramiden gebändigt, in das sich jetzt die Brille als abgefahrenes Accessoire wunderbar einfügte.
Sie schrie in mein Ohr: »Meine Freunde halten mich, ehrlich gesagt, für ziemlich crazy, weil ich nach Deutschland gehe. Die glauben, bei euch sind immer noch die Nazis. Stimmt das?«
»Man erkennt sie nicht immer gleich«, schrie ich zurück. »Sie tragen ja keine Uniform mehr.«
An der Art, wie Rosemarie lachte, bemerkte ich, dass sie mich nicht verstanden hatte.
Henry und Jimmy kamen auf der Tanzfläche in Fahrt, und da waren auch Bea und Kitty. Sie winkten, nein, sie tanzten. Rosemarie nickte und wippte und schien die Intervalle zu zählen, in denen der Barkeeper mit dem Lappen über den Tresen wischte. Vielleicht sollten wir auf die Tanzfläche gehen, aber mir passte auch die Nase des Typen hinter der Bar gut, die mit ihrem großen Haken ein fremder Mittelpunkt in einem feinen Gesicht war.