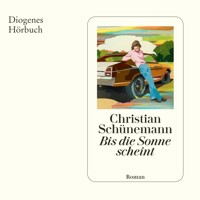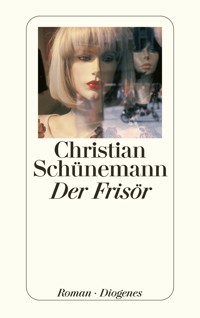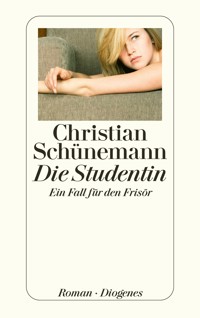10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Milena Lukin
- Sprache: Deutsch
Belgrad – eine europäische Metropole, so nah und doch so fern. Unter der kundigen, atmosphärischen Führung von Milena Lukin erschließt sich nicht nur ein aufsehenerregendes Verbrechen, sondern eine faszinierende Stadt im Brennpunkt europäischer Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Christian Schünemann
Jelena Volić
Kornblumenblau
Ein Fallfür Milena Lukin
Roman
Die Erstausgabe erschien
2013 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto (Ausschnitt):
Copyright © age fotostock/LOOK-foto
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24299 7 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60297 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Der Kriminalfall, der in diesem Roman behandelt wird, beruht auf einer wahren Begebenheit: Am 5.Oktober 2004 kamen in einer Belgrader Kaserne zwei Soldaten unter mysteriösen Umständen ums Leben. Nach offizieller Darstellung der Armee soll einer der beiden Soldaten aus unbekannten Gründen zuerst seinen Kameraden und dann sich selbst getötet haben. Eine unabhängige Expertenkommission kam allerdings zu dem Schluss, beide seien von einem Dritten aus nächster Nähe erschossen worden.
[7] 1
Wo die Brennnesseln aus den Steinen wuchsen, lehnten die Kartoffelsäcke – unförmige Gesellen in schlechter Haltung, faul darauf aus, von Samir achtzehn enge Stufen hinunter in die Küche geschleppt zu werden. Dass Größe und Ausmaß dieser Säcke in keinem Verhältnis zu seinem Fliegengewicht standen und er wie ein verdammtes Eichhörnchen aussah, wenn er sie buckelte, interessierte hier niemanden. Hier interessierte, dass die Kartoffeln am Ende seiner Schicht geschält und gekocht waren und der Truppe um Punkt zwölf Uhr als eine von zwei Beilagen auf die Teller geklatscht werden konnten.
Es war noch früh. Samir zündete sich eine Zigarette an und huschte über den Kasernenhof. Jeder Mensch in Serbien, der einen Funken Nationalstolz in sich trug, würde sich diesen Platz wohl kaum als eine solche Brache vorstellen, mit Resten von Kopfsteinpflaster und tiefen Dellen, in denen sich bei schlechtem Wetter das Regenwasser sammelte. Wann das allerdings jemals wieder passieren würde, wusste der Himmel. Noch summten Schmeißfliegen in Basslage, und Amseln und Drosseln trillerten munter durcheinander, aber die Sonne war schon dabei, Kraft zu sammeln, um alles niederzusengen und auch diesen Ort, mitten im Belgrader Stadtwald Topčider, in den heißen Backofen [8] zu verwandeln, aus dem es seit Tagen kein Entkommen gab.
Der sandige Weg verband das Haupthaus mit dem Schulungsgebäude und dem Offizierscasino. Dahinter begann die Wiese, die hinter den Bäumen steil abwärtsführte. Strenggenommen hatte er dort, jenseits des Weges, nichts zu suchen. Wie seine Kollegen könnte er unten im bemoosten, dunklen Winkel der steinernen Treppe niederkauern und rauchen oder auch hier oben im Schatten der Mauer. Doch bisher hatte niemand etwas von seinen Ausflügen auf die andere Seite des Weges bemerkt oder sich daran gestört.
Mit der Schuhspitze bohrte er die Kippe in den Sand. Wie ein Teppich breitete sich der Frühnebel über die Wiese, und Tau benetzte bei jedem Schritt den Stoff seiner Schuhe. Im Vorbeigehen ließ er seine Hand über die Baumstämme streifen, über knorrige Rinde, auf der die Ameisen ihren Weg suchten. Es roch nach Harz. Er schob Zweige zur Seite, stolperte über Wurzeln, strauchelte, rutschte hangabwärts, bekam Sand in die Schuhe, klammerte sich an Grasbüschel, um nicht zu stürzen – dann war er da. Die Natur hatte ihm hier eine kleine Terrasse geschaffen und mit einem Grasbüschel als Hocker bequem eingerichtet.
Er liebte diese Aussicht, den Blick auf die Save, die sich unterhalb von Zaun und Stacheldraht silbrig durch die Landschaft schlängelte. Das Panorama entschädigte für die ganze Qual: Die gebellten Befehle vom Küchenchef, die schlechte Laune und das Gezänk der älteren Kollegen, den Dunst und Gestank nach Rosenkohl und Zwiebeln, die in den verbeulten Töpfen und Pfannen zu dem immer gleichen Brei schmorten. Doch in diesem Moment war egal, dass sein [9] Kreuz von der Schinderei schmerzte, die Jacke steif war von Schmutz und altem Fett und die Familie weit weg.
Er lehnte sich zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und streckte die Beine aus. Eigentlich durfte er sich überhaupt nicht beschweren. Sein Bruder war arbeitsloser Anstreicher und schleppte den Leuten in Novi Sad die Kohlen für den Winter, seine Mutter putzte Klos auf einer ungarischen Autobahnraststätte. Und seit seine Schwester gesagt hatte, dass sie rüber wollte nach Österreich, in ein irgendwie besseres Leben, hatte niemand mehr etwas von ihr gehört. Er machte sich Sorgen. In Dragaš, dem Dorf im südwestlichen Kosovo, an der Grenze zu Albanien, waren nur noch die Großeltern und die Ziegen, und ob die Familie dort jemals – und sei es auf dem Friedhof – wieder zusammenkommen würde, stand in den Sternen.
Samir rupfte einen Halm aus der Erde und wickelte ihn sich um den Finger. Man konnte es auch so sehen: Er hatte geschafft, was in der Familie keiner vor ihm geschafft hatte: Mit zwanzig Lebensjahren war er in Besitz einer Arbeit, einer Sozialversicherung und einer Kochuniform. Und er war nicht dafür zuständig, dass irgendwelche Leute irgendetwas zu fressen bekamen. Er sorgte in der serbischen Eliteeinheit für das leibliche Wohl der Ehrengardisten. In Samirs Familie erzählte man sich, dass er schon jetzt mehr erreicht hatte, als man es sich in seinem Leben erträumen konnte. Dankbar musste er sein. Da konnte er niemandem mit seinem wahren Traum kommen.
Den Traum hatte er Tag für Tag vor Augen. Es war ein unmöglicher, ein vermessener Traum. Er wünschte sich nichts mehr, als einmal die kniehohen Stiefel zu tragen, die [10] schwarzen Hosen mit dem roten Streifen an der Naht, die Tresse an der Brust und das serbische Wappen am Ärmel. Er träumte von einer Jacke, die so blau war wie die Kornblumen in den Feldern seiner Heimat und so leuchtend wie der Himmel über der Donau, wenn ihn keine Wolke trübt. Samir träumte davon, selbst einmal die Uniform eines Gardisten der serbischen Eliteeinheit anzuziehen.
Er stand auf und klopfte sich die Hose ab. Die Säcke warteten. Doch einen kleinen Aufschub gestattete er sich noch. Nur noch den kleinen Pfad am Hang entlangwandern und sich dann quer durch die Büsche schlagen, zurück in die Kasernenküche.
Er war ein Vollidiot und sollte endlich aufhören, sich diesen Schwachsinn einzubilden. Um im Ehrenbataillon zu dienen, fehlten ihm nicht nur die serbische Herkunft, Ausbildung und die nützlichen Beziehungen, sondern mindestens fünfzehn Zentimeter Körpergröße. Näher als bis in die Kasernenküche der serbischen Eliteeinheit würde er seinem Traum niemals kommen, und sollte es jemals passieren, dass der Chef ihn nicht nur alle Jubeljahre, sondern vielleicht einmal regelmäßig für die Essensausgabe einteilte, wäre er der glücklichste Mensch unter der Sonne. Jeden Tag könnte er seine Idole aus nächster Nähe betrachten. Dieses Privileg wäre ein Geschenk.
Samir sah das Hindernis erst, als er darüberstolperte. Es war etwas Festes, auf das er fasste, als er sich abstützte. Stoff, so blau wie Kornblumen, getrübt von einem Fleck, der sich braun in das Gewebe hineingefressen hatte und in der Brust zerfetzt war. Samir war dem Gardisten so nahe, dass er im Gewimmel von schillernden Fliegen und Käfern die toten Augen sah.
[11] Der Schrei von Samir gellte durch das Gelände, hoch zur Kaserne und runter zum Fluss. Keuchend rappelte er sich auf. Er rannte und stürzte wieder.
Der zweite Körper lag mit verdrehten Beinen im Gras, in der Stirn ein schwarzes, rundes Loch.
[12] 2
Milena Lukin hätte das Telefon in ihrer Handtasche gehört, wenn Vera nicht die Strickjacke aus leichter Merinowolle daraufgelegt hätte. Telefon, Handtasche, Mutter und Strickjacke befanden sich auf der Rückbank des Lada Niva, den Milena so zügig wie möglich durch den Belgrader Feierabendverkehr zu lenken versuchte. Von zügig konnte jedoch keine Rede sein. Busse, Autos und Lastwagen reihten sich stadtauswärts Stoßstange an Stoßstange. Wenn sich der Stau nicht wie durch ein Wunder hinter der Brankov-Brücke, diesem Nadelöhr, auflösen würde, schafften sie es nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen. Die Maschine aus Hamburg sollte in dreißig Minuten landen.
»Vielleicht hätte ich ihm doch lieber ein Gulasch machen sollen.« Veras Stimme klang bekümmert. »Mit grünem Pfeffer und Stampfkartoffeln.«
Milena schaute in den Rückspiegel, blinkte und wechselte die Spur.
»Wenn du wenigstens, wie versprochen, den kräftigen Pecorino gebracht hättest«, sagte Vera. »Stattdessen kommst du mit diesem Zeug aus Ungarn.«
»Es tut mir leid! Wie oft soll ich es noch sagen?« Milena seufzte. Hätte sie doch bloß den Umweg über den großen Supermarkt gemacht. Aber nach der Krisensitzung im [13] Institut war sie spät dran gewesen und hatte den Reibekäse einfach rasch im Lädchen gegenüber besorgt, ohne darüber nachzudenken, dass natürlich die Qualität von Käse aus der Tüte in einem Missverhältnis zu den phantastischen Eierbandnudeln stand, mit deren Fabrikation Vera seit dem gestrigen Nachmittag beschäftigt war. Erstaunlich, welche Energie diese alte Dame entwickeln konnte, wenn es darum ging, dem einzigen Mann in der Familie eines seiner Lieblingsessen zuzubereiten. Stundenlang knetete sie Mehl und Eier mit warmem Wasser und einer Prise Salz, schnitt den dünn ausgerollten Teig in gleichmäßige Streifen und legte sie fein säuberlich nebeneinander zum Trocknen auf ein gestärktes weißes Tischtuch. Was für eine Aktion!
Die Brankov-Brücke lag endlich hinter ihnen, aber richtig vorwärts ging es immer noch nicht. Träge schoben sich die Blechkarossen aneinander vorbei, ohne dass sich irgendjemand einen nennenswerten Vorsprung erkämpfte. Es gab kein Schild, das auf diese kleine Ausfahrt hinwies, aber Milena kannte den Weg. Er war die letzte Möglichkeit.
Der Schleichweg führte an Strommasten entlang. Milena hielt das Lenkrad mit beiden Händen fest, ohne den Fuß vom Gas zu nehmen. Der Lada war zwar relativ neu und stabil und erinnerte mit seiner Kastenform und den etwas hochgestellten Rädern sogar an einen kleinen Geländewagen. Leider gehörte eine Federung für die Rückbank nicht zur Grundausstattung. Auf und nieder hüpfte die alte Dame dahinten mit den Ohrringen, die sie nur für besondere Anlässe trug, und versuchte tapfer, mit ihren schmalen Schultern den Zickzackkurs auszubalancieren, den Milena fuhr, um den größten Löchern auszuweichen. Vera beklagte sich [14] nicht. Im Gegenteil: Die Aufholjagd war ganz in ihrem Sinne.
Der Motor lief noch, da stieß Vera schon die Tür auf und eilte mit der Strickjacke im Arm in die Ankunftshalle. In wenigen Sekunden war ihr grauschwarzer Krauskopf in der Menge verschwunden. Milena griff nach hinten und angelte ihre Handtasche vom Rücksitz. Das Display ihres Telefons zeigte an: drei Anrufe in Abwesenheit.
Der Taxifahrer, der direkt neben ihr hielt, schimpfte durch sein heruntergelassenes Seitenfenster, sagte etwas von – gutwillig übersetzt – »Tomaten auf den Augen« und »Stroh im Kopf« und zeigte ihr den Vogel.
»Reg dich nicht auf!« Milena stieg aus, drehte dem Blödmann – serbischer Macho – den Rücken zu und lächelte. Adam kam durch die Schiebetür, eingepackt in die warme Strickjacke, und gestikulierte wild, während Vera seinen Rollkoffer zog. Mein Gott, der Junge ging seiner Großmutter ja schon bis zur Schulter!
Milena winkte, und Adam rannte los. Sie breitete die Arme aus, fing ihren Liebling, drückte ihn an sich, küsste ihn und strubbelte seine Haare, die ihm in hübschen Wellen tief in die Stirn und weit über den Nacken fielen. Drei Wochen hatten sie und Vera ohne ihren Sohn und Enkel zubringen müssen, hatten wie zwei Eulen in der Wohnung gehockt und gewartet – immer auf den nächsten Anruf. Hatten gierig alle Informationen aufgepickt, die er ihnen aus der Ferne hinwarf, aufgeregt jedes Körnchen sortiert, gewendet und so lange durchgekaut, bis auch der letzte Gehalt daraus gezogen war. Diese Hungerzeiten waren nun vorbei. Die Familie war wieder komplett und vereint, und Milenas Telefon klingelte.
[15] Herrgott, sie sollte sich das Ding einfach um den Hals hängen.
»Wie geht es Fiona?«, rief Adam. »Hat sie mich vermisst?« Seine hohe Stimme übertönte das Dröhnen des Busses, der sie im Vorbeifahren in eine Dieselwolke hüllte.
Milena wühlte. »Fiona geht es gut, sie vermisst dich schrecklich. Wir alle haben dich schrecklich vermisst.«
»Ist mein Basketball noch da?«
»Hallo?« Milena presste das Telefon an ein Ohr, den Finger an das andere.
»Wo steckst du?« Siniša Stojković, der Anwalt. »Ich muss dich sprechen.«
Milena ging ein paar Schritte und stellte sich hinter eine Säule, als ob es an diesem Platz leiser wäre. Zwei Frauen mit riesigen Sonnenbrillen schoben lachend einen Gepäckwagen knapp an Milenas Hacken vorbei. »Was ist denn los?«, fragte sie in den Hörer.
»Nicht am Telefon. Die Angelegenheit ist etwas…«
»Hallo?«
»Sie ist etwas heikel.« Siniša, am anderen Ende, schrie jetzt. »Wann können wir uns sehen?«
»Siniša, all deine Angelegenheiten sind heikel, und meine Zeit ist knapp. Adam ist gerade aus den Sommerferien zurück, und, stell dir vor, ich muss mich um andere heikle Dinge kümmern, zum Beispiel meine Vertragsverlängerung.«
»Herzchen, nie hast du Zeit! Aber es ist wirklich dringend.«
»Gib mir ein Stichwort.«
»Topčider. Die beiden Gardisten. Du erinnerst dich?«
»Was hast du mit der Sache zu tun?«
[16] »Morgen, vierzehn Uhr. Café ›Kleiner Prinz‹.«
Milena stopfte das Überbrückungskabel hinter den Karton mit Aktenordnern und verstaute den kleinen Koffer zwischen dem Sack Katzensand und einer Kiste Äpfel.
Sie waren noch nicht auf der Autobahn, da wurde Adam hinten auf der Rückbank von seiner Großmutter einem ersten Verhör unterzogen. Milena kannte den Fragenkatalog ihrer Mutter auswendig, noch aus der Zeit, als sie selbst klein gewesen war: Hast du gegessen? Wie ist deine Verdauung? Sind deine Ohren geputzt? War dir kalt? Hatte dein Vater eine warme Decke für dich? – all die Voraussetzungen, die für Vera erfüllt sein mussten, damit ein Menschenleben – auch in den Ferien – in Glück und Zufriedenheit gedeihen konnte.
Während Adam Rede und Antwort stand, tauchte auf der anderen Seite der Save die Festung Kalemegdan auf, der Hügel am nördlichen Ende der Altstadt, der in Stufen von hohen Mauern durchschnitten wurde. Türken und andere Völker hatten die Festung über viele Jahrhunderte errichtet, wechselnde Machthaber sie verteidigt und mit Burgen, Brunnen und Kirchen ausgebaut. Auf einem Plateau ragte der Siegesbote empor, der am ausgestreckten Arm die Friedenstaube trug und die Stelle markierte, wo Donau und Save zusammenfließen. Nicht nur Touristen, auch die Belgrader liebten diesen Ort, wo alte Männer an Tischen Schach spielten, Frauen auf den Bänken schwatzend mit Thermoskannen hantierten und Kinder unter den alten Bäumen Fangen spielten. Vera erzählte immer, Milena hätte auf Kalemegdan das Laufen gelernt, aber das erinnerte sie so auch von Adam. Dabei hatte der Junge seine ersten Schritte definitiv in der Wilmersdorfer Straße in Berlin gemacht.
[17] Ein Lastwagen schob sich an Milenas Seitenfenster vorbei, und die Festung verschwand. Über die Brankov-Brücke, eingeklemmt zwischen zwei Bussen, fuhren sie in die Altstadt hinein. Belgrad heißt auf Serbisch »die weiße Stadt«. Milena kannte hier jede Straße und jedes Haus – jedenfalls kam es ihr so vor. In den alten Büchern mit Fotos aus früheren Zeiten war freilich etwas anderes zu sehen als dieser graue, mit Reklametafeln gespickte Steinhaufen. Was Serben, Türken und Habsburger über Jahrhunderte gestaltet und gebaut hatten, wurde durch die deutschen Bombenangriffe am sechsten April 1941 weitgehend vernichtet und die Zerstörung durch die Alliierten in den ersten Monaten des Jahres 1944 vollendet. Übriggeblieben waren vereinzelte stuck- und säulenverzierte Prachtbauten aus den vergangenen Jahrhunderten, für die Nachwelt gehegt und gepflegt und umgeben von symmetrischen Blumenrabatten, zierlichen Parkbänken und vornehm plätschernden Springbrunnen. Die schönen alten Kästen waren vorzugsweise den gewählten Vertretern des serbischen Volkes und Dienern der staatlichen Bürokratie vorbehalten – oder zahlungskräftigen Hotelgästen aus dem Ausland.
Milena musste sich für eine der Adern entscheiden, die den Verkehr durch die Stadt pumpten, blinkte und ordnete sich ein. Die Fahrt ging an alten Gemäuern vorbei, über denen die Abrissbirne baumelte, ohne dass sich jemand entscheiden mochte, ihr Schicksal endgültig zu besiegeln. In der Gründer- und Sezessionszeit hatten sie den Wohlstand ihrer Besitzer widergespiegelt, die zwischen Orient und Okzident schwunghaften Handel trieben. Heute gähnte in diesen Häusern die Leere, und wenn doch jemand untergeschlüpft [18] war, dann waren es kleine Institutionen, bedauernswerte Angestellte, Musiklehrer, die im Winter mit dicken Strickjacken der Zugluft und der Feuchtigkeit trotzten, während ihre Schüler mit klammen Fingern die Instrumente bedienten. Nach außen boten diese Fassaden genügend Fläche, um in der Sockelzone von Hunden und Besoffenen bepinkelt und von Underground-Künstlern bemalt zu werden.
Die Lücken zwischen diesen Pracht- und Problembauten wurden in den vergangenen Jahrzehnten mit dem gestopft, was der Bedarf erforderte und der Zeitgeschmack hervorbrachte: gestapelte Wand- und Fensterelemente, die mit schmutzigen Farben und schematischen Mustern für kurze Zeit dieselbe Modernität und Fortschrittlichkeit vorgaukelten wie die neuesten gestuften und schräggestellten Wunder aus Spiegelglas und vorgehängten Granitplatten. Meistens tauchte gleich daneben oder schräg gegenüber eines dieser kleinen Häuschen mit den blinden Fenstern auf. Wie vergessenes Unkraut standen sie im Schatten, gaben sich mit schiefen Wänden und niedrigen Dächern zufrieden und erinnerten an eine Zeit, als es noch Platz gab für einen Hof, für Hühner und Kaninchenställe. Dabei waren diese Häuschen mit den kleinen Räumen an exponierter Stelle doch der heimliche Luxus dieser Stadt.
Milena achtete auf den Verkehr, die schwachköpfigen Autofahrer, die sprunghaft, ohne zu blinken, die Spur wechselten, sich vor ihren Kühler setzten und Vollbremsungen machten. Sie musste in der Ablage nach Adams Lieblingsmusik und Kaugummis kramen und an das Telefonat denken: Was hatte Siniša mit den Gardisten in Topčider zu tun? Das war doch Wochen her.
[19] »Mama«, rief Adam, »weißt du schon das Neueste? Papa hat eine neue Freundin. Und ihr Busen ist so!«
»Das freut mich«, sagte Milena und schaltete für den Autotunnel die Scheinwerfer ein. »Das freut mich wirklich außerordentlich.«
Als sie sich ihrem Wohnblock näherten, drosselte sie die Geschwindigkeit, bis sie nur noch Schritttempo fuhr. Sie hatte Glück, jemand parkte aus. Milena setzte den Blinker.
»Da passt du nicht rein«, sagte Vera von hinten.
Adam reckte den Hals.
Milena ließ die grüne Straßenbahn passieren, die rasselnd an ihnen vorbeizog, setzte zurück, schlug das Lenkrad ein, kurbelte, spielte mit Gas, Kupplung und Bremse. Mit einem Rad musste sie hoch auf den Gehweg, den die Müllmänner – völlig dämlich – mit den Tonnen blockiert hatten, während auf der anderen Seite ein Baum mit seinem schiefen Stamm im Weg stand.
»Millimeterarbeit«, sagte Adam.
Milena zog die Handbremse hoch. »Macht die Fenster zu, und passt mit den Türen auf.«
Um diese Zeit, kurz nach Feierabend, teilten die Autofahrer die Straße in vier bis fünf Spuren unter sich auf, ohne dass Markierungen auf der Fahrbahn ihnen dabei Vorgaben machten. Wie die Hasen liefen Milena, Vera und Adam auf die andere Straßenseite, wobei sie ihrem Sohn zuschrie, sonst ja immer den kleinen Umweg über die Ampel zu machen. Er sagte: »Ja, Mama, ich bin doch nicht blöd«, nahm ihr den Schlüssel aus der Hand und lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht gegen den Metallrahmen und das Sicherheitsglas.
[20] Sie holte im gläsernen Windfang die Post aus einem der vielen Briefkästen, und Adam erzählte von dem Ausflug mit seinem Vater auf den Hamburger Michel und in den Tierpark Hagenbeck. Seine Begeisterung über die Kräne des Hafens, die bis zum Horizont reichten, und die Stachelschweinbabys, die noch keine Stacheln ausgebildet hatten, hallte durch das hohe Treppenhaus.
Zu dritt quetschten sie sich mit Koffer und Äpfeln in den Fahrstuhl, der, wie immer, ein paar Zentimeter absackte, als würde die Kabine auf Watte stehen. Adam drückte auf die Taste, von der die Zahl fünf im Laufe der Jahrzehnte spurlos verschwunden war, und kündigte an: »Wenn ich groß bin, werde ich Tierpfleger.«
»Wasch dir die Hände«, sagte Milena, kaum dass sie das Letzte von drei Schlössern an der Wohnungstür aufgesperrt hatte. »Und bring den Koffer in dein Zimmer.«
Fiona erwartete Adam auf Augenhöhe. Wie gemalt saß die Katze zwischen Strohhut, Postkarten und einem Trockenstrauß, mit denen Milena die Kommode dekoriert hatte. Der Junge nahm seinen Liebling auf den Arm, drückte seine Nase in das lange, flauschige Fell und flüsterte Fiona mit verstellter Stimme Zärtlichkeiten ins Ohr. Milena war nicht gut auf das Tier zu sprechen. Die halbe Nacht hatte es herumgemaunzt und über die verschlossene Tür zum Wohnzimmer geklagt. Dort lagen die frischen Teigbahnen zum Trocknen über dem Sofa. In dieser Wohnung war die Couch der einzige Ort, wo es möglich war, die Eierbandnudeln in ganzer Länge und ordentlichen Reihen über ein gestärktes Tischtuch zu breiten. Jeder Winkel war mit Regalen, Hänge- und Schiebeschränken ausgenutzt und seit dem Einzug von [21] Fiona vor einem Jahr nun auch die letzte freie Ecke im Flur mit dem Kratzbaum und der halbe Quadratmeter unter dem Waschbecken mit dem Katzenklo belegt. Und als ob das nicht reichte, wurde in dieser Familie alles getan, um das hübsche und anhängliche Tier zu einem möglichst tyrannischen Wesen zu erziehen: Vera bereitete der Katze mit Hähnchenbrustfilets und Kalbsleber abwechslungsreiche Menüs, Milena wurde ans andere Ende der Stadt geschickt, um den duftenden italienischen Piniensand zu besorgen. Adam schleppte Fiona auf dem Arm oder der Schulter umher und ließ sie in seinem Bett schlafen. Wie sollte ein so verwöhntes Tier verstehen, warum nachts plötzlich wegen Nudeln die Wohnzimmertür verschlossen gehalten wurde?
Die Äpfel aus Onkel Miodrags Garten, die Vera demnächst zu Apfelstrudel verarbeiten würde, kamen zur Gemüsekiste auf den Balkon. Wenn der Sack Kartoffeln irgendwann unter den Gartenstuhl passen würde, hätte auch die Wäschespinne wieder Platz. Eine Vorratskammer wäre ein Traum. Oder ein Esszimmer mit Platz für einen großen Tisch. Ebenso eine sanftmütige Mutter und ein Sohn, der sich nicht immer taub stellte, wenn es ihm gerade in den Kram passte.
»Was tust du da?«, rief Vera aus dem Badezimmer. »Junge, steh auf! Ein Serbe steht, oder er ist kein richtiger Serbe. Willst du das? Willst du kein Serbe sein?«
Adams helle Stimme: »Papa hat gesagt, es gehört sich nicht!«
Vera kam in die Küche und schüttelte besorgt den Kopf. »Immer diese Marotten, wenn er aus Deutschland zurückkommt. Was sollen seine Kameraden in der Schule von ihm [22] denken, wenn sie mitbekommen, dass er jetzt im Sitzen pinkelt?« Sie rückte den Topf auf den Herd.
Bei der Sauce hatte Milena insgeheim auf Mohn und Rosinen gehofft, die Vera mit einer Stange Vanille in Milch zu kochen pflegte. Doch für diese Variante hätten im Vorfeld gemahlene Walnüsse in den Nudelteig gehört. Vera hatte sich für eine klassische Tomatensauce entschieden, mit der sie bei Adam zudem auf der sicheren Seite war, hatte die besonders saftigen Apfeltomaten aus Südserbien blanchiert, gedünstet, mit etwas Zucker abgeschmeckt und ganz zum Schluss doch noch etwas von dem Basilikum hineingeschnitten, jedoch so fein, dass das Gewürz hoffentlich nicht zu erkennen war. Adam verabscheute alles Grüne. Der Trick funktionierte: Er verputzte zwei große Portionen. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits gebadet, seine Nase ausgepustet, die Ohren geputzt und Arme und Beine wegen einer leichten Neurodermitis mit der Pavlović-Salbe eingecremt, wie sie seit Jahr und Tag nur von dem Apotheker Pavlović in der Zmaj-Jova-Straße hergestellt wird.
Während Adam sich im Pyjama vor dem Badezimmerspiegel die Zähne putzte, stellte Vera geräuschvoll die Teller in die Spüle: »Hast du es gesehen?«
»Was?«, fragte Milena.
»Das Buch. Auf so eine Idee kann nur sein Vater kommen.«
»Welches Buch?«
»Wenn du mich fragst, hat solch eine Lektüre keinen guten Einfluss auf den Jungen.«
»Enzyklopädie der schlechten Schüler«, las Milena auf dem Einband und blätterte. Die schlechten Schüler waren [23] große Männer wie Napoleon, Leonardo da Vinci, Winston Churchill – für Adam mit seiner Rechtschreibschwäche wahrscheinlich eine sehr beruhigende Entdeckung.
Sie schob das Buch zurück unters Kopfkissen, wo Adam, wie immer, auch seine schmale silberne Taschenlampe versteckt hielt.
Ein Pantoffel krachte gegen den Heizungskörper, der andere landete auf dem kleinen Koffer. Adam sprang ins Bett. Milena stopfte ihm das Federbett zurecht. »Freust du dich, wieder zu Hause zu sein?«
Er nickte.
»Papa und du – ihr habt euch gut verstanden, oder?«
»Sehr gut.«
»Und die Freundin von Papa« – sie strich die Decke glatt –, »ist sie nett?«
»Sie heißt Jutta. Wir haben sie zum Segeln mitgenommen. Sie hat gefragt, ob sie darf, und wir haben es erlaubt.«
»Du warst mit Papa segeln?«
»Wir sind in der Außenalster los, dann in die Binnenalster und wieder zurück. Aber beim nächsten Mal wollen wir durch Kanäle und dann vielleicht raus auf die Elbe. Soll ich es dir auf der Karte zeigen?«
»Es ist in Ordnung«, sagte Milena, aber gar nichts war in Ordnung. Ein Irrsinn war es. Ihr Junge in dieser Nussschale, mitten auf der riesigen Außenalster zwischen all den Ausflugsdampfern und Wassertaxen. Natürlich konnte Adam schwimmen, aber er war doch gar nicht in Übung! Wie konnte Philip so etwas tun, ohne sie vorher zu fragen? Sie war doch die Einzige, die einschätzen konnte, für welche Expedition Adam gewappnet war. Und dieser Segelturn war [24] eindeutig zu waghalsig. Philip Bruns! Da war mal wieder ein Anruf fällig.
»Wenn die Außenalster zufriert, gehen wir Schlittschuhlaufen. Und Jutta will mich in die Kletterhalle mitnehmen!«
»Darüber reden wir noch.«
»Bitte, Mama, darf ich in den Herbstferien wieder nach Hamburg?«
»Das müssen wir in Ruhe mit Papa besprechen.«
»Er hat gesagt, wir müssen nur dich fragen.«
Sie setzte ein Lächeln auf, dabei war ihr zum Heulen zumute. Segeln, Schlittschuhlaufen, Klettern – das alles war eine Welt, die sie ihm nicht bieten konnte, und so aufregend, dass seine Augen glänzten und ihm tausend Sachen kreuz und quer durch den Kopf schossen. Schlaf war das Letzte, woran jetzt zu denken war. Als ob das ernsthaft ihre Sorge wäre. Sie war eifersüchtig, und zwar durch und durch.
Milena strich ihrem Sohn über das weiche Haar. »Du magst Jutta, oder?«
»Sehr!«
»Ist sie hübsch?«
Adam überlegte und wägte seine Worte ab. »Sie sieht ganz anders aus als du. Ihre Haare sind…«
»Blond?«
»Ja.«
»Und ihre Augen? Blau?«
»Ja.«
Diese Jutta war also urdeutsch, höchst sportlich, pumperlgesund und so ziemlich das genaue Gegenteil von ihr. Da konnte sie Philip ja bei nächster Gelegenheit von Herzen gratulieren. Milena küsste ihren Sohn. »Schlaf jetzt.«
[25] »Weißt du, Mama…«
»Ja?«
»Ich bin froh, dass Papa jetzt nicht mehr alleine ist. Du hast es ja so viel besser als er.«
»Wieso?«
»Du hast mich.«
»Da hast du recht. Und jetzt mach die Augen zu.«
»Mama?«
»Ja?«
»Versprichst du mir etwas?«
»Was?«
»Dass du aufhörst mit dem Rauchen.«
»Ich will es versuchen. Ja. Versprochen. Träum süß.«
Sie ließ die Tür angelehnt, damit Fiona zu ihm ins Bett springen konnte, wann immer sie wollte.
Den Tee bereitete sie aus frischem Ingwer und Minzeblättern, gab drei Tropfen Zitrone hinzu, bedeckte das Henkelglas mit einer Untertasse und stellte es mit einer Serviette in Veras Reichweite auf dem Wohnzimmertisch ab.
»Danke, mein Kind.« Die Mutter starrte auf die Mattscheibe, gebannt von einem Orchester schluchzender Geigen und einer Liebesgeschichte, die dabei war, sich dramatisch zuzuspitzen.
Milena bückte sich, um den Teppich auf dem glatten Parkett geradezuziehen. Da war wieder dieses Ziehen im Rücken. So war es eben, wenn man bald fünfzig wurde! Vielleicht sollte sie doch endlich auch ein wenig Sport treiben. »Guten Morgen, Belgrad« hieß die Aktion, bei der allen Bürgern für zwei Stunden gratis das Stadtbad geöffnet wurde. Das würde allerdings bedeuten, noch früher aufzustehen. Wann [26] war sie überhaupt das letzte Mal richtig geschwommen? Das Plantschen im Istrienurlaub zählte nicht.
Mit einer Kanne Kaffee verzog Milena sich auf ihr Zimmer und startete den Computer. Während das System die Programme lud, öffnete sie ihren Kleiderschrank. Der Badeanzug lag ganz unten und war noch aus der Zeit mit Philip, also antik. Sie zog das Teil hervor und hielt es an ihren Körper. Es spannte von Hüfte zu Hüfte, und die kreisrunden Tupfen verzerrten sich zu einem grotesken Muster. Ein breites Becken hatte sie ja schon immer gehabt, aber dieses Ding würde beim besten Willen nicht mehr passen. Sie warf es zurück in den Schrank.
In diesem Moment kam sie dem Spiegel an der Innenseite der Schranktür ganz nah. Sie sah die Falten um ihren großen Mund und die Ringe unter den geröteten Augen. Aber der Tag war auch anstrengend gewesen und das Licht hier ungünstig. Ihre vollen dunklen Haare glänzten ungewöhnlich schön, selbst wenn sie nicht besonders gut zurechtgemacht waren. Die Zeit reichte morgens meistens nur für den Lippenstift, ein warmes Umbra, das gut zu ihren Augen passte. Auch bei ihrer Kleidung achtete sie auf die gedeckten, warmen Töne, etwa bei dem cremefarbenen Twinset und dem braunen Cashmerepulli, der wohl am ehesten dem Stil einer intellektuellen Frau ihres Alters entsprach. Andererseits liebte sie roten Lippenstift, die azurblaue Bluse und ihre letzte Anschaffung, den grasgrünen, knielangen Mantel, den ihre beste Freundin Tanja kopfschüttelnd als »Ausreißer« bezeichnet hatte. Aber für Milena waren Farben ein Ausdruck von Lebensfreude. Sie machte den Kleiderschrank wieder zu. Im Moment hätte sie sich am liebsten in ein schwarzes Cape gehüllt.
[27] Sie zündete sich einen Zigarillo an, pustete den Rauch in den Raum und starrte auf den Bildschirmschoner, eine grüne, mit Dokumenten übersäte Landschaft. Obwohl die Trennung zehn Jahre her war – die Jahre entsprachen dem Alter ihres Sohnes –, machte es sie immer noch rasend zu hören, dass Philip so gar nicht unglücklich war. Und dass im Leben ihres Exmannes weiterhin andere Frauen eine Rolle spielten. Wie hatte sie diesen Mann geliebt! Als sie ihm zum ersten Mal begegnet war, hatte sie die Arme verschränken müssen, um ihn nicht sofort zu berühren. Philip mit den vollen Lippen und den Schatten unter den Augen, der Bauch war erst später dazugekommen. Dass er sich von ihr zurückzog, hatte sie anfangs gar nicht bemerkt. Und trotzdem war es passiert, damals, als der Krieg in Jugoslawien ausbrach. Als Flüchtlinge in Strömen, in Kontingente eingeteilt, nach Deutschland kamen und Freunde und Verwandte auch bei ihnen in Berlin unter dem Dach Unterschlupf fanden. Bis tief in die Nacht wurde geweint und in einer Sprache diskutiert, die Philip nicht verstand und die ihn ausschloss. Milena hatte das Problem unterschätzt, das damals auch gar keines sein konnte, verglichen mit dem, was diese obdach- und heimatlos gewordenen Menschen auszuhalten hatten. Es war selbstverständlich gewesen, dass sie sein Arbeitszimmer bewohnten, bis tief in die Nacht seinen Computer benutzten und morgens aus seiner Lieblingstasse den Kaffee tranken. Es war eine schwierige, aufregende und traurige Zeit. Als sie feststellte, dass sie schwanger war, dachte Milena, das Glück würde in ihr Leben zurückkehren.
An jenem Abend beichtete er ihr diese Beziehung mit Susanne oder Sabine oder wie dieses Weib hieß. Das [28] Geständnis traf sie unvorbereitet. War sie blind gewesen? Er hatte gerade noch Zeit zu bemerken, dass sie das Festtagsgeschirr und die großen Weingläser gedeckt, Stoffservietten gefaltet und Kerzen angezündet hatte, da stemmte sie schon in ihrer Wut den Tisch in die Höhe und warf ihn gegen die Wand. Sie verließ die Wohnung, ohne von dem Kind erzählt zu haben, das sie erwartete, und ohne die Scherben wegzuräumen. Und zu wissen, wohin sie eigentlich gehen sollte. Das Schlimmste war, dass er sie nicht aufhielt.
Milena drückte den Zigarillo aus und öffnete das Internet. Sie tippte: ›Topčider‹, ›Serbische Eliteeinheit‹, ›Gardisten‹. Sie überlegte. Dann tippte sie noch ein Wort: ›Tot‹.
Unter den ersten Treffern waren verschiedene Artikel der regierungsnahen Zeitung Politika, außerdem ein Bericht der linksgerichteten Zeitschrift Vreme. Den Fall mit den beiden toten Gardisten in Topčider, mit dem Siniša jetzt aus irgendwelchen Gründen zu tun hatte, hatte sie vor ein paar Wochen in der Tagespresse verfolgt, aber die Einzelheiten waren ihr nicht mehr präsent. Milena überflog auch die Schlagzeilen der Boulevardzeitung Kurier. Die beiden Gardisten Nenad J. und Predrag M. waren in den frühen Morgenstunden des zwölften Juli im Stadtwald Topčider auf dem Kasernengelände tot aufgefunden worden. Wie alle Gardisten der serbischen Eliteeinheit waren sie exzellent trainiert, physisch gesund und psychisch stabil, sie waren im Bataillon beliebt und stammten aus geordneten Verhältnissen. In der Nacht zuvor hatte man sie zur Nachtwache abkommandiert – ein Routinedienst, den jeder Gardist absolvieren musste. Die Ermittlungen des Untersuchungsrichters Jovan Dežulović – ein Mitglied des Militärgerichts – ergaben, dass einer der [29] beiden Gardisten den anderen aus nächster Nähe erschoss und anschließend Selbstmord verübte. Die Verwicklung einer dritten Person wurde ausgeschlossen und die Ermittlung mit dem Ergebnis eingestellt, dass die beiden jungen Männer wahrscheinlich dem Ritual einer unbekannten religiösen Sekte zum Opfer gefallen waren.
Milena lehnte sich zurück. Physisch und psychisch gesund. Opfer eines Rituals.
Fiona sprang auf den Schreibtisch, stieg mit weichen Pfoten über den Karteikasten hinweg, streifte mit dem buschigen Schwanz die Duftkerze, drehte sich einmal um die eigene Achse und setzte sich neben die vollgestopften Ablagefächer.
Milena schloss auf dem Bildschirm Fenster für Fenster. »Geh schlafen«, sagte sie. »Worauf wartest du? Adam ist da, seine Tür steht offen.«
Mit grauen, unergründlichen Katzenaugen starrte Fiona sie an. Nicht zum ersten Mal fragte sich Milena, ob dieses Tier einfach nur dumm war oder ob es etwas sah und wusste, das ihr selbst, dem vernunftbegabten Wesen, verborgen blieb.
[30] 3
Das Braun des Umschlags war von derselben Farbe wie der Boden aus Mürbeteig, der das stabile Fundament bildete für die Schichten aus Creme, Marmelade und Sahne. Überzogen war die Konstantinopelschnitte mit einer fingerdicken Schicht dunkler Schokolade. Es brauchte eine gewisse Entschlossenheit, um mit den Zinken der Kuchengabel senkrecht durch die harte Glasur zu stoßen. Milena besaß diese Entschlossenheit. Dabei war das peinliche Erlebnis mit dem Designerstuhl noch gar nicht lange her. Es war in dem neuen In-Treff auf der Terazije-Straße passiert, in das Tanja sie im vergangenen Monat auf einen Aperitif gelotst hatte. Beim Aufstehen war Milena mit ihrem Becken zwischen den verchromten Armlehnen stecken geblieben. Sekundenlang hatte der Stuhl in der Luft geschwebt, als würde er an ihrem Hinterteil festkleben. All die gegelten und gestylten Leute um sie herum hatten es gesehen und gefeixt.
Hier, im Café ›Kleiner Prinz‹, war man mit Kuchen, Torte und Zeitunglesen beschäftigt, und Milenas Holzstuhl besaß keine Armlehnen, nur eine für den Rücken, auf die der Anwalt Siniša Stojković jetzt seine Hand legte, lächelte, wie vielleicht nur Montenegriner lächeln können, und auf eine Weise sagte, dass Milena ihm einfach Glauben schenken wollte: »Milena, du wirst von Mal zu Mal schöner!«
[31] Sie klappte die silbernen Bügel der Brille auseinander, strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und setzte sich das Gestell auf die Nase. »Institut für Ballistik und Schießtechnik, Ludwigshafen«, las sie als Absender auf dem Umschlag. Sie nahm die Brille wieder ab und schaute Siniša an. »Was, bitte, hast du mit diesem Institut zu tun?«
Er winkte dem Kellner, zeigte auf die Cappuccinotassen und streckte zwei Finger in die Höhe. »Ich habe den Fall der beiden toten Gardisten übernommen. Die Eltern von Nenad Jokić und Predrag Mrša sind meine Mandanten, inzwischen kann ich sogar sagen: Freunde. Wir geben keine Ruhe, bis wir nicht aufgeklärt haben, wie die beiden Söhne ums Leben gekommen sind. Die Umstände sind mehr als mysteriös.«
»Mysteriös? Ich habe gelesen, dass sie möglicherweise einer Sekte angehörten. Und dass sie ein Ritual vollzogen haben könnten.«
»Alles Quatsch. Mit Ritualen und religiösem Getue hatten die Jungs nichts am Hut.«
»Und wenn doch?«
Sinišas dunkle Augenbrauen standen in einem merkwürdigen Kontrast zu seinem silberweißen Haar. »Du glaubst diesen Schwachsinn doch wohl nicht?«, fragte er.
»Danke.« Milena lächelte, während der Kellner ihr die Tasse hinstellte und für sie zurechtschob.
»Glaub mir«, sagte Siniša, »das ist die Lüge eines Regimes, in dem das Militär immer noch machen kann, was es will. Es war kein Ritual, es war kein Selbstmord. Hinter dem Tod von Nenad Jokić und Predrag Mrša steckt eine ganz andere Geschichte.«
[32] Der Zucker rieselte aus seinem Tütchen und versank im Milchschaum. Milena rührte. Sie mochte Siniša, und sie bewunderte ihn für seinen Mut und für die Hartnäckigkeit, mit der er damals schon versucht hatte, das Unmögliche möglich zu machen und den kriminellen Sohn des Diktators hinter Schloss und Riegel zu bringen. Beihilfe zum Mord lautete die Anklage, die Siniša – damals noch als Staatsanwalt – erhoben hatte. Kurz darauf musste er seine Robe abgeben und sich seither als Anwalt durchschlagen. Der Diktator war schon lange nicht mehr an der Macht, der Sohn außer Landes, aber Siniša bis heute ein Getriebener, voller Hass auf die verkrusteten Strukturen und die Verbrechergeneräle, die sich weigerten, die serbischen Kriegsverbrechen aus dem Jugoslawienkrieg der neunziger Jahre anzuerkennen. Wenn Milena in ihren wissenschaftlichen Artikeln, ihren publizistischen Kommentaren und als Gast auf Podiumsdiskussionen immer wieder Aufklärung forderte, vor allem bei den Massenerschießungen von Moslems in Bosnien und Albanern im Kosovo, wusste sie, dass Siniša ganz sicher an ihrer Seite war. Was sie nicht an ihm mochte, war sein Tunnelblick.
»Wie dem auch sei.« Er streckte den Arm aus und legte die flache Hand auf den Tisch, als wollte er verhindern, dass Milena ihm ausbüxte. »Nachdem ich den Fall übernommen habe, ist es mir innerhalb kürzester Zeit gelungen, dass eine unabhängige Kommission die Untersuchungen noch einmal aufrollt.«
»Kompliment. Wie hast du das geschafft?«
»Das übliche Katz-und-Maus-Spiel.« Siniša lächelte gequält. »Leider wurde mir der Vorsitz verweigert. Den hat ein [33] Handlanger von diesem Lumpen und Nichtskönner, dem Untersuchungsrichter Dežulović, übernommen.«
»Stopp, warte. Du schaffst es, dass eine unabhängige Kommission ins Leben gerufen wird, bist selbst aber nicht Mitglied in dieser Kommission?«
»So ist es.«
»Dann kann von ›unabhängig‹ doch überhaupt keine Rede sein.«
»Eben.«
»Und jetzt?«
»Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe dafür gesorgt, dass die Autopsieberichte, die Vernehmungsprotokolle, die Fotos von den Leichen und vom Fundort – dass alles, was Dežulović bei seinen Ermittlungen zustande gebracht hat, nach Ludwigshafen geschickt und den Deutschen zur Verfügung gestellt werden musste. Für mich war es ein Fest, für Dežulović eine einzige Demütigung!« Siniša lachte vergnügt.
Milena verstand es nicht. »Wenn an dem Tod der beiden Gardisten tatsächlich etwas faul ist, wird Dežulović doch die Untersuchungsergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit manipuliert haben.«
»Liebling«, Siniša rang die Hände, »was hättest du an meiner Stelle getan? Nichts? Zugeguckt, wie die Gangster machen, was sie wollen? Wenn wir etwas ans Tageslicht bringen wollen, was dieser korrupte Dežulović unter den Teppich gekehrt hat, sehe ich keine andere Möglichkeit, als in deren Dreck zu stochern!«
»Und welchen Dreck haben die Kollegen in Ludwigshafen ans Tageslicht gebracht?«
[34] Siniša seufzte. »Angeblich bestätigen sie die Untersuchungsergebnisse des Militärgerichts. So steht es jedenfalls in der offiziellen serbischen Übersetzung des deutschen Gutachtens.« Siniša beugte sich so weit herüber, dass Milena sein herbes Aftershave roch. »In diesem Umschlag«, sagte er mit gesenkter Stimme, »steckt das deutsche Originalgutachten. Über ein paar Ecken wurde es mir zugespielt. Bitte übersetz es mir. Wort für Wort. Und wenn es in der offiziellen Übersetzung nur die kleinste Abweichung gibt, hänge ich das an die große Glocke, das verspreche ich dir!«
Milena schob auf ihrem Teller Schokosplitter und Kuchenkrümel zusammen. Die große Glocke – sie wusste, was das hieß. Er würde sich vor laufenden Kameras als nimmermüder Kämpfer für das Gute präsentieren, wahrscheinlich mit offenem Mantel und wehendem Seidenschal. Er würde auch nicht zögern, hier und da die Wahrheit ein klein wenig zu verdrehen, genau so, wie es auch seine Gegner taten. Notfalls würde er sogar den Schmerz, die Trauer und Verzweiflung der Opfer für seine Zwecke ausnutzen, wenn es ihm nur gelang, den Feind bloßzustellen. Zu lange kannte Milena ihn schon, als dass sie sich irgendwelche Illusionen machte.
»Vielleicht gibt es auch eine ganz andere Erklärung für den Tod der beiden jungen Männer«, sagte sie.
»Nämlich?«
Milena stand auf.
Siniša lachte. »Du meinst, dass die beiden sich geliebt haben? Dass sie schwul waren?«
»Das wäre eine von vielen Möglichkeiten.«
»Predrag war ein Weiberheld, wie er im Buche steht.«
[35] »Was ist mit dem anderen, Nenad? Vielleicht waren Drogen im Spiel.«
»Nenad wollte eine Pilotenausbildung machen.«
Milena versenkte den Umschlag in ihrer Tasche. »Ich rufe dich an.«
»Wann?«
»Sobald ich mit der Übersetzung fertig bin.«
Er half ihr in den Mantel. »Heute Abend?«
»Ich versuche es.«
*
Ihr Parkplatz hinter dem Institut unter den Birken war wahrscheinlich der schönste Parkplatz von Belgrad – und besetzt.
Verstimmt kurvte sie um den Platz mit dem Denkmal, vorbei am Tankstellenhäuschen mit der einsamen Zapfsäule – nichts, alles dicht. Wenn wenigstens die Leute von ›Tanjug‹, der Nachrichtenagentur in dem riesigen Gebäudekomplex, schon Feierabend hätten. Die Stadt war einfach nicht angelegt für so viele und so große Autos. Zum Glück wurde das Problem nicht überall so gelöst wie am König-Alexander-Boulevard, dem ehemaligen Boulevard der Revolution. Dort hatte man die alten Platanen, die dort zu Hunderten standen, kurzerhand für krank erklärt, mit Motorsägen gefällt und an ihrer Stelle ordentliche Buchten für Parkplätze angelegt. Alle Protest- und Unterschriftenaktionen der empörten Belgrader waren in der städtischen Bürokratie versandet. Vera nannte den Boulevard seither nur noch »Boulevard des Grauens«.
[36] Milena blieb nichts anderes übrig, als schief, also im spitzen Winkel, beim ›Roten Hahn‹ zu parken. Bei schönem Wetter saßen hier Menschen in schicker Kleidung mit ihrem Laptop draußen an der offenen Bar, jetzt fegte der Wind die ersten trockenen Blätter über den Platz, und ein leichter Regen fiel auf die leeren Tische und Stühle. Nur die alte Frau auf ihrem Pappkarton war geblieben. Tag für Tag hockte sie an dieser Ecke und demonstrierte den vorübereilenden Passanten an einer Kartoffel, wie das simple Schälmesser funktionierte, das sie mit ihrer verknöcherten Hand kaum halten konnte. Milena stellte den Motor ab. Ihr Arbeitsplatz war gleich gegenüber. Wenn sie schon falsch parkte, dann wenigstens bequem.
Von dem Gebäude an der Ecke hatte der Regen über Jahre und Jahrzehnte die Farbe heruntergewaschen und für diesen Graubraunton gesorgt, der vielleicht gar nicht so hässlich wäre, wenn nicht überall der Putz in kleinen und größeren Stücken von der Fassade platzen würde. Dazu gehörten die verwitterten Holzrollos, die vor allem im Erdgeschoss schief und verkantet in den Angeln hingen. Das Institut für Kriminalistik und Kriminologie war so baufällig und heruntergekommen, dass es einer Mutprobe gleichkam, hier zum ersten Mal einzutreten. Umso größer war dann die Überraschung.
Über dem Treppenhaus wölbte sich ein Dach aus Milchglas, in dem farbige Elemente ein naives Muster bildeten und tagsüber für hübsche Lichteffekte sorgten. Die Wände waren hell getüncht, die Decken stuckverziert, die Fenster hoch, und bei jedem Schritt knarrte leise das Parkett. Es gab Momente, da fühlte sich Milena hier, in ihrem kleinen Zimmer, [37] dem vorletzten Raum am langen Gang, wie in einem Schloss. Zwar war ihr Schreibtischplatz am Fenster etwas zugig, dafür sah sie auf das graue Denkmal des Freiheitskämpfers Herzog Vuk, der mit dem bemoosten Gewehr in der Hand vorwärtsstürmte und doch nicht vom Fleck kam – ein Blick, auf den der Institutsdirektor in seinem Turmzimmer verzichten musste.
Milena hängte ihren Regenschirm an den Garderobehaken, legte den Kartoffelschäler in die unterste Schreibtischschublade zu all den anderen Kartoffelschälern, die sie bereits gekauft hatte, und zog sich die Strickjacke über. Doch die Kälte kam von unten. Milena ging auf die Knie und kroch unter den Schreibtisch.
Wo war sie heute bloß mit ihren Gedanken? Bevor sie den Heizstrahler anknipste, musste sie Wasser für den dringend benötigten Kaffee aufsetzen. Wenn beide Elektrogeräte gleichzeitig in Betrieb waren, knallte die Sicherung raus.
Die Deutschlandvorwahl und Bonner Nummer wählte sie in letzter Zeit fast täglich. Die Deutsche Akademische Gesellschaft finanzierte zur Hälfte ihre Stelle, aber ob man das auch in Zukunft tun würde, wusste der Himmel. Seit Wochen und Monaten war Milena damit beschäftigt, den Bonner Bürokraten mit Analysen, Diagrammen und Berichten den Stand ihrer Arbeit zu dokumentieren. Einen Fachbereich für Internationale Strafverfolgung und Gerichtsbarkeit sollte sie aufbauen – eine Aufgabe, bei der ihr von serbischer Seite so viele Steine wie nur möglich in den Weg gelegt wurden. Eines der vielen Paradoxe in diesem Land, denn offiziell finanzierte das serbische Bildungsministerium die andere Hälfte ihrer Stelle. Es herrschte der politische [38] Wille, der Europäischen Gemeinschaft zu demonstrieren, dass man in Serbien bereit war, die verbrecherische Kriegsvergangenheit aufzuarbeiten. Doch dem Willen sollten möglichst keine großen Taten folgen. Die Bonner waren anders, aber auch nicht viel besser.
»Tut mir leid«, sagte die Dame am anderen Ende der Leitung. »Ich kann Ihre Unterlagen nicht finden. Kollege Blechschmidt ist krank, ich bin hier nur seine Vertretung.« Etwas in ihrer Stimme verriet, dass sie in einem Büro mit weichem Teppich, schönen Möbeln und Gardinen vor den Fenstern saß. »Wann, sagten Sie, läuft Ihre Frist ab?«
»Frist?« Milena wollte nicht schreien. Sie wollte wie diese Frau souverän und gelassen sein, auch wenn die Bonner Bummelei, diese an Überheblichkeit grenzende Gedankenlosigkeit sie zur Weißglut brachte. Verdammt, ihre Existenz und noch dazu die ihres Sohnes und ihrer Mutter standen auf dem Spiel! »Meine Stelle läuft zum Jahresende aus, falls Sie das meinen.«
»Verstehe. Sie brauchen Planungssicherheit. Wie war Ihr Name?«
»Milena Lukin.«
»Und Sie sind in…«
»Belgrad. Das ist die Hauptstadt von Serbien.«
»In den nächsten Tagen wird sich einer der Kollegen bei Ihnen melden.«
Milena legte auf. Ihre Augen brannten. Mit Daumen und Zeigefinger presste sie gegen die Nasenwurzel und konzentrierte sich dabei auf ihren Atem. Mit der anderen Hand zog sie ihre Tasche heran, griff blind hinein und kramte so lange, bis sie gefunden hatte, was sie suchte. Ohne sie mit [39] den Fingern zu berühren, drückte Milena die Geleebanane aus dem Cellophanpapier direkt in ihren Mund hinein. Sofort begann die süße Umhüllung aus dunkler Schokolade zu schmelzen. Mit der Zunge löste sie die Schicht aus Zuckerkörnern auf und stieß zu dem festen Körper aus kühlem Gelee vor. Milena schloss die Augen.
Mit ihrer eigentlichen Forschungsarbeit kam sie kaum noch voran. »Die Strafverfolgung des Kriegsverbrechens auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawien in der Zeit von 1990 bis einschließlich 1999«, so lautete ihre Habilitationsschrift, mit der sie nicht nur hoffte, ein dunkles Kapitel der jüngsten Vergangenheit auszuleuchten, sondern auch eines Tages irgendwo auf dieser Welt zur Professorin berufen zu werden. Es musste ja gar nicht Berlin sein. Vielleicht Boston. Sie hätte nichts dagegen, mit der ganzen Familie über den großen Teich zu gehen, in ein Backsteinreihenhaus mit Erker, Esszimmer und Vorgarten, und jeden Monat ein Gehalt zu bekommen, von dem sie hier nur träumen konnte. Und vor allem wollte sie endlich einmal Anerkennung für ihre Arbeit bekommen, die hier niemand würdigte.
Es klopfte. Ohne auf ein Zeichen zu warten, trat der Institutsdirektor ein – eine Unart, die Milena ihrem Chef nicht abgewöhnen konnte. Die Krawatte von Boris Grubač saß schon etwas locker, und der Pfefferminzgeruch zeigte an, dass er bereits mit mindestens einem Gläschen den Feierabend eingeläutet hatte.
»Wie sieht’s aus?«, fragte er in einem Ton, als wäre er tatkräftig und an Milenas Angelegenheit interessiert. Weder das eine noch das andere war der Fall. »Haben die Kollegen in Bonn denn nun endlich grünes Licht gegeben?«
[40] »Sieht alles sehr gut aus.« Milena schob den braunen Umschlag aus Ludwigshafen unter einen Ordner und log: »Man hat mir versichert, dass man mir weiter die Unterstützung geben will, die ich hier für meine Arbeit brauche.«
»Das haben Sie schriftlich?«
»Reine Formsache. Kommt in den nächsten Tagen.«
Grubač überreichte ihr ein kleines Kuvert aus teurem Büttenpapier. Der dezent geprägte Bundesadler der Bundesrepublik Deutschland zierte die Rückseite des Umschlags und ebenso den Kopf der Karte. Einladung zum Empfang. Der neue deutsche Botschafter gibt sich die Ehre, Freitag, den dritten September.
Milena gab ihrem Chef das Kuvert zurück. »Keine Zeit.«
»Sie sollten sich die Zeit nehmen und ein bisschen Lobby-Arbeit machen. Networking – schon mal davon gehört?«