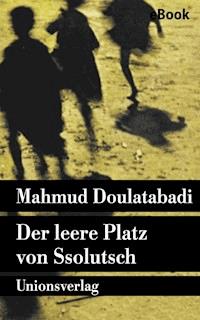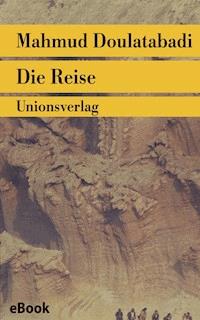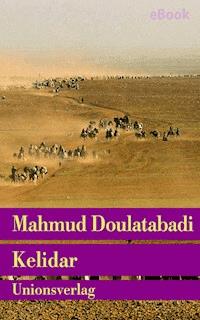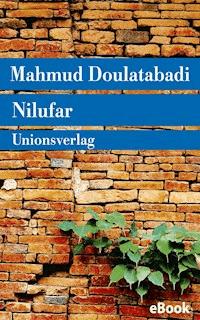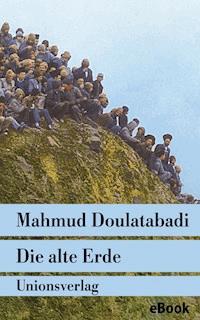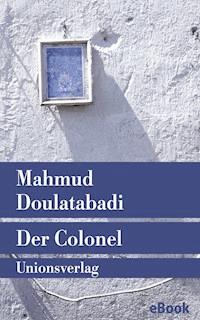
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine pechschwarze Regennacht in einer iranischen Kleinstadt, ein altes Haus. Der Colonel hängt seinen Gedanken nach. Erinnerungen stürmen auf ihn ein. An seine Jahre als hochdekorierter Offizier der Schah-Armee. An seine Kinder, die ihren eigenen Weg gingen, sich den Revolutionsgardisten angeschlossen haben und in den Krieg zogen, in die Leidenschaften der Revolution und des Todes. Durch die Gassen werden die gefallenen »Märtyrer« getragen, in der Stadt werden ihnen Denkmäler gebaut. Es herrscht Krieg – »diese giftige, fleischfressende Pflanze«. Da klopft es an die Tür. Der Colonel wird abgeführt, zur Staatsanwaltschaft … Mahmud Doulatabadi, der bedeutendste Schriftsteller des Iran, erzählt von den Umwälzungen, die den Iran bis in die Gegenwart heimsuchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein alter Colonel erinnert sich an sein Leben: an seine Jahre als Offizier der Schah-Armee; an seine Kinder, die ihren eigenen Weg gingen und den Leidenschaften der Revolution zum Opfer fielen. Da klopft es an der Tür … Mahmud Doulatabadi wirft mit diesem Roman ein Licht auf die Umwälzungen, die den Iran bis in die Gegenwart heimsuchen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Mahmud Doulatabadi (*1940) gilt als bedeutendster Vertreter der zeitgenössischen persischen Prosa. Er arbeitet als Schriftsteller und Universitätsdozent für Literatur in Teheran.
Zur Webseite von Mahmud Doulatabadi.
Bahman Nirumand (*1936) studierte in Deutschland und promovierte 1960 über Bertolt Brecht. Im Iran war er Dozent an der Teheraner Universität, musste jedoch ins Exil gehen. Er lebt als Schriftsteller und Publizist in Berlin.
Zur Webseite von Bahman Nirumand.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Mahmud Doulatabadi
Der Colonel
Roman
Aus dem Persischen und mit einem Nachwort von Bahman Nirumand
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Diese Übersetzung folgt dem Manuskript.
Die Übersetzung aus dem Persischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia.
© by Mahmud Doulatabadi 2009
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Megumi Takamura
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30508-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 09:46h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER COLONEL
Erst einmal muss ich meine Zigarette ausmachenNachwortWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Mahmud Doulatabadi
Über Bahman Nirumand
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Mahmud Doulatabadi
Zum Thema Iran
Zum Thema Asien
Erst einmal muss ich meine Zigarette ausmachen …
Dies war vielleicht seine zwanzigste Zigarette seit dem frühen Abend. Er bekam kaum noch Luft. Seine Zunge und sein Mund hatten den Geschmackssinn verloren.
Schau, wie die zersprungenen Fensterscheiben schwitzen. Was für eine Stille! …
Der Türklopfer durchbrach mit jedem Schlag das Geräusch des Regens. Regen, nichts als Regen, und der Aufprall der Tropfen auf das alte, verrostete Blechdach war so monoton, dass er selbst zu einem Teil der Stille geworden war.
In all den langen Tagen meines Lebens habe ich nur ein einziges Mal die Dächer in der Dämmerung gesehen. Ich erinnere mich genau … In der Dämmerung nach dem Regen, kurz vor Sonnenuntergang, leuchten die ockerfarbenen Dächer in trauriger Schönheit. Es war in der Zeit, als die ersten weißen Haare an seinen Schläfen sichtbar wurden. Damals war sein Gang noch aufrecht, er schritt mit erhobenem Haupt und spürte den Boden unter den Füßen. Er war noch nicht gealtert, verbraucht, sein Gesicht war noch nicht runzelig geworden, die Falten und Furchen der Angst und Enttäuschung hatten sich noch nicht in seine Stirn gegraben.
Meine Herren, ich muss doch zuerst meine Zigarette ausmachen, dann aufstehen, meinen Regenmantel um die Schultern legen, erst dann kann ich die Tür öffnen. Klopft ruhig weiter, wer immer ihr seid. Schon seit Jahren habe ich keine gute Nachricht mehr erhalten, und auch jetzt zu dieser ungastlichen Stunde mitten in der Nacht erwarte ich keine frohe Botschaft. Lass mich schauen. Wenn diese alte Uhr nicht nach- oder vorgeht, ist es halb vier. Schau, wie die zerbrochenen Fensterscheiben schwitzen … Nur zu, klopft weiter, meine Lieben, klopft, bis sogar die Toten aufwachen. Aber solange ich meinen Regenmantel nicht umgehängt und meine Pantoffeln nicht angezogen habe, werde ich nicht über die Terrasse in den Hof gehen. Ihr seht doch, dass es wie aus Gießkannen regnet … Ich muss die elektrische Deckenlampe der Terrasse anmachen, bevor ich die Stufen hinabsteige. Wollt ihr denn, dass ich im Dunkel ausrutsche, hinfalle und mir die Schulter ausrenke? … Ich komme schon. Hoffentlich brennt kein Licht in Amirs Zimmer im Keller. … unbedingt Ruhe bewahren und beim Öffnen der Tür nicht überrascht und ängstlich wirken. Kein Zittern in den Augenwinkeln und ums Kinn, auf keinen Fall! Aber ich habe keine Kontrolle über das Zucken an meinem linken Auge. Sobald ich mich auf etwas konzentriere, geht es wieder los. Das kann ich nicht verhindern.
»Ja, meine Herren … Ich komme ja schon … Nur ein wenig Geduld!«
Er fragte nicht, wer da mitten in der Nacht an seiner Tür klopfte, nicht weil es ihm an Mut fehlte. Nein, das war es nicht. Eine solche Frage konnte ohnehin nichts ändern. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt: An einer geschlossenen Tür wurde mitten in der Nacht nie ohne Grund geklopft.
Es gibt keinen Ausweg … Tief Atem holen … Und lieber nicht überlegen, wie viele Zigaretten ich in den letzten vierundzwanzig Stunden geraucht habe. Fest bleiben und jetzt keine Entscheidungen treffen, die völlig undurchführbar wären. Ich muss beim Öffnen der Tür meine Nerven im Zaum halten. Mein unruhiges Atmen könnte als Zeichen der Angst gedeutet werden, also tief durchatmen und dann mit größter Gelassenheit die Tür öffnen.
»Herr Colonel!«
»Ja, meine Herren.«
»Sind Sie es, Herr Colonel?«
»Ja, mein Herr, wer sollte es sonst sein?«
»Warum öffnen Sie nicht die Tür?«
»Sofort, ich werde gleich aufmachen. Ich suche doch den Schlüssel. Hier, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Aber nein, das ist der Schlüssel für die Truhe. Ich muss gehen und den richtigen Schlüssel suchen. Bitte verzeihen Sie, es dauert nur noch einen Augenblick.«
Wo habe ich ihn bloß hingelegt? Auf den Sims oder auf den Tisch? Ich stecke doch den Schlüssel immer in die Tasche. Für alle Fälle. Seit dem Nachmittag habe ich das Haus nicht verlassen, brauchte also auch nicht meine feuchten Kleider zu wechseln. Es kann natürlich sein, dass ich den Schlüssel zusammen mit dem Rosenkranz und dem Feuerzeug – dem Benzinfeuerzeug aus Deutschland, das nicht mehr funktioniert – auf den Sims über dem Kamin, neben dem Foto vom alten Colonel gelegt habe. Ja, richtig …
Tatsächlich, der Schlüssel lag dort, genau vor den schwarz glänzenden Stiefeln des alten Colonels, neben dem Passbild von Mohammad Taghi, das der für seinen Führerschein hatte machen lassen. Seit mehr als zwei Jahren, vielleicht auch seit drei Jahren, stand dieses Foto neben den schwarz glänzenden Stiefeln des alten Colonels. Denn der Colonel wollte sich so an den Anblick seines Sohnes gewöhnen.
Ja, ich muss mich wieder an den Anblick meiner Kinder gewöhnen …
In der Tat war dieser Entschluss aus einem Bedürfnis entstanden, sich vor etwas zu schützen. Er hatte das Foto seines Sohnes in seinem Blickfeld aufgestellt, wie um sich zur Wehr zu setzen, sich zu wappnen gegen etwas, das aus der Tiefe seines Herzens heraus in seinen Schädel eingedrungen war. Solange das Foto Mohammad Taghis vor seinen Augen stand, würde er nicht Gefahr laufen, von Erinnerungen an den Jungen überwältigt zu werden. So hoffte er zumindest. In Wirklichkeit diente der ständige Blick auf das Foto zur Abwehr gegen etwas, das ihn vernichten wollte. Abwehr gegen alles, was ihn bedrohte, war ihm zur Gewohnheit geworden. Es war wie beim Militärmanöver. Oder im Krieg. Im Krieg erzielen nur Überraschungsangriffe eine vernichtende Wirkung, und wer vorbereitet ist, kann sie erfolgreich abwehren.
Wahrscheinlich hatte er mit derselben Absicht das große Foto, das den alten Colonel in voller Gestalt zeigt, über ein halbes Jahrhundert vor Augen gehabt, und er hatte den Wunsch, ja die Sehnsucht, auch das Foto seiner Frau unter die Schwertspitze des Colonels, in die linke Ecke des Bilderrahmens zu klemmen, um es ständig vor sich zu sehen.
Aber ich schaffte es nicht, und ich kann es immer noch nicht …
Das Foto von Parwaneh hingegen stand schon eine Weile unter den Stiefeln des alten Colonels. Er hatte es, nachdem Parwaneh drei Tage und Nächte nicht nach Hause gekommen war, im rechten Winkel neben dem Foto von Mohammad Taghi platziert. Das war vor zwei Monaten gewesen, und seither hatte er versucht, sich an den Anblick seiner Tochter zu gewöhnen, auch an das Foto von Masud, den man Masud den Kleinen nannte, ja, den Kleinen. Vielleicht weil er schwarze, buschige Augenbrauen und eine kleine Stirn hatte. Die Kinder hatten ihn »den kleinen Wilden« genannt.
»Jetzt habe ich den Schlüssel gefunden, gerade eben habe ich ihn gefunden. Gleich mache ich die Tür auf, sofort. Seien Sie willkommen, treten Sie ein. Ich wünsche einen guten Abend.«
Da war er wieder, dieser fahle Lichtstrahl, der, vom Märtyrer-Denkmal am Ausgang der Gasse kommend, das Gesicht des Colonels wie im Mondschein erhellte. Er fiel von hinten auch auf die zitronenfarbenen Anoraks der beiden Männer. Vermischt mit den Regentropfen, hatte sich der Lichtstrahl wie weißer Staub auf die Schulterblätter und den Rand ihrer Kapuzen gelegt und beleuchtete die Silhouetten der Besucher, sodass der Colonel erkennen konnte, dass beide Männer jung und bewaffnet waren. Vielleicht war das der Grund dafür, dass der Colonel seine eigene Stimme nicht hören konnte – unwillkürlich wiederholte er den Gruß, blieb unterwürfig stehen, wartete, bis die beiden jungen Männer sagten, was sie wollten, um dann ihren Anweisungen zu folgen.
Einer von ihnen holte schließlich aus der weiten Tasche seines Anoraks eine Taschenlampe heraus, und obwohl das kalte Licht des Märtyrer-Denkmals das Antlitz des Colonels erhellt hatte, richtete er den starken Lichtstrahl der Taschenlampe auf dessen Gesicht, schwenkte dann den Strahl im verregneten Hof herum, und bevor das Licht aufs Wasser des Beckens fiel, richtete er den scharfen Strahl genau auf die feucht gewordenen Pantoffeln des Colonels. Dann schaltete er die Taschenlampe aus. Vielleicht wollte er auf eine Entscheidung oder Handlung seines Kollegen warten.
Der Colonel war von Kopf bis Fuß erfüllt von Fragen. So wie er im Regen stand, mit gespreizten Schultern, dem Buckel im Rücken und erstarrtem, verängstigten Blick, sah er aus wie ein von ungeschickter Hand gekritzeltes Fragezeichen. Er hatte sogar die Höflichkeitsfloskeln, die traditionell zur Begrüßung ausgetauscht werden, vergessen. Er starrte nur auf die jungen Männer, die immer noch wortlos an der Tür standen und im regengesättigten Lichtstrahl des Märtyrer-Denkmals nach irgendetwas zu suchen schienen.
Was ging ihnen wohl durch den Kopf? Mehr als diese Frage beschäftigte den Colonel – abgesehen von der Angst, die wie ein Strom ständig durch sein Innerstes floss – die Feststellung, dass die beiden Jungs im selben Alter waren wie Mohammad Taghi und dessen jüngerer Bruder. Mohammad Taghi war, als er im Februar 1979 starb, einundzwanzig Jahre alt, und Masud müsste, sollte er noch am Leben sein, jetzt sechsundzwanzig geworden sein.
Was hätte ich tun sollen? Was? Es hätte doch keinen Sinn gehabt. Nein, ich konnte nichts tun. Alles war mir aus den Händen geglitten. Die Kinder waren erwachsen, jeder von ihnen eine eigenständige Person. Sie brauchten nicht mehr auf mich zu hören. Hätte ich ihnen befehlen können, sich nicht so zu ereifern? Schließlich war die Revolution ausgebrochen, die Revolution. Und in Zeiten der Revolution sucht jeder seinen eigenen Vorteil. Es sei denn, man ist noch jung. Junge Menschen haben nicht nur ihren Vorteil im Auge. In der Revolution suchen sie ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Lebenswahrheit. Und natürlich, nichts weckt bei Jungen so viel Leidenschaften wie eine Revolution. Wie die Taube, die zur Sonne fliegt, so hoch, bis sie verbrennt. Ein solcher Akt ist für die Jugend der Gipfel der Wahrheit. Genau das ist meinen Kindern widerfahren, die Revolution hat sie mir geraubt. Ich habe keine Ahnung, wohin und wie hoch sie fliegen und ob sie nicht längst verbrannt sind. Wehe, wehe den Nachbarn, den Mitbürgern, den Landsleuten, wenn diese Jugendlichen von ihrem hohen Flug, von der Grenze des Verbrennens zurückkehren und mitten in einer Welt voller List und Verlogenheit ihre Wahrheit finden wollen? Dann … Dann werden die glühenden Fetzen … die geschmolzenen Fetzen … Ein Strom aus Feuer und Glut …
»Meine Söhne … Meine Kinder! … treten Sie bitte ein, Sie brauchen nicht im Regen zu stehen. Das schickt sich nicht.«
Was hätte der Colonel anderes sagen können? Selbst wenn die beiden ihm ihre Ausweise nicht gezeigt hätten, hätte er sie ins Haus hereingelassen. Es war nicht zu verhindern.
Die Wahrheit ist, dass ich Angst habe, seit Langem plagt mich die Angst …
Vielleicht hätte er die Tür gar nicht abzuschließen brauchen. Wäre sie offen gestanden, wäre dasselbe geschehen, was jetzt geschehen war. Aber das Abschließen der Haustür war inzwischen zu einem Teil seiner Natur geworden. Es war keine bewusste Handlung mehr, kein Versuch, irgendetwas zu schützen. Nein, es war eine Gewohnheit, gewachsen aus Angst.
Ich habe Angst, meine Herren, Angst. Wovor, vor wem, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Mensch etwas anderes ist als die Kleider, die er trägt. Dass all die schönen Worte und Höflichkeitsfloskeln nichts über ihn aussagen. Und wenn ich durch die Menschen hindurchsehe, erschrecke ich, denn sie erinnern mich an eine Herde wilder Stiere – wie ich sie vermutlich einmal im Kino gesehen habe. Dann schließe ich die Augen, das heißt, meine Augen schließen sich aus lauter Angst von selbst. Denn ich spüre, wie eine furchterregende Herde von Menschen, aus deren Stirnen merkwürdige Hörner herausragen, sich in Bewegung setzt, um alles zu vernichten, auch mich und meine paar Knochen, die noch übrig geblieben sind. Ein Albtraum, meine Herren! …
»Warum nehmen Sie nicht Platz, bitte setzen Sie sich doch! Ja, diese Stühle sind schwach geworden, wenn man sich daraufsetzt, knirschen sie, als habe man sich auf trockenes Brot gesetzt. Aber ein alter Spruch sagt: Alles, was im Haus ist, ist dem Gast genehm. Wie auch immer, nehmen Sie doch bitte Platz!«
Sie werden sich wohl hinsetzen, oder? Ja, sie setzen sich. Ein Handtuch, ja natürlich …
Er hätte ein Handtuch nehmen und seine weißen, vom Regen nass gewordenen Haare, den Hals, die Stirn, die Augenbrauen trocknen können. Aber es war zu spät. Es war ihm zu spät eingefallen. Dass er sich jetzt aber eine Zigarette angezündet und mit dem Rücken zum Ofen auf einen der opiumfarbenen Stühle gesetzt hatte, stimmte ihn zufrieden, ja, er spürte sogar Ruhe, obwohl er mit der rechten Hand seinen linken Arm festhalten musste, um das unaufhörliche Zittern zu verhindern. Noch schlimmer aber war das Zittern der Zigarette, die zwischen zwei Fingern klemmte, er konnte es kaum verbergen. Unsere Stadt ist klein, ist nicht einmal Provinzhauptstadt, hier kennt jeder jeden. Wenn ich mich also einen Augenblick lang konzentrieren und meine Nerven beherrschen könnte, würde ich sicherlich meine Gäste erkennen, zumindest würde ich herausfinden, wer ihre Eltern sind. Ich bin zwar in dieser Stadt nicht geboren, lebe aber seit Langem hier, jedenfalls seit meine Tochter Parwaneh geboren wurde. Als wir in diese Stadt zogen, war mein ältester Sohn Amir nicht älter als fünfzehn und die anderen Söhne noch so klein, dass sie bald den Dialekt der Einheimischen sprachen. Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lassen würde, könnte es mir sicherlich gelingen, meine Gäste so weit zu bringen, dass sie gestehen, meine Söhne Masud und Mohammad Taghi zu kennen. Vielleicht waren sie sogar Freunde. Selbst wenn sie nicht in derselben Klasse waren und nicht nebeneinander auf der Schulbank saßen, haben sie sich in den unruhigen Tagen und Nächten der Revolution sicher kennengelernt …
Die Gäste schwiegen, wichen seinem Blick aus. Es schien, als schämten sie sich.
Der junge Mann, der den Colonel an Mohammad Taghi erinnerte – oder der Colonel wünschte, dass es so wäre –, verlor schließlich die Geduld. Er stand auf, stellte sich vor das große Porträt des alten Colonels, starrte auf das Foto von Mohammad Taghi und blieb einige Augenblicke so stehen. Die Kapuze des Anoraks hing von seinen Schultern herab. Der andere junge Mann, der, wie Colonel meinte, von Gesicht und Gestalt her Masud ähnlich sah, saß immer noch schweigend dem Colonel gegenüber, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, die Hände gefaltet, und blickte ins Leere, vielleicht auf das schon zerfranste, alte, rote Tischtuch.
Die Jungen … Sie wirken so schüchtern, doch in ihrem Innern hält sich eine ungeheure Kraft verborgen, die sie unglaublich schnell in schreckliche Raubtiere verwandeln kann. Tiere, die vor keinem Verbrechen zurückschrecken. Werden sie gerade darum immer wieder mit der Ausführung der schrecklichsten Verbrechen beauftragt? Durch die ganze Geschichte hindurch haben sie diesen Auftrag mit großem Erfolg erfüllt. Heldentaten nennen sie das! Und wir? Wir schicken die unreifen Menschen auf die Straße, treiben sie in die Arme der Drahtzieher der Grausamkeit. Bis schließlich unser eigenes Fleisch und Blut, das man uns entrissen hat, den Dolch auf uns richtet …
Mein Mohammad Taghi war im ersten Jahr seines Medizinstudiums …
Ich kannte ihn. Ich kannte ihn …
Hatte der Colonel diesen Satz überhaupt geäußert? Hatte er diese Antwort erhalten? Die Art, wie der junge Mann vor dem Foto stand, vermittelte ihm den Eindruck, er habe seinen Sohn gekannt. Er wollte sich dessen vergewissern, obwohl es an dem, was bevorstand und ihm noch unbekannt war, nichts ändern würde. Aber vielleicht konnte das Wissen um eine solche Bekanntschaft dem Colonel für einen Augenblick Erleichterung verschaffen, ihn aus dem schwindelerregenden Strudel, in den er geraten war, für eine kurze Zeit herausholen.
Er ist genauso ungeduldig wie Mohammad Taghi! …
Genau aus diesem Grund harrte er nicht lange vor Mohammad Taghis Bild aus. Der Colonel konnte sich schon denken, dass der junge Mann auch vor Parwanehs Foto nicht lange stehen bleiben würde. Nein, er kehrte zurück, setzte sich, warf einen Blick auf seine Armbanduhr und wandte das Gesicht seinem Kollegen zu. Dem Colonel schien, als fühle der junge Mann das Drängen der knappen Zeit. Ihn selbst hingegen beunruhigte die Unsicherheit, die er aus jedem Detail ihres ungeschickten Verhaltens spürte. Welchen Schicksalsschlag hatte er zu erwarten? Er konnte nur warten, warten. Er war sich gewiss, dass diese jungen Männer, die einst glühend vor Begeisterung losgezogen und nun enttäuscht zurückgekehrt waren, nicht an seine Tür geklopft haben, um seine Wunden zu lindern. Also musste er warten.
Er wartete, bis einer der beiden sagte: »Bitte folgen Sie uns zu einem kurzen Besuch bei der Staatsanwaltschaft.«
»Staatsanwaltschaft?«
»Dort werden Sie alles erfahren, Colonel!«
Nein, ich darf kein Erstaunen zeigen. Ich darf nicht unwillig wirken. Ich … Ich versuche schon seit Langem, nicht aus der Rolle zu fallen und unter allen Umständen Ruhe zu bewahren. Außerdem habe ich mir vorgenommen, mich nicht mehr von einem Ereignis oder einer Nachricht überraschen zu lassen. Nein, mag geschehen, was will, ich darf mich über nichts wundern. Wer sich über nichts wundert, den kann nichts überraschen. Ohnehin lebe ich ja ganz in den Ereignissen und Erlebnissen der Vergangenheit. Vielleicht lässt sich dies mit meiner Tätigkeit in der Armee des Schahs oder meiner Teilnahme am Krieg erklären oder mit dem, was mit meiner Frau oder mit Parwaneh geschah. Ich weiß es nicht. Es kann tausend Gründe haben. Aber … Aber… Dieses Beben meines Herzens, darüber habe ich keine Macht. Dagegen kann ich nichts tun.
Ich muss doch die Zimmertür abschließen, bevor ich die Treppe hinuntergehe. Ich muss sie abschließen. Selbstverständlich, das tue ich. Zum Glück habe ich meinen Hut nicht liegen gelassen, ich trage ihn auf dem Kopf. Trotzdem hebe ich zur Sicherheit noch einmal die Hand hoch und prüfe, ob ich ihn auf dem Kopf trage. Ich habe meine Sinne beisammen und weiß, dass ich den Kragen meines Mantels hochschlagen muss, damit die aneinandergeketteten Regentropfen nicht durch den Kragen herabrollen können. Natürlich achte ich darauf, mich so zu verhalten, dass die beiden nicht merken, dass Amir sich im Keller aufhält. Vielleicht ist das unwichtig, doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass Amirs Verhalten und der Umstand, dass er sich seit einem Jahr isoliert im Keller aufhält, Neugierde, ja sogar Verdacht wecken könnten. Denn, logisch gedacht, gibt es keinen vernünftigen Grund, weshalb ein ehemaliger Häftling, der noch nicht einmal das vierzigste Lebensjahr erreicht hat, sich im Hause seines Vaters, im Keller abkapselt, ja, man könnte sogar sagen, einsperrt und jeden Kontakt mit anderen Menschen, sogar mit seinen Nächsten, meidet. Natürlich provoziert das Verdacht, erst recht bei einem Menschen wie Amir. Ob Amir verrückt ist? Nein, man darf einen solchen Gedanken nicht einmal zulassen. Ich habe ihn doch des Öfteren mit seiner Schwester Farzaneh reden gehört. Zwar redet unsere Farzaneh viel und auch immer wieder das Gleiche, aber sie ist fast gleich alt wie Amir, und wenn sie Zeit hat, schaut sie bei ihm vorbei, setzt sich auf die Kellertreppe und fragt ihn mit geschwisterlicher Anteilnahme:
»Warum sitzt du so bekümmert da, Bruder? Was ist denn geschehen? Du verhältst dich so, als sei die Welt untergegangen! Du bist doch nicht der Einzige, der seine Arbeit verloren hat. Das ist kein Grund, dich in eine Ecke zu verkriechen, als hättest du die Lepra. Was ist los, lieber Amir, mein lieber Bruder? Denk doch auch ein wenig an Vater. Nach Mohammad Taghis Tod ist er sehr alt geworden. Soll er jetzt vor Kummer über dich sterben? Er hat viele Qualen erleiden müssen, das weißt du besser als wir alle. Du bist doch jetzt der große Sohn und musst dich um die Familie kümmern, um uns alle. Ich bin eine verheiratete Frau und kann keine eigenen Entscheidungen treffen. Du weißt, dass mein Mann mir untersagt hat, zu euch zu kommen. Mein Sohn beginnt allmählich einiges zu verstehen. Mein Mann fragt ihn aus, auch meine Tochter fragt er aus. Und dann hab ich noch das kleinste Kind, das macht so viel Arbeit. Mein Mann Ghorbani Hadjadj ist äußerst misstrauisch und ängstlich. Deshalb fragt er meinen Sohn aus, und der Junge kann seinen Mund nicht halten. Einem Kind kann man das nicht erklären. Aber wenn ich euch nicht sehe, finde ich keine Ruhe, es ist, als würden meine Kleider auf der Haut brennen. Doch ich habe keine andere Wahl, lieber Bruder, ich muss meinen Mann ertragen, muss ihm gehorchen. Vielleicht, vielleicht werde ich euch nicht mehr besuchen können. Denn Ghorbani Hadjadj meint, diese Besuche bei euch würden seinem Ruf schaden und ihm womöglich Schwierigkeiten bereiten. Er macht sich Sorgen um seine Stelle. Über euch, über unsere Familie wird übel geredet. Wir haben einen schlechten Ruf. Du weißt, mein Bruder, ein schlechter Ruf, der an einem haftet, ist schlimmer als ein Dach, das einem auf den Kopf stürzt. Bei jeder Trauerzeremonie, die ich besuche, schwatzen die Weiber über euch. Manche von ihnen haben sehr böse Zungen, mein Bruder. Ich kann solche Zusammenkünfte nicht ganz meiden. Aber wenn ich dort bin, fühle ich mich wie eine Fremde, auch mir selbst gegenüber. Ich möchte mit hundert Zungen allen mitteilen, dass ich eine ganz andere bin, als ich scheine, dass ich mit den Gedanken ständig bei euch bin. Ich habe keinen anderen Ausweg, lieber Bruder, als mich von euch, das heißt in Wirklichkeit von mir selbst, fernzuhalten. Doch jedes Mal, wenn ich dich sehe oder an dich denke, wenn ich mich an das Schicksal unseres Vaters erinnere, der wie ein Küken zusammengeschrumpft ist, dann spüre ich aus Kummer einen Kloß im Hals, mein Herz droht zu zerbersten. Dann will ich nur noch zerschmelzen und in der Erde versinken. Amir … Amir, lieber Bruder, sag etwas, gib mir eine Antwort. In diesem Zustand machst du unserem Vater den allergrößten Kummer. Er wird es nicht verkraften. Was ist denn in dich gefahren? Dir ging es doch gut. Du gabst allen Ratschläge und brachtest jedem etwas bei. Deine Schüler kreisten wie Schmetterlinge um dich herum, liebten dich wie ihren großen Bruder … Deine Schläfen sind grau geworden, lieber Bruder Amir!«
Ich hörte ihre Stimme, während ich zum hundertsten Mal im Shahnameh unseres großen Epikers Firdausi die Geschichte von König Manutschehr las. Seine Söhne Salm, Tour und Iradj waren mir inzwischen so nah, dass ich sie vor mir sah und ihre ausweglose Lage nachfühlen konnte. Vor Kurzem hatte ich Amirs Augen gesehen, sie sahen aus wie vertauscht, mehr als je zuvor, und in seinen Pupillen hatte sich eine Stimmung zwischen Scham, Angst und Zweifel eingenistet, etwas, das mehr war als Hoffnungslosigkeit. Seine langen, schmutzigen Haare fielen auf seine Schultern, und die Haare an seinen Schläfen waren weiß geworden. Ich sah meinen Sohn durch die trüben Fensterscheiben des Kellers, sah, wie er Tag für Tag zusammenschrumpfte und älter wurde. Aber ich konnte nichts für ihn tun. Oft hörte ich nachts seine schrecklichen Schreie. Ich konnte seine beängstigenden Träume so gut nachfühlen. Albträume von einem Sturz, Menschen stürzen von hohen Dächern, von großen, hohen Felsen ins Leere, ins Nichts. Junge Männer stürzen in ein schwarzes Loch der Hoffnungslosigkeit. Verzerrte Gesichter, die Qualen leiden, wilde Schreie der Hoffnungslosigkeit. Männer, die ihre Söhne zum Schlachthof führen, damit sie schneller enden. Frauen, die ihre Gebärmutter herausreißen, um die Bildung von Embryos zu verhindern. Ich hörte dumpfe Schreie der Hoffnungslosigkeit, wie in Watte gepackt. Es waren schreckliche Ereignisse, die ihn plagten. Ich habe ein Leben lang gebraucht, um mich an solches zu gewöhnen. Heute kann ich es hinnehmen. Aber Amir schafft es noch nicht, solche Schläge des Schicksals als Normalität aufzufassen. Schuldgefühle – das ist mein Eindruck – plagen ihn wie ein Stachel im Fleisch. Im Vergleich zu mir ist Amir noch jung, aber nicht mehr so jung, dass ich ihm Ratschläge geben könnte. Genau deshalb verlieren mein Sohn und ich allmählich unsere gemeinsame Sprache. Amir redet nicht gern, und mir ist jede Unterhaltung peinlich. Worüber könnte ich mit ihm sprechen, wenn das Gespräch rückhaltlos und echt sein sollte? Wie kann ein Volk so viel Ungesagtes und so viel Schweigen erdulden? Bleibt also nur Farzaneh, die sich gelegentlich, hinter dem Rücken ihres Mannes, ein Stündchen stiehlt, Amir aufsucht und sich bemüht, ihn mit ihren einfachen, direkten, ungekünstelten Worten zum Sprechen zu bringen. Vielleicht ist nur auf diese Weise ein großes Unglück in Worte zu fassen. Farzaneh denkt gar nicht erst lange über das richtige Wort nach, sie hat keine Skrupel. Sie setzt sich ganz einfach auf die unterste Stufe der Kellertreppe, nimmt ihr kleines Kind auf die Knie, und während ihre beiden anderen Kinder über ihre Schultern klettern, redet sie unter Tränen mit Amir. Und wenn ich die Ohren spitze, kann ich sie hören:
»Aus lauter Kummer bekomme ich einen Kloß im Hals, lieber Bruder. Hab wenigstens mit mir Erbarmen. Ich kann es nicht mehr mit ansehen, dass auch du vor meinen Augen Stück für Stück verfällst. Jeden von euch habe ich auf eine andere Weise verloren. Zuerst war es Mohammad Taghi. Auch von Masud kommt kein Lebenszeichen mehr. Allmählich verliere ich die Hoffnung. Und unsere Schwester Parwaneh, Parwaneh, meine kleine Schwester. Jedem auf dieser Welt ist der Tod sicher. Aber der Tod ist hässlich geworden, würdelos. Vermutlich wird man uns bald auch Masuds Leichnam oder irgendein Zeichen seines Todes bringen. Ich erinnere mich an den Tag, als Mohammad Taghis Leichnam gebracht wurde. Noch heute kommen mir deswegen die Tränen. Tod und immer wieder Tod, wie oft noch? Meine Brüder, meine Brüder! Schau, was alles geschehen ist, dass ich so offen, ohne jede Achtung über den Tod sprechen kann. Was wird mit unserer Schwester geschehen, Amir, mit unserer kleinen Schwester? Die Stadt ist voller Märtyrer-Denkmäler, sie tragen die Särge durch die Gassen, auf den Straßen fließt Blut, und mein Mann ist zum Tagelöhner des Todes geworden, denn er hat beschlossen …, was weiß ich! Und ich, lieber Bruder, ich ersticke fast vor Verzweiflung. Und du schweigst und schweigst. Rette mich aus dieser Verzweiflung, Amir, rette mich! Ich sehe, wie du immer mehr abnimmst, du bist nur noch ein Schatten. Quäl mich nicht, Amir! Sag wenigstens ein Wort!«
Nein, ich kann nicht glauben, dass mein Amir seine Sinne verloren hat, nein, das darf nicht sein. Aber diese verwirrenden, erschreckenden Albträume! …
Der Colonel hatte bei Amir kein ungewöhnliches Verhalten beobachten können. Selbst nach den schrecklichen Albträumen hatte sich Amir ganz ruhig auf die Bettkante gesetzt, sich mit einem alten Tuch den Schweiß von der Stirn und den Augenlidern gewischt und sich eine Zigarette angezündet. Der Colonel hatte sogar gehört, wie Amir zu sich selbst sagte: »Ich werde es durchstehen, ich werde alles versuchen, wenn nur die Albträume aufhören.« Er hatte aus Amirs Mund den Satz gehört: »Ich habe noch alle meine Sinne beisammen, dafür gebe ich mein Wort.« Der Colonel war überzeugt, dass sein Sohn alle Sinne beieinanderhatte und gewillt war, das durchzustehen. Er hatte ja nicht einmal mit der Arbeit an der Statue für Amir Kabir aufgehört. Der Colonel hatte ihren Schatten durch die verstaubte Fensterscheibe gesehen. Wie könnte er also die Hoffnung auf den Sohn aufgeben?
Ich selbst habe ihn mit Amir Kabir bekannt gemacht, ihm gesagt, dass dieser Mann immer als Symbolgestalt in uns weiterleben muss. Hätte ich das nicht tun sollen? Ich muss allerdings gestehen: Beim Gedanken, dass ich zu meinen Kindern über die Freidenker und Patrioten unseres Volkes gesprochen habe, überfällt mich manchmal ein Gefühl der Verlegenheit, der Scham. Als hätte ich an meinen Kindern Verrat geübt. Zum Glück verschwinden aber solche Gedanken rasch, bevor sie sich in mir festsetzen. Doch – das war meine Pflicht als Vater. Ja, es war meine Pflicht, sie über die Fortschritte in der Geschichte der letzten hundert Jahre aufzuklären. Daraus schöpft man doch die Kraft zum Weiterleben! Junge Menschen hungern nach neuen Ideen, und kein Vater hat das Recht, diesem Verlangen gegenüber gleichgültig zu sein. Wer kann mir das zum Vorwurf machen? Hätte ich ihnen die Wahrheit verschweigen und ihnen Lügen aufschwatzen sollen? Sie hätten die Wahrheit ohnehin selbst herausgefunden. Keiner schafft es, einem Jungen aufzuschwatzen, er solle die Nacht als Tag bezeichnen. Nein, ich brauche mich nicht zu schämen. Wie komme ich überhaupt auf solche Gedanken. Was ist geschehen, dass man selbst die vernünftigsten Taten bereuen muss? Meine Kinder, meine Kinder! …
»Mein Schädel … Mein Schädel platzt, lieber Vater!« Diesen Klageruf hatte der Colonel oft durch Wand und Fenster des Kellers hindurch vernommen. Dort saß Amir, den Kopf zwischen seine Hände gepresst. Nach seinen Albträumen wirkte Amir immer ausgelaugt, ratlos, fiebrig und verzweifelt, weil er keine Antwort auf seine Fragen gefunden hatte und auch nicht wusste, wo auf dieser Welt er sie finden könnte. Der Colonel vermutete, dass sein Sohn immer wieder zu diesem unauflösbaren Knoten gelangte, bei dem jedes Weiterdenken unmöglich wurde. Dabei schien Amir durchaus bei Sinnen, der Colonel war davon überzeugt, dass Farzaneh sich irrte, wenn sie glaubte, Amir sei dem Wahn verfallen. Farzaneh solle Amir nur ja nicht provozieren, meinte er. Vor allem solle sie nicht über ihre Geschwister reden, denn das löste bei ihm Verzweiflung aus. Abgesehen von diesen Attacken der Verzweiflung schien er nie an seine Geschwister zu denken. Vielleicht weil er den Mut verloren hatte, über das Unglück nachzudenken, ja, noch schlimmer, weil ihn Zweifel und Resignation völlig zermürbt hatten. Der Colonel konnte das gut verstehen. Wer so ins Leere fällt, findet keinen Weg mehr heraus. Er dreht sich so lange im Kreis, bis er, benommen vom Schwindel, hinfällt und alles aufgibt.
»Ich bin mir selbst ein Rätsel geworden. Ein Rätsel, das nur der Tod entwirren kann. Nicht nur mein Volk und mein Land, auch ich selbst bin verzweifelt. Wer bin ich, was bin ich, wo gehöre ich hin?«
Vielleicht hatte der Colonel diese Worte gar nicht wirklich aus dem Munde Amirs gehört. Es muss ja nicht jeder Gedanke ausgesprochen werden, um Gehör zu finden. Vielleicht hatte er Amirs Worte aus dem Gesichtsausdruck seiner Tochter Farzaneh herausgelesen. Farzaneh biss sich auf die Lippen und weinte. Sie war mager geworden, doch immer noch weckte sie in ihm die Erinnerung an ihre Mutter. Hellbraune Haare, grünliche Pupillen, eine klare Stirn, wohlgeformte Lippen, feines Kinn, aber jetzt ein Ausdruck von Verwirrung und Scheitern im Gesicht. In ihrem Blick las er den Zustand Amirs und den Zustand eines jeden Mitglieds der Familie.
»Du bist verloren, Schwester, und ich, Amir, habe meine Überzeugungen verloren.«
Der Colonel wusste es, er wusste, dass sein Sohn dabei war, sich zu verwandeln, doch er weigerte sich, dies als Weg in den Irrsinn zu akzeptieren. Er sah Amir in Erstarrung und Leblosigkeit eintauchen, sah aber auch immer wieder Angst und Scham, Hoffnungslosigkeit und Scheitern in seinem Blick. Dann und wann aber konnte er Hoffnung schöpfen, wenn er durch die trüben Fensterscheiben Amirs Schatten bei der Arbeit an der Büste von Amir Kabir betrachtete. Das tut ihm sicher gut, dachte er. Und besorgt stellte er fest, dass sich die Abstände zwischen Amirs Albträumen immer weiter verkürzten.
Hätte er Amir vor den Besuchen des Khazar Djavid in seinem Haus warnen sollen? Der Colonel grübelte und machte sich Vorwürfe: »Seit Langem biete ich all meine Kraft auf, klaren Kopf zu bewahren und nicht auszurasten. Keine schlechte Nachricht, kein frisches Verhängnis soll mich überrumpeln. Obwohl, wenn ich Amir vor Khazar Djavids Besuch in unserem Haus gewarnt hätte, hätte ich vielleicht das Unglück verhindern, oder besser, es hinausschieben können. Doch meine Herren, mein Sohn war doch kein Kind mehr!
Habe ich eigentlich die Haustür abgeschlossen? Ja, ich kann den Schlüssel in der Manteltasche spüren. Aber habe ich wirklich abgeschlossen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Wie kann ich mich denn vergewissern? Diese Unsicherheit quält mich so …«
Dass er vor den beiden Beamten gehen musste, schien ihm selbstverständlich. Denn die Bestimmung war ihm bekannt: Ein Mensch, gegen den, aus welchem Grund auch immer, eine Klage vorliegt, der deswegen abgeführt wird, muss zwischen den beiden Beamten und ein kurzes Stück vor ihnen gehen. Diese Bestimmung war wohl überall und seit ewigen Zeiten gültig, und auch in Zukunft würde sich daran nichts ändern.
Ich werde mich nicht dagegen auflehnen, aber ich muss unbedingt wissen, ob ich die Haustür abgeschlossen habe! …
Der Colonel war nicht mehr so jung, dass ihn jedes ungeschriebene Gesetz aufbrachte und zur Rebellion reizte. Er hielt den Kopf gesenkt, blickte auf seine Schritte, sein Rücken hatte sich gekrümmt, er fühlte, dass die graue Hutkrempe sein Gesicht bis zur Nasenspitze überschattete, dass die Flügel seines Mantels, als seien sie länger geworden, mit ihren Spitzen hin- und herschwankend den Schlamm auf der Straße streiften.
»Hier lang, Colonel!«
Ja, richtig, ich muss dorthin laufen, wo die Beamten es wünschen …
Am Ende der Gasse angelangt, bogen sie in die Straße ein. Auch an dieser Kreuzung stand eines dieser unzähligen hell beleuchteten Denkmäler zum Gedenken an die Märtyrer und bestrahlte die ganze Kreuzung und noch ein gutes Stück der Straße. Danach gelangten sie zum Rathausplatz, an dessen Westseite sich die Staatsanwaltschaft befand. Vorbei an zwei Denkmälern in gleißendem Licht zu beiden Seiten des Eingangs betraten sie ein düsteres, kaum beleuchtetes Treppenhaus. Eine schwache Glühbirne, die an der Decke hing, konnte sich gegen das Dunkel kaum durchsetzen.
Das sind also ihre Sparmaßnahmen, dachte der Colonel. Vorsichtig und langsam nahm er Stufe um Stufe, denn sie waren vom regen Publikumsverkehr des vergangenen Tages noch nass und glitschig.
Der Colonel war, selbst in den Zeiten vor seiner Entlassung als Offizier, kein Freund von Glücksspielen und dergleichen Zeitvertreib gewesen. Auch Billard oder Bridge war nie seine Sache gewesen. Aber er wusste – obwohl er selbst nie einen Billardstock in den Händen gehalten hatte –, dass sich im obersten Stock dieses Gebäudes einst ein Billardsalon befunden hatte. Als er jetzt diesen Mann an einem großen, mit grünem Tuch bezogenen Tisch sitzen sah – wie sehr er doch meinem Schwiegersohn Ghorbani Hadjadj ähnelt! –, gewann er die Gewissheit, dass dieser Tisch ursprünglich ein Billardtisch gewesen sein musste, den die Staatsanwaltschaft requiriert hatte. Die beiden jungen Männer nahmen an den Seiten des Tisches Platz.
»Sie sind ein ehemaliger Offizier, Colonel?«
»Ja, ich war Offizier.«
»Wenn Sie den Leichnam selbst in Empfang nehmen und begraben wollen, müssen Sie eine Gebühr zahlen.«
»Selbstverständlich … Selbstverständlich.«
»Es ist schon alles vorbereitet. Zwei Beamte werden Sie bis zum Ende der Zeremonie begleiten. Bitte, gehen Sie dorthin …«
»Dort!«
»Ja … Ja … Ja … zu Befehl.«
Ich erwarte ja schon seit längerer Zeit keine guten Nachrichten mehr. Aber ist es zu viel verlangt, dass sie einem eine schlechte Nachricht nicht gerade in einer Situation überbringen, die denkbar die schlechteste ist? Was soll ich jetzt, mitten in der Nacht, tun? Aber natürlich wusste auch der Colonel, dass man diese späte Stunde gewählt hatte, damit die ganze Angelegenheit noch vor Sonnenaufgang erledigt werden konnte. Wer einen Funken Vernunft in sich hat, der begreift gewisse Dinge sofort, dem muss man nicht jede Kleinigkeit erklären. Es macht auch Sinn, den Beamten entgegenzukommen und sie nicht mit Fragen zu belästigen, deren Antworten man schon kennt. Der Colonel hatte verstanden, dass Parwanehs Beerdigungszeremonie still und geheim stattfinden musste und dass der erste Schritt bei der Zusammenarbeit mit den Beamten darin bestand, nicht einfach loszuheulen, sondern sich beherrscht, ruhig und würdevoll zu verhalten. Er handelte, wie er handeln musste. Ohnehin schlossen die dürren Worte und das sachliche Verhalten der Beamten jeden Zweifel und jeden Gedanken an Trauer aus. So war der Colonel, statt Gefühle zu äußern, eine ganze Weile verdutzt und erstarrt stehen geblieben.
Da er die Kasse nicht finden konnte, kehrte er zu dem Billardtisch zurück, holte ungeachtet der geschuldeten Summe sämtliche kleinen und großen Geldscheine aus seiner Brieftasche heraus und legte sie auf den grünen Tisch. Es schien, als sei die Akte geschlossen. Was jedoch den Colonel nicht in Ruhe ließ, war die Tatsache, dass er sich über das Billardspiel geirrt hatte. Denn vor dreißig Jahren – oder war das noch länger her? –, jedenfalls in den Jahren vor der Bewegung zur Nationalisierung der Ölindustrie gegen England, war er an einem Herbstnachmittag, in Begleitung eines Kollegen, der später hingerichtet wurde, zu einem Billardsalon gegangen. Beide waren Leutnants. Sie hatten sich zum Stadtbummel auf der Lalehzar-Straße getroffen. Der Kollege hatte ihn zu ein oder zwei Runden Billard aufgefordert. Der Colonel hatte keine Ahnung von den Spielregeln, daher verlor er das Spiel. Doch der Salon, die vielen grün bezogenen Tische, die gedämpften Geräusche, die bunten Bälle, das schön geformte Dreieck, die leichten, gut gespitzten Stöcke, die Kreidestücke, die leeren Limonadeflaschen und schließlich die Bemerkung seines Freundes, das Spiel stamme aus Russland, waren ihm in Erinnerung geblieben. So ging er auf den Mann zu, der am Tisch saß, und als wollte er ein Geständnis ablegen, sagte er:
»Ich habe mich geirrt, ja, ein Irrtum, ich bitte um Verzeihung. Ich hatte vergessen, dass ich einmal in meinem Leben Billard gespielt habe.«
»Wie meinen Sie das, mein Herr?«