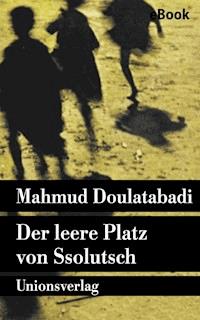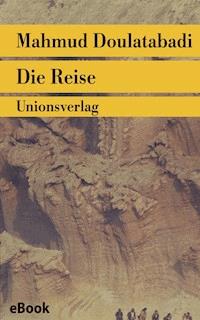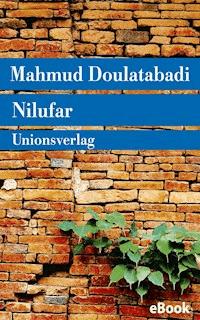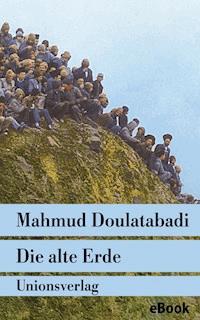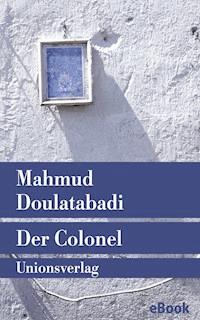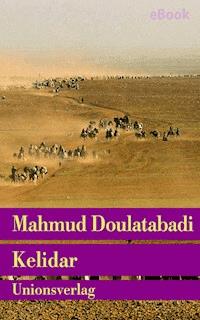
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Stamm der Kalmischi weiß keinen Ausweg mehr. Die Herden werden von der Seuche dezimiert, die Steuereintreiber bedrängen sie, die Blutrache droht. Da ziehen die Männer und Frauen in die Berge. Weil sie sich über jedes Gesetz stellen und zu Räubern werden, beginnen die Legenden um sie zu wachsen. Heimlicher Held dieses Romans ist das Land Chorassan, die Wiege der nomadischen Kultur, mit seinen Steppen, Bergen und Naturgewalten, seinen uralten Städten, geduckten Dörfern, stolzen Zeltsiedlungen und seinen Menschen, die durch große Gefühle und ungestüme Leidenschaften verkettet sind. »Kelidar«, so Mahmud Doulatabadi, »ist ein Buch der Liebe: Liebe zwischen Mann und Frau, die Liebe zwischen Freunden, die Liebe des Menschen zur Erde und zur Natur, zwischen Mensch und Tier. «
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1145
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Stamm der Kalmischi weiß keinen Ausweg mehr. Die Herden werden von der Seuche dezimiert, die Steuereintreiber bedrängen sie, die Blutrache droht. Da ziehen die Männer und Frauen in die Berge. Weil sie sich über jedes Gesetz stellen und zu Räubern werden, beginnen die Legenden um sie zu wachsen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Mahmud Doulatabadi (*1940) gilt als bedeutendster Vertreter der zeitgenössischen persischen Prosa. Er arbeitet als Schriftsteller und Universitätsdozent für Literatur in Teheran.
Zur Webseite von Mahmud Doulatabadi.
Sigrid Lotfi lebte in Deutschland und im Iran. Sie hat an der Universität Göttingen promoviert und zahlreiche Werke aus dem Persischen übersetzt. Sie starb 2014 in Teheran.
Zur Webseite von Sigrid Lotfi.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Mahmud Doulatabadi
Kelidar
Roman
Aus dem Persischen von Sigrid Lotfi
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien in zehn Bänden zwischen 1978 und 1983 unter dem Titel Kelidar in Teheran.
Originaltitel: Kelidar (1978–1983)
© by Mahmud Doulatabadi 1978
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Nasrolah Kasraian
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30511-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 21:31h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KELIDAR
Erstes Buch – Erster TeilI – Kurden haben die Einwohner von Chorassan schon häufig …II – Die Nacht zerbarst, die Dämmerung brach an …III – Morgengrauen. Leichter Wind der Dämmerung von NischaburZweiter TeilI – Dicht beieinander galoppierten die fünf Reiter im Maruss-Tal …II – Ein erster Hahnenschrei zum Auftakt. Chan-Amu warf einen …III – Als Madyar auf der Welt war, hatte Beyg-Mammad …Dritter TeilI – Die Kalmischis trafen alle zusammenII – Der Tierarzt war ein guter Mann. Heiter und …III – Im Dorf Abdollah-Giw, am Ende der Gendarmerie-Gasse …Vierter TeilI – Mit jedem Atemzug setzte Ssougi den Fuß in …II – Nade-Ali zittert am ganzen Körper. Ein heimliches Zittern …III – Ist denn das eine Art, Mah-Derwisch? Ist das …Fünfter TeilI – Scher dich weg, du Tölpel! Hältst du dich …II – Ein Mann stand wie ein langer Schatten auf …III – Hinter den dichten Schichten des Windes kamen die …IV – Der Wind der Kawir wehte und wirbelte kräftiger …Zweites Buch – Sechster TeilI – Tamarisken: Rand der meilenweiten Ausdehnung der Kawir …II – O Erde, tanze – Gott ist zu dir …III – Der Himmel war noch bedeckt. Ein Rest vom …IV – Wie verbrachte Siwar die NachtV – Wo der Wind herrschte, hatten die kleinen Regentropfen …VI – Nade-Ali auf seinem Schimmel und Gol-Mammad und Mandalu …VII – Der Morgen von SsabsewarSiebter TeilI – Auf halbem Wege zwischen Saferani und Galeh Tschaman …II – Gadir … Gadir …, du Unmensch, du Ketzer …Achter Teil – Unsere Männer sind in der Steppe!«WorterklärungenDie wichtigsten PersonenZur Aussprache persischer WörterMehr über dieses Buch
Über Mahmud Doulatabadi
Über Sigrid Lotfi
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Mahmud Doulatabadi
Zum Thema Iran
Zum Thema Asien
Zum Thema Nomaden
Erstes Buch
Erster Teil
I
Kurden haben die Einwohner von Chorassan schon häufig gesehen; oft sind sie mit ihnen in Berührung gekommen, in angenehme und unangenehme. Doch warum sie jetzt so gebannt auf Maral schauten, das wussten sie selber nicht.
Maral, das Kurdenmädchen, hatte sich den Zügel ihres schwarzen Pferdes über die Schulter geworfen und ging, den Nacken fest und gerade aufgerichtet, mit großen Schritten selbstbeherrscht und ruhig auf das Polizeirevier zu. Ihre Wangen waren gerötet. Alte Messingmünzen hingen vom Saum ihres Kopftuchs in die Stirn und das runde, erhitzte Gesicht und pendelten bei jedem Schritt weich um ihre Wangen und Augenbrauen. Ihre vollen Brüste traten deutlich hervor: zwei ungeduldige Tauben, die aus dem Kragen auffliegen wollten. Die Enden von Marals Kopftuch verdeckten die Brüste, die bei jeder Bewegung wippten, und ihr langer, weiter Rock schwang bei jedem Schritt im Gleichtakt mit dem Wippen der Brüste um die bestrumpften Waden. Marals Augen blickten unverwandt geradeaus, ihre Blicke flogen über die Köpfe der Vorübergehenden hinweg, die hübschen Lippen waren fest verschlossen. Sie schritt aus wie ein Held, der erhobenen Hauptes aus dem Kampf zurückkehrt. Auch ihr Rappe Gareh-At hatte seinen Hals so gewölbt, reckte die Brust und setzte seine Hufe so stolz aufs Straßenpflaster auf, als erweise er der Erde eine Gnade und fühle sich über alles ringsum erhaben.
Einem Moritatensänger, der seine Bildtafel an die Mauer gehängt hatte, stockte die Stimme, denn alle seine Zuhörer hatten ihr Auge von seiner Bildtafel und das Ohr von seiner Stimme abgewandt; sie schauten dem schwarzen Pferd und dem Mädchen nach und lauschten dem würdevollen Klopfen der Pferdehufe auf dem Straßenpflaster, bis der Sänger laut seinen Vortrag wieder aufnahm, um die Aufmerksamkeit der Leute erneut auf sich zu lenken.
Maral blieb vor dem Gebäude stehen, über dessen Portal eine Fahne wehte, und wandte sich an den Polizisten, der im Schilderhaus neben dem Tor stand: »Bruder, ich muss zu meinem Bräutigam und zu meinem Vater. Es wird jetzt ein Jahr, dass sie im Gefängnis sitzen. Bist du so gut, mir den Weg zu zeigen?«
Der junge Polizist sah mit seinen glänzenden Augen das Kurdenmädchen und den Rappen, der sein Maul über die Schulter des Mädchens hielt, genauer an und sagte: »Mit deinem Pferd kannst du aber nicht in den Hof gehen. Du musst das Pferd irgendwo anbinden.«
»Wenn du mir versprichst, darauf aufzupassen, binde ich seinen Zügel an den Baum da.«
»Dass du aber nicht zu lange wegbleibst, denn in einer halben Stunde ist meine Wache vorbei.«
Maral zog ihr Pferd zum Weidenbaum, band den Zügel um den mageren Stamm, nahm die Satteltasche aus festem Stoff von der Kruppe des Pferdes, warf sie sich über die Schulter, streifte das Gesicht des Polizisten mit einem freundlichen Blick und trat in den Torweg, der unter einem halbmondförmigen Gewölbe zum Hof führte. Maral blieb einen Augenblick stehen und sah sich den Hof an, der sich vor ihr ausbreitete: mit Ziegelsteinen gepflasterter, feuchter Boden, in der Mitte ein Wasserbecken, einige Zimmer auf einer Seite, hohe Lehmmauern und Schatten, eine Gruppe Männer und Frauen, die wartend in einer Ecke nahe der Treppe standen. Auf der Veranda oberhalb der Treppe saß hinter einem alten Tisch ein Unteroffizier, der ein Messingschild auf der Brust hängen hatte; mit einem weißen Taschentuch wischte er sich den Schweiß von seinem fetten Nacken. Als er Maral dort stehen sah, rief er ihr von Weitem zu: »He … Mädchen, was willst du? Komm hierher!«
Maral sah ihn an und setzte sich in Bewegung; entschlossenen Schrittes stieg sie die Treppe hinauf, blieb auf der Veranda neben dem Tisch des Diensthabenden stehen und sagte: »Meinen Bräutigam und meinen Vater will ich sehen.«
Der Diensthabende – er hatte ein weißes, gedunsenes Gesicht, hennagefärbtes, weiches Haar und einen Schnurrbart – sah Maral aufmerksam und länger als nötig an und fragte schließlich: »Haben die keinen Namen? Wie heißen sie?«
»Delawar und Abduss. Mein Vater heißt Abduss, mein Bräutigam Delawar.«
»Ich weiß, wen du meinst. Vom Kurdenstamm der Tupkalli!«
»Nein, Bruder. Vom Stamm der Mischkalli. Aus Dahneh-ye Schur. Aus der Gegend von Ssar-Tscheschmeh. Zuerst waren sie im Gefängnis von Nischabur.«
»Und wie heißt du? Was soll man denen sagen, wer gekommen ist?«
»Maral. Die Maral von Abduss. Ich komme gerade vom Berg Kelidar.«
»Schön, stell dich da zu den Frauen; ich sag dann, man soll sie rufen.«
Maral ging zur Ecke und gesellte sich zu den wartenden Leuten; aus den Augenwinkeln beobachtete sie den Unteroffizier, der einen Polizisten zu sich winkte, ihm einen Zettel gab und sagte: »Sag, sie sollen schneller aufrufen, die Zeit ist knapp.«
Nachdem er das gesagt hatte, blickte der Unteroffizier das Kurdenmädchen an. Maral senkte den Kopf, wandte das Gesicht ab, nahm die Satteltasche von der Schulter und lehnte sich an die hohe Hofmauer. Ein frischer Luftzug stieg vom mit Wasser besprengten Boden auf, und der Geruch drang Maral in die Nase. Der Geruch der alten Lehmmauer, der Geruch der feuchten Ziegel, der Geruch der sommerlichen Schatten, der Geruch des abgestandenen grasgrünen Wassers im Becken, das von einer Schicht Wasserlinsen überzogen war, der Geruch der Blätter von Granatapfel- und Quittenbaum, der Geruch der fremden Menschen und der Fremdheit überhaupt – alle diese Gerüche stiegen Maral in die Nase und weckten in ihr ein neues Gefühl.
Die Leute, wie sie da in einer Ecke zusammengedrängt standen und jeder seinen mageren Hals in eine andere Richtung bog, erinnerten Maral an eine vor Hitze schmachtende Gruppe von Schafen, die von der Herde abgetrennt und in einem Stall als Pfand zurückbehalten wurden. Verwelkt und bekümmert waren sie, von einem jeden Gesicht konnte man irgendwelche Sorgen ablesen. Ein vertrockneter Städter in einem weißen Hemd aus Kunstseide mit aufgekrempelten Ärmeln, mit Handgelenken dünn wie Stiele, aschgrauen Lippen und grauem Haar saß auf der Treppe zur Veranda und rauchte. Eine alte Bäuerin saß in Gedanken versunken auf dem Boden, den Rücken an die Mauer gelehnt. Eine junge Stadtfrau mit mondblassem Gesicht saß auf einer Stufe, hatte sich ihr Kind auf die Knie gelegt und wiegte es sachte. Etwas weiter entfernt beim Blumenbeet stand ein lang aufgeschossener Polizist im Schatten der hohen Mauer und besah einen am Ast hängenden Granatapfel.
Maral wurde aufgerufen: »Dorthin! Durch die Tür da.« Sie hob die Satteltasche auf, warf sie sich über die Schulter und setzte den Fuß auf die Treppe, als der Polizist vortrat und ihr die Satteltasche abnahm: »Das ist verboten, Schwester. Leg sie hierhin.«
Maral blickte ihn zögernd an: »Versprichst du mir, ihnen die Sachen auszuhändigen, Brüderchen?«
Die Andeutung in Marals Worten ärgerte den Polizisten. »Glaubst du, unsereins hat noch keinen Gurmast gesehen? Los, trödle nicht! Die Zeit ist knapp.«
Das Schimpfen des Polizisten erschreckte Maral nicht, aber irgendwie schämte sie sich über ihr eigenes Verhalten. Den Zettel, den sie vom Polizisten erhalten hatte, steckte sie ein, setzte sich neben die Satteltasche, holte daraus ein in Tuch eingeschlagenes Brot, den schwarzen Lederbeutel mit Gurmast und das Sahnetöpfchen hervor und vertraute alles dem Polizisten an. Ihr Schamgefühl überwindend, musterte sie ihn nochmals, so als wolle sie seinen Augen die Gewissheit entnehmen, dass er das ihm Anvertraute auch heil und sicher abliefern werde. Und als wolle sie sich die Merkmale seines Gesichts einprägen, um ihn bei einem Versehen wieder erkennen zu können: ein kurzer Schnurrbart unter den Löchern der spitzen Nase, eine große Warze auf der Unterlippe, eine Narbe auf der linken Wange, braune Augen in den Höhlen unter der Stirn und die zwei Striche der Augenbrauen, weich wie Katzenfell.
Unter dem forschenden, wachsamen Blick des Kurdenmädchens nahm der Polizist Brotbündel, Beutel und Töpfchen an sich, trug sie in eine andere Ecke des Hofs zu einer grünen, schmutzigen Tür – dem Haupteingang des Gefängnisses –, reichte eins nach dem andern unter Namensnennung durch eine Klappe und sagte noch einmal laut: »Für Delawar und Abduss.«
Als Maral die Namen der Ihren hörte, beruhigte sie sich und schöpfte Hoffnung, dass ihr Vater und Delawar Sahne und Brot und Gurmast erhalten würden. So setzte sie sich wieder hin, knotete die Bänder der Satteltasche zu, hob die Tasche auf, trug sie zu dem Polizisten, der am Granatapfelbaum stand, legte sie an die Mauer und sagte: »Bis ich zurückkehre, vertrau ich sie dir an, Bruder.«
Der lang aufgeschossene Polizist schüttelte nachlässig den Kopf; ein farbloses Lächeln umspielte seine Lippen; er sagte: »Geh die Treppe hinauf, zur Tür da. Dort sind sie.«
Maral dankte ihm und ging die Treppe hinauf. Sie durchquerte die Veranda und kam zu einer ausgeblichenen Tür. Sie blieb stehen, fasste den Türgriff und drückte ihn ungeduldig. Die Tür öffnete sich nicht. Maral drehte sich um und schaute suchend umher. Der Mann im weißen kunstseidenen Hemd kam die Treppe herauf und blieb vor der Tür, dicht neben ihr, stehen.
Maral drückte noch immer den metallenen Griff und blickte den Mann hilflos an. Ein schlaues Lächeln zuckte unter seiner ausgedörrten Gesichtshaut – anstelle des Nomadenmädchens nahm er den Griff in die Hand und drehte ihn. Die Tür öffnete sich, der Mann ging hinein, und bevor die Tür sich wieder schloss, folgte Maral ihm nach.
Zwei große, nebeneinanderliegende Räume mit Bänken an den Wänden und einigen Stühlen um zwei Pfeiler. Ähnlich wie ein Teehaus, aber kahl und schmierig und mit dem Bild des jungen Schahs an einer Wand. Überall waren da Leute, zweifellos Häftlinge und deren Angehörige. In allen Ecken saßen Grüppchen von Kindern, alten und jungen Frauen und Männern beisammen auf Boden oder Bänken, hatten ihre so lang entbehrten Lieben in die Mitte genommen, blickten sie an und unterhielten sich. Einige aßen auch Obst: Weintrauben, Aprikosen, Wassermelonen. Ein paar Männer rauchten Zigaretten. Kinder krochen auf dem schmutzigen Fußboden herum, und ein von seiner Untätigkeit ermüdeter Polizist ließ einen Dreikäsehoch mit seiner Stiefelspitze spielen.
Maral war unschlüssig an ihrem Platz stehen geblieben, ihre Blicke schweiften verwirrt in alle Richtungen. Der Polizist fragte sie, wen sie suche. Maral antwortete: »Delawar und Abduss.« Der Polizist führte sie durch die sitzende Menschenmenge zu einem in die Wand eingesetzten kleinen Fenster, das noch geschlossen war, und sagte, sie solle dableiben, bis sie kämen. Maral lehnte sich mit der Schulter an die Wand, wartete vor dem geschlossenen Fenster und dachte, dass es richtig sei, ihren Angehörigen nicht zu erlauben, auf diese Seite zu kommen. Abduss und Delawar und Radjab Keschmir hatten den Verwalter von Herrn Maleks Grundbesitz in Dahneh-ye Schur mit Stöcken so geschlagen, dass er sich nicht mehr vom Boden erhob, und obendrein seinen Maulesel gestohlen. Das war ihr Verbrechen, und es wog schwer.
Das Fenster öffnete sich; dahinter sah Maral Ärmel, Stirn und Mützenrand eines Polizisten vorübergleiten. Gleich darauf erschienen Abduss und Delawar am Ende eines engen Korridors. Abduss hielt den Kopf gesenkt, Delawar blickte vor sich hin. Sie kamen näher und blieben vor dem Fenster stehen, beide, Schulter an Schulter.
Delawar war vierschrötig und untersetzt. Seine kleinen hellbraunen Augen waren etwas eingesunken, aber das Leben in den Pupillen war noch das gleiche wie früher. Der Schnurrbart und das, was von seinen Haaren zu sehen war, waren frisch gekämmt; das glatt rasierte Gesicht, die kräftigen Handgelenke, der Flaum, der wie haariger Filz seine Unterarme bedeckte, die niedrige Stirn und die breiten Augenbrauen, die Einschnitte an den Spitzen der Ohrläppchen – all das war Delawar, wie er leibte und lebte. Aber die Gesichtsfarbe war nicht Delawars sonnenverbrannte Gesichtsfarbe. Als Delawar im Freien lebte, hatte sein Gesicht die Farbe von Platanenrinde, war nicht schattenfarben. Die dunklen, grauen, festen Wangen Delawars, sie hatten unter dem ewigen Schatten des Gefängnisses gelitten. Ach … Maral möchte sich für dich opfern, Delawar!
In Delawars Blick jedoch lag wie immer Glanz, Freundlichkeit und Aufrichtigkeit. Und die Gelenke seiner Finger waren fest geblieben. Nein, noch saß der Ring an Delawars Finger nicht lose. Seine Nägel waren lang wie eh und je, aber unter den Nägeln war es weiß und nicht mehr schwarz und schmutzig. Ganz offensichtlich gibt es in der Stadt – und auch im Gefängnis – mehr Wasser als in den Steppen von Doweyn, in Dahneh-ye Schur und in der Maruss-Ebene. Der Kragen seines hellblauen Hemdes war geschlossen, sein rotes Seidentuch hatte er – wie üblich – um den Hals geknotet, den Gürtel umgebunden. Aber seine Füße waren jetzt bloß. Als er noch in der Steppe hinter der Herde herging, trug er klobige Lederschuhe, Halbstiefel oder Stoffschuhe mit verstärktem Rand. Die Manschette eines Ärmels war offen. Bestimmt war der Knopf abgegangen. Sonst wäre es ja nicht möglich, Delawars Handgelenk zu sehen. Als er noch hinter der Herde ging, hatte er die Manschetten geschlossen. Hier waren seine Lippen geschlossen.
Die Lippen waren ausgetrocknet, wie zugenäht. Allein seine Augen waren es, die sprachen und schwiegen. Sie sprachen und schwiegen. Beide, Delawar und Maral, standen schweigend und traurig einander gegenüber. Waren denn ihre Zungen verknotet? Nein, Marals Zunge war frei, aber es hatte ihr die Worte verschlagen. Ihre Lippen waren wie abgestorben, ihre Stimme erstickt. Ein Gefühl, als sei ihre Brust angefüllt mit Worten, die ihr bisher fremd gewesen waren, drohte sie zu ersticken: Worte, von denen sie genau wusste, dass sie bis zu diesem Augenblick in ihrem Innern nicht existiert hatten. Eine Fülle von Worten. Seltsame Ausdrücke. Das, was eben jetzt, in diesem Augenblick, ausgesprochen werden möchte, kann sie nicht aus dem Käfig der Brust befreien. Sie müsste sagen: ›Ich bin gekommen, euch beide zu sehen. Guten Tag. Lasst die Köpfe nicht hängen!‹ Doch diese Worte erschienen Maral merkwürdig, sie konnte sie nicht über die Lippen bringen. Ihre Kehle war wie mit einem Knäuel Ziegenhaar verstopft.
Die trockene, bekümmerte Stimme ihres Vaters Abduss zerbrach die verschlossene, schmerzerfüllte und zugleich betörende Atmosphäre, die zwischen Maral und Delawar herrschte: »Wo ist jetzt das Lager, dass du hierherkommen konntest?«
Nun brachte Maral es fertig, sich dem Vater zuzuwenden und ihm ins Gesicht zu blicken.
Obwohl Abduss hinter dem Fenster stand und seine Schultern gebeugter waren als früher, war er doch immer noch einen Kopf größer als Delawar. Eine große Nase, knochige Schläfen, graublaue Augen – wie der Himmel bei Morgengrauen –, in die Höhlen eingesunken. Hervortretende Halsadern, stachelige, grau melierte Bartstoppeln, lange Arme und ein Blick wie der eines Pferdes: ruhig und voll. Er selbst war es, dieser Hirte vom Stamm der Mischkalli, der die Herde der Tupkalli geweidet hatte und im Jahr des vielen Schnees, im Jahr vor der Teuerung, eine Wölfin am Abhang des Doberaran-Berges zu Boden gestreckt und den Widder der Schwiegertochter von Ferad Chan aus ihrem Maul gerettet hatte. Die Narbe auf dem Rücken seiner linken Hand war ein Andenken an die Zähne der Wölfin.
Maral senkte den Kopf; sie konnte nicht in die verdunkelten, leidgeprüften, sorgenvollen Augen des Vaters schauen. Abduss’ Blick sprach von einer lebenslangen Verlassenheit, die Maral vertraut war. Maral wusste, dass ihr Vater Kurde, ihre Mutter, Mahtou, Balutschin war; sie stammte von den Balutschen, die hinter der Bergkette des Kuh-e Ssorch bei dem Ort Tschah-Ssuchteh verstreut lebten. In einem Dürrejahr vor der Teuerung war sie von ihrem Stamm fortgegangen, unterwegs auf die Sippe der Mischkalli gestoßen und hatte dort als Magd gearbeitet, so lange, bis sie in all ihrer Armut zur Frau herangereift war und ihr Begehren auf Abduss fiel. Liebe. Diese unvergängliche Kraft, die weder Sklaven kennt noch Herren. Ein Gut, das jeden Menschen würdig und einzigartig macht. Auch aus dem Kragen der Armut streckt die Liebe den Kopf hervor. Abduss hatte mit helfender Hand Mahtous Hand ergriffen, und Mahtou war seine Braut geworden. Seinen Angehörigen war das ein Dorn im Auge. Wie kann ein stolzes Herz ertragen, dass Abduss sich eine Balutschenmagd zur Frau erwählt! Sie hatten Abduss verstoßen, fortgejagt, und Abduss hatte Mahtou bei der Hand genommen und war zu den Tupkalli gegangen. Aber: Wer sich von seinen Angehörigen losreißt, kann nicht in einem fremden Zelt Fuß fassen. Wenn er noch im Kindesalter steht, wird er zum Knecht gemacht, wenn er ein Jüngling ist, hat er das Glück, Gehilfe eines Hirten zu werden. Und wenn er erwachsen ist, wird er ein Hirte. Aber so leicht ist das nicht, zuvor muss er das Misstrauen seiner Umgebung überwinden. Abduss war jedoch ein schmucker Bursche und wusste mit Schafen umzugehen. Auch bestand kein Argwohn ihm gegenüber; seine Frau blieb ja beim Stamm, ein Pfand für die Herdenbesitzer. Die Tupkallis nahmen ihn gerne als Tagelöhner auf. Ein flinker Mann für die Arbeit in der Steppe.
Eines Nachts kehrte Abduss von der Herde zu seinem schwarzen Zelt zurück und sah, dass Mahtou ihm eine Tochter geboren hatte. Die Frauen des Lagers hatten dem Mädchen den Namen Maral – Reh – gegeben. Möge sie den Ihren Glück bringen! Kein Zweifel, Maral gehörte diesem Stamm und diesen schwarzen Zelten an, denn hier war sie auf die Welt gekommen.
Danach hatte Abduss mit der Kraft seiner doppelten Liebe, seiner Liebe zu Maral und Mahtou, den Gürtel fester geschnallt und war Tag und Nacht, ohne je zu erlahmen, ohne je zu ruhen, mit der Herde gegangen. Die Berge, Täler und Steppen von Chorassan hatte er durchstreift: von Taghi bis Ssarachss, von Pol-e Abrischom und Ssangssar bis Dahneh-ye Schur und bis jenseits des Berges Kuh-e Ssorch. Er hatte geprügelt, war geprügelt worden, hatte seine Tiere geweidet, hatte gestohlen, war bestohlen worden, hatte gekauft, hatte verkauft, und nach tausenderlei Fehlschlägen und Erfolgen war es ihm gelungen, die Zahl seiner Schafe von einem auf fünfzig zu erhöhen, eine halbe Spanne tief im fremden Stamm Wurzeln zu schlagen, Besitzer einer grau-weiß gefleckten Stute zu werden, einen ledernen Behälter für Butter und einen anderen für Joghurt sein Eigen zu nennen, ein größeres Zelt aufzuschlagen, einen Hund an die Kette zu legen, einige Kelims und kleine Teppiche und Bettzeug anzuschaffen und ein Reitkamel zu kaufen.
Maral war unterdessen herangereift und hatte die Augen des Lagers auf sich gezogen. Der Neffe von Nayram Chan hatte um sie angehalten. Doch Abduss hatte eingewendet: »Ihr gehört zu den Großen, wir zu den Kleinen. Wir sollten das nicht tun. Besser ist es, wenn wir uns mit unseresgleichen verbinden, ihr mit euresgleichen.« So war Maral mit Delawar, dem Hirten, verlobt worden. Denn Delawar war vom gleichen Schlag wie Abduss. Er stand allein, hatte keine Angehörigen, war tüchtig und aufrichtig. Er war kein Blutsverwandter – aber was macht das schon? Ein Draufgänger war er, reinen Herzens, zielstrebig, der Arbeit hingegeben. Mehr braucht ein Mann nicht. Er stammte aus dem Dorf Galeh Tschaman. Noch als Junge war er von zu Hause fortgelaufen, hatte sich den Kurden angeschlossen, bei ihnen als Knecht gearbeitet, und, zum Jüngling geworden, war er zusammen mit Abduss hinter der Herde hergezogen. Das Barthaar war ihm gewachsen, über alles, was Schafe betraf, wusste er nun genau Bescheid. Aber die Verbindung mit Maral war für Delawar mit Schwierigkeiten verbunden. Vor allem flößte Maral ihm Angst ein, Angst wegen den Stammesführern der Tupkalli. Angst vor Nayram Chan und seinem Neffen. Eine Angst, die von Tag zu Tag größer wurde. Dieses Feuer schwelte unter der Asche bis zu dem Tag, als Nayram Chan drei seiner Hirten – Abduss, Delawar und Radjab Keschmir – ausschickte, seine Tiere auf den Weideplätzen von Malek Achlamadi ohne Bezahlung der Wassergebühr grasen zu lassen. Sie zogen los, trieben die Herde an, sie ergoss sich über die Weide. Der Verwalter von Hadj Abdol Malek Achlamadi tauchte auf. Die Zündschnur glomm bereits. Achlamadis Verwalter zog seine Ardakaner Kette aus der Tasche, schlug damit auf Mäuler und Köpfe der unschuldigen Schafe ein und stieß Flüche aus. Flüche gegen alle. Gegen Groß und Klein der Tupkalli-Sippe. Dem Verwalter war der Rücken gedeckt, aber die Kurden konnten die bitteren Worte nicht gut mit heimnehmen. Die Schlägerei ging also los. Die Männer stürzten sich aufeinander, Delawar zielte mit dem Stock auf die Halsschlagader des Verwalters, traf aber dessen Schläfe; er stürzte zu Boden, überschlug sich, seine Arme und Beine zuckten, und kurz darauf streckte er sich aus und war tot. Die drei Schäfer wurden zuerst zur Gendarmerie, dann ins Gefängnis geschleppt.
Gerade zu dieser Zeit begann das Jahr der Dürre, begleitet von einer Viehseuche: Leberfäule. Die Pflöcke der schwarzen Zelte wurden aus dem Boden gezogen, und die Nomaden, heimatloser denn je, machten sich auf den Weg zu weit entfernten Steppen. Abduss verlor all sein Hab und Gut. Die Viehseuche wütete gnadenlos. Mahtou wurde krank vor Kummer, wurde bettlägerig, sodass man sie unterwegs auf ein Reittier binden musste, und Maral …
»Hast du die Mutter nicht mitgebracht?«
Das fragte Abduss, und bei seinen Worten überströmte Maral eine Woge von Gift und Schmerz, die Glieder zitterten ihr, ihre Wangen, ihr Kinn zuckten, ihre Arme erschlafften, und sie wandte den Blick von Abduss ab. Nein, Maral konnte nicht die Wahrheit sagen. Die Seuche war über die Schafe hereingebrochen, hatte alles, was Delawar und Abduss besaßen, hinweggerafft. Die Nachricht vom Tode Mahtous wäre für Abduss ein zu harter Schlag. Mit welchen Worten kann man das sagen? Maral wand sich in innerer Bedrängnis, bäumte sich auf, zügelte sich dann, um aus dieser Not einen Ausweg zu finden. Mit Schmerz in der Stimme, in den Augen, im ganzen Antlitz, sagte sie: »Sie ist krank geworden. Ich habe sie nach Ssusandeh gebracht, ins Haus von Tante Belgeyss.«
Der Name von Belgeyss, das Haus der Tante und Ssusandeh waren für Abduss schon lange tief in alten Erinnerungen versunken, hatten nur schwache Spuren hinterlassen, erstaunlich hierin war eigentlich, dass diese Spuren nicht ganz verweht waren. Ssusandeh: niedrige, sehr niedrige Mauern. Niedrige, sehr niedrige Türen. Niedrige, sehr niedrige Dächer. Abduss war noch ein Kind, als der Stamm der Mischkalli beschloss, Ssusandeh auf dem Weg zu ihren Sommer- und Winterweiden zu errichten. Ein Lagerplatz zwischen zwei Zielpunkten. Ein Zufluchtsort, um einen Augenblick zu rasten. Und damit jene, die das wollten, Körner für den Trockenanbau aussäen konnten. Ein fester Fleck für eine Nacht, für eine halbe Nacht. Tausend Dinge können sich ereignen. Warum sollte der Stamm nicht, entfernt vom Zeltlager, eine Stätte zum Ausruhen haben? Einen Platz nahe der großen Landstraße. Zwischen Nischabur und Ssabsewar, den beiden Zentren für den Kauf und Verkauf von Wolle, Häuten, Därmen und Vieh. Hadj Passand machte den Anfang, seine Verwandten taten sich zusammen, kauften den Boden mit seinem kleinen Quellwasserlauf und machten sich ans Bauen.
Zu dieser Zeit lief Abduss noch mit nacktem Hintern herum und formte aus dem Lehm, der für die Fundamente bereitet worden war, kleine Kamele. Belgeyss war ein wenig älter als er und trug schon einen langen schwarzen Rock. Gol-Andam war das älteste der Geschwister, sie war gerade mit Hadj Passand verlobt worden. Und Madyar war noch jünger als Abduss, sodass sich Abduss nicht mehr erinnern konnte, wie er damals ausgesehen hatte. Seit Abduss das Lager verlassen hatte, war er nur ein einziges Mal nach Ssusandeh zurückgekehrt – beim Tod seiner Mutter Gol-Chatun. Danach hatte er nicht mehr an seine Leute gedacht. Seine Leute hatten auch nicht an ihn gedacht. Jetzt, wo Maral im Begriff war, zu seinen Verwandten zu gehen, zu Verwandten, die sie nicht kannte, wurde Abduss von zweierlei Gefühlen hin- und hergerissen: Kummer und Stolz. Bekümmert war er darüber, dass er gescheitert war, dass es ihm nicht gelungen war, die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, zu Ende zu führen; dass er im Gefängnis saß, seine Schafe zugrunde gegangen waren, Frau und Tochter bei einem fremden Stamm allein zurückgeblieben und nun, obdachlos geworden, gezwungen waren, zum Lager seiner väterlichen Sippe zu gehen. Stolz war er darauf, dass es noch ein Lager, eine Sippe und eine Verwandtschaft gab, die seinen Leuten Zuflucht gewähren konnten. Diese Erkenntnis ließ in seinem Herzen eine Woge von Freude, Zuneigung, Anhänglichkeit, Ehrerbietung seiner Sippe gegenüber aufsteigen und verlieh seinem Dasein neue Frische: das Gefühl, auch wenn er selbst nicht da ist, in seinen Blutsverwandten zugegen zu sein, auch wenn er stirbt, in den andern weiterzuleben. In seinem Herzen regte sich plötzlich die Sehnsucht nach seinem Bruder Madyar und seiner Schwester Belgeyss, und die Erinnerung an das lebhafte Temperament der ältesten Schwester, Gol-Andam, erwachte wieder in seiner Seele …
Abduss schaute seiner Tochter in die Augen: »Es ist gut, dass du zu deiner Tante gehst, es ist auch gut gewesen, dass du hierhergekommen bist. In den letzten Nächten habe ich schlechte Träume gehabt. Vorgestern Nacht träumte ich, wie du mit Mahtou auf eine leere, trockene Ebene zugingst. Niemand begleitete euch. Die Höllensonne ritt auf dem Rücken der Wüste … Ihre Krankheit ist doch wohl nicht schwer? … Wo ist jetzt das Lager?«
»Beim Berg Kelidar.«
»Wann bist du vom Lager aufgebrochen?«
»Gestern, nach Mitternacht.«
»Wenn du dich jetzt auf den Rückweg machst – wann wirst du im Lager eintreffen?«
Maral schwieg. Einen Augenblick später sagte sie: »Ich bin hergekommen, euch zu sagen, dass ich nicht mehr mit denen weiterziehen will.«
Delawar und Abduss wandten sich einander zu und sahen dann beide Maral an, als wollten sie Maral mit ihren Blicken auffordern, ihnen alles rückhaltlos zu erzählen. Was war geschehen? Maral konnte die Tränen, die schon in ihren Augen glänzten, nicht länger zurückhalten. »Ich bin gekommen, euch zu sagen, dass ich im Lager niemanden mehr habe, mit dem zusammen ich weiterziehen könnte.«
»Ist Gareh-At auch tot?«
Delawar hatte diese Frage ganz plötzlich gestellt. Maral antwortete: »Nein, er ist bei mir.«
Die heimliche Erregung in Delawars Gesicht legte sich. Was hätte er getan, wenn auch Gareh-At eingegangen wäre?
Gareh-At war ein junges Pferd, dem erst kürzlich zum ersten Mal der Sattel aufgelegt worden war. Delawar hatte es Maral geschenkt und gesagt: »Gareh-At ist mein Augapfel, ich schenk ihn dir.« Und dann hatte er das ungebärdige Tier, das nur seinen Herrn an sich heranließ, an Maral gewöhnt.
Maral wandte den Blick von Delawar und schaute den Vater an. Abduss hielt den Kopf gesenkt und war in Gedanken versunken. Das ließ sich an den Falten auf Stirn und Schläfen ablesen. Das Mädchen merkte, dass es unvorsichtig gewesen war zu sagen: »Ich hab im Lager niemanden mehr.« Diese Worte hatten Abduss erschüttert. Woran denkt Abduss jetzt? Welchen Sinn sucht er hinter diesen Worten? Ein Mann, der sich im Wind verirrt hat. Man muss ihm die Sache irgendwie erklären. Man muss ihm zu verstehen geben, dass nichts Unangenehmes vorgefallen ist. Doch wie kann man eine Kette von Lügen flechten, deren Anfang und Ende zusammenpassen? Umsonst – jedes Wort aus Marals Mund konnte ein Glied von den tausend Gliedern, die er in seiner Fantasie um seine Erinnerungen geschlungen hatte, zerreißen. Jedes Wort bedeutete das Öffnen einer Tür zu dem, was sie nicht sagen wollte. Um keinen Preis wollte Maral Vater und Bräutigam etwas erzählen von ihren Diensten als Magd in den Zelten von Nayram Chan und dessen Verwandten. Nicht einmal eine Andeutung wollte sie Abduss und Delawar von ihrem halbjährigen Leben dort geben. Ihr ganzes Bestreben ging dahin, alles, was ihr widerfahren war, in ihrem Herzen zu bewahren, und den Kummer, der sich in ihrer Brust angesammelt hatte, niemandem zu offenbaren. Denn sie wusste, dass der Mensch der Steppe wie ein Adler ist, frei und mit ungebundenen Schwingen. Wenn man ihn fängt und in enge vier Wände zwängt – sodass er nicht die ganze Sonne sehen kann, nicht die Morgenbrise riechen kann, nicht alle fremden und vertrauten Weisen der Steppe und der Wüste hören kann –, versinkt er in herzquälenden Trübsinn. Man darf ihm also nicht auch noch von den Erniedrigungen, die seinen Lieben außerhalb der Gefängnismauern zugefügt werden, berichten. Wozu Delawar und Abduss von den frechen Blicken Ssamssam Chans, seinem süßlichen Lächeln, dem koketten Getue mit seinem Schnurrbart erzählen? Wozu über die Flüstereien der Frauen und Mädchen beim Kelim-Weben reden?
›Maral ist ein fetter Leckerbissen für Ssamssam Chan.‹
›Letzten Endes entkommt sie Ssamssam Chans Zähnen nicht.‹
Wozu von den angstvollen Nächten erzählen, in denen Maral sich in das Zelt der alten Mutter Koukab flüchtete und zum Dank dafür, dass die Alte sie bei sich aufnahm, sich jedem ihrer Befehle fügte? Und warum sollte sie sagen, dass Ssamssam ein Auge auf Gareh-At geworfen hatte, geradezu auf ihn versessen war: ›Du musst ihn mir verkaufen, sonst erschieße ich ihn.‹
Wozu erzählen? Was konnte der Löwe im Käfig anderes tun als brüllen und sich krümmen und sich winden? Was brachte es außer vermehrtem Kummer und unterdrückter Wut, wenn Maral den Männern sagte: ›Die Mächtigen des Stammes hätten etwas unternehmen können, um euren Richter zu kürzeren Strafen zu bewegen. Aber sie sind nur für Radjab Keschmir herumgelaufen, haben ihn als unschuldig dargestellt, und das ist ihnen auch gelungen.‹ Es war besser, wenn Abduss und Delawar davon nichts wussten. Wenn Delawar jemals erführe, dass Ssamssam Chan einmal mitten in der Nacht ins Zelt der alten Koukab gestürmt war und sich an Maral herangemacht hatte, würde Delawar seinen Kopf an die Wand schlagen. Auch wenn er hörte, dass Maral ihn mutig abgewehrt und davongejagt hatte. Sie hatte ihn bei den Haaren gepackt, ihm den Hals verrenkt und ihn so lange hartnäckig festgehalten, bis die alte Koukab vom Besuch bei einer Gebärenden zurückkam. Ssamssam hatte sich losgerissen, die Alte über den Haufen gerannt und war in die Nacht hinein geflüchtet. In der gleichen Nacht hatte die Alte zu Maral gesagt: »Es ist besser, meine Tochter, wenn du zu deiner väterlichen Sippe gehst.«
Und Maral hatte bei der ersten Morgenbrise den Fuß in den Steigbügel gesetzt, sich in die Steppe aufgemacht und den Weg nach Ssabsewar eingeschlagen … Nun stand sie hier ihren Männern gegenüber und wusste nur zu gut, dass sie die Wunde von all dem, was ihr zugefügt worden war, in ihrem Herzen verschlossen halten musste und bis zur Entlassung der Männer keinem Ohr etwas davon sagen durfte. Offenbar war Maral vernünftiger, als es ihrem Alter entsprach.
»Was ist mit dem Reitkamel? Ist es auch eingegangen?«
Maral senkte den Kopf und gab Abduss zur Antwort: »Das Reitkamel ist in den Besitz von Nayram Chan übergegangen. Er hat es uns mit Gewalt abgekauft.«
»Ach, ach!«
Abduss sagte nur das und schwieg. Vielleicht um den Vater zu beruhigen, sagte Maral: »Für die Behandlung der Krankheit meiner Mutter hatte ich von ihm Geld geliehen.«
Noch eine Brandfackel in Abduss’ Herz. Trotzdem sagte er sanft: »Macht nichts. Eines Tages komme ich aus diesem Käfig raus. Auf welchem Weg gelangst du wieder zum Lager?«
Es war klar, dass Abduss’ Gedanken durcheinander waren. Denn Maral hatte ihm ja schon zweimal gesagt, sie wolle nicht zusammen mit dem Lager weiterziehen, aber Abduss hatte das vergessen. Maral kam die Vermutung, dass der Vater sich davor scheute, sich von den Tupkalli zu trennen. Deshalb sagte sie nach einem kurzen Zögern ängstlich: »Ich sagte es euch doch! Ich habe nichts mehr mit dem Lager zu tun. Ich gehe ins Haus meiner Tante. Bis ihr hier herauskommt.«
Zweifelnd, traurig sagte Abduss: »Seit deiner Geburt haben ich und deine Tante einander nicht gesehen und gesprochen. Wir haben uns entzweit.«
Abduss’ Worte klangen gebrochen und unsicher. Resignation lag in ihnen. So konnte Maral ihm gegenüber fester auftreten, und sie sagte entschieden: »Ich gehe, um Frieden zu machen. Ich kann nicht mehr bei den Tupkalli bleiben. Ich muss weg. Ich muss zu unserer eigenen Sippe gehen, den Mischkalli. Muss unter den Schutz der Tante gelangen. Bei den Tupkalli fühle ich mich nicht sicher. Seit ihr fort seid, bin ich da ganz allein geblieben. Ich habe niemanden, der nachts vor dem Eingang meines Zeltes schläft, mein Zelt schützt. Ich habe keinen Mann. Unsere Schafe sind weg. Wenn ich mit der Herde ziehe, muss ich für diesen und jenen als Magd arbeiten. Meinst du, dass mein Bräutigam das billigen wird? Ha, Delawar, was sagst du?«
Delawar löste die Stirn vom Unterarm und hob den Kopf. In der Tiefe seines Blicks lauerte ein Adler. Seine Augenlider hatten sich zusammengezogen, seine Gesichtshaut hatte sich in Falten gelegt. Ein Schmerz in seinem Innern, der aus ihm herausbricht: »Wer hat dich beleidigt, Maral? Wer? Hat dich jemand im Lager ins Gerede gebracht? Hat jemand deine Ehre angetastet?«
»Nein, nein. Solange du auf der Welt bist, findet sich kein Mann, der mich schief ansieht! Nein, Delawar, lass dein Herz ruhig bleiben, lass dein Herz ruhig bleiben. Niemand, niemand.«
Delawar wandte sich an den Polizisten: »Bruder, nimm Rücksicht und lass uns einen Moment allein. Ich habe etwas mit meiner Braut zu besprechen.«
Diese Bitte konnte der Polizist nicht abschlagen, er rief auch Abduss, und die beiden gingen fort. Delawars breite Schultern füllten das ganze Fenster aus.
»Ha, Maral? Sag mir alles, was vorgefallen ist! Nimm keine Rücksicht, keine Rücksicht! Sags mir, sags! Sollte ich je erfahren, dass irgendein Lump meine Braut unschicklich angesehen hat, breche ich diese Schlösser mit meinen Zähnen auf, werfe mich auf ihn und reiße ihm die Augen aus ihren Höhlen!«
Maral sagte sanft: »Delawar, du bist mein Auge, mein liebes Herz, ich bin hergekommen, weil ich nicht das Lager verlassen wollte, ohne vorher mit euch gesprochen zu haben. Ich wollte nicht eigenmächtig handeln. Ich kam, dir nur das zu sagen, nicht, um mich über jemanden zu beklagen. Du mein Delawar, sei unbesorgt, mein Delawar … Ich habe euch Butter und Sahne mitgebracht, hast du das schon von dem Mann bekommen?«
Teils absichtlich, teils unabsichtlich hatte Maral das Gespräch in eine andere Richtung gelenkt und mit ihren entschiedenen Worten Delawar besänftigt, sodass sie abermals fragen konnte: »Was meinst du? Soll ich gehen oder nicht?«
Delawar antwortete bestimmt: »Geh! Geh zu deiner Tante …«, und verstummte.
Auch Maral hielt die Lippen geschlossen. Delawar sah sie an, aber nicht wie bisher, sondern mit einem ruhigen, liebevollen Blick. Dann fragte er: »Wo willst du heute Nacht bleiben? In der Karawanserei von Hadj Nur-ollah?«
»Kenne ich denn einen anderen Ort?«
Delawar sagte nichts mehr. Maral zog einen kleinen, handgestrickten Beutel mit farbigen Mustern, den sie an einer roten Kordel um den Hals gehängt trug, aus ihrem Kragen. Hastig öffnete sie den Beutel, holte ein zusammengeknotetes Tuch hervor, knüpfte es auf, entnahm ihm einige zerdrückte Geldscheine und reichte diese Delawar durch das Fenster: »Komm! Das ist das Geld für die paar Mastschafe, die von dir geblieben waren. Ich hatte Angst, dass die auch eingehen würden, und hab sie verkauft.«
Delawar teilte das Geld auf, behielt einen Teil für sich und gab Maral den Rest. Maral umschloss das Geld mit der Faust und sah Delawar an. Delawars Augen ruhten auf ihrem Gesicht und hatten jetzt einen anderen Ausdruck: unverhülltes, heißes Begehren. Als ob in seinen Augen ein Bedauern war, warum er nicht einmal, nicht ein einziges Mal diese warmen, lockenden Brüste gestreichelt hatte. Warum er nicht einmal den Duft dieser weißen Wangen eingeatmet hatte. Warum er nicht einmal den Kopf auf den wohlgeformten Arm Marals gelegt hatte. Er fragte sich traurig, warum er seine Braut nicht in die Arme genommen und in das Gras der Maruss-Ebene gelegt hatte. Er war traurig über seine unangebrachte Rücksichtnahme. Bedauern über seine Einfalt, seine Unreife.
Maral hörte nicht das kurze Gemurmel der Menschen, die eben durch die geöffnete Tür in den Hof gingen, aber sie sah das längliche Gesicht und den schwarzen Schnurrbart des Polizisten, der um die Biegung des Korridors kam und auf Delawar zuging. Sie sah auch die halb gebeugte Gestalt ihres Vaters am Ende des Korridors. Dann fühlte sie, dass Delawar sich von ihr entfernte. Vom Fenster fortgehend, presste er ein paar Mal die Lippen zusammen, und plötzlich schloss sich das Fenster, und sie, Maral, blieb allein, stumm wie ein Bild an der Wand.
Maral war im Hof des Polizeireviers. Sie nahm die an der Mauer liegende Satteltasche auf und ging aus dem Tor. Gareh-At stand noch mit gespitzten Ohren am Weidenbaum. Maral legte die Tasche hinter den Sattel, löste den Zügel vom Baumstamm, warf ihn sich über die Schulter und machte sich auf den Weg.
Gassen und Straßen füllten sich jetzt bei Sonnenuntergang mit Menschen. Maral mochte nicht ihr kummervolles Gesicht diesem und jenem zur Schau stellen. Im Bewusstsein, dass ihre Schritte so kraftlos, ihre Augen so ohne Glanz waren, wollte sie sich der Aufmerksamkeit der Leute entziehen. So schwang sie sich in den Sattel, um in die Steppe hinauszureiten. In schnellem Trab ritt sie aus dem Stadttor, galoppierte eine Weile, zügelte dann ihr Pferd, stieg am Wegrand bei einem Bach ab, ließ das Tier Gras fressen und blieb neben der Mähne von Gareh-At stehen. Abend. Ein neuer Abend. Eine neue Situation. Eine neue Stimmung. Eine neue Steppe. Maral war schon oft durch diese Steppe und einen solchen Abend gegangen, hatte sie aber nicht so mit der ganzen Seele empfunden. Der Tag nimmt eine andere Farbe an, wenn dein Leben sich von Grund auf verwandelt hat. Ist die Abenddämmerung rot oder düster? Wie siehst du sie? Es hängt davon ab, wie du sie siehst! Die Nacht ist licht, wenn das Herz froh ist. Der Abend ist stumm, wenn Marals Herz stumm ist, wenn ihre Seele stumm ist. Und der Abend war stumm.
Die weite Steppe, die weiten Ebenen im Umkreis der Stadt mit ihren grünen Flecken verblichen in der Dämmerung. Die Stadt versank in aschfahles Grau. Die Berge im Norden der Stadt verwandelten sich in schwarze Schatten, ihre Gipfel verbargen sich in der Schwärze des Himmels. Hier und da hatten Bauern ihr Tagewerk beendet und gingen jeder für sich irgendwohin. Einen Vorratssack auf dem Rücken, einen Spaten auf der Schulter oder ein Stück Vieh vor sich. Langsam und müde. Es war die Zeit der Rübenernte. Bald darauf würde Licht aus den schmalen Fenstern der Hütten fließen.
Maral wandte den Kopf zu den Bergen von Kelidar, den in der nächtlichen Dunkelheit geduckten Bergen. Zu den dem Berg Binalud benachbarten höheren Gipfeln des Hesar-Massdjed-Gebirges. Flug der Fantasie. Ssarachss. Heiße Tage und kalte Nächte. Getümmel des Lagers, Hundegebell, Geschrei der Hirten; Delawar. Die Herde kehrte zum Zeltplatz zurück. Zeit des Trecks von der Sommer- zur Winterweide. Scharen von Schafen, Gruppen von Männern: Ladet auf, ladet auf! Was waren das für Nächte, jene Nächte! Was für Nächte! Kein Ende wollten sie nehmen. Langsame, zähe, lang gezogene Augenblicke. Voll Freude, voll Qual, voll Erinnerung. Angefüllt mit der Ungeduld der Herzen.
Wenn sich der Stamm im Lager aufhielt, setzte Maral sich abends an die Zeltstange und spann. Mahtou warf Reisig ins Feuer unter dem steinernen Kochtopf. Der schwarze Teekessel auf der Feuerstelle. Tee für die Männer. Der Abend erbleichte. Dunkelheit eilte über den Himmel. Die Nacht stieg hinter dem Berggipfel hervor, streckte sich in die Höhe, ließ ohne Eile ihren Leib auf die Steppe nieder und breitete ihre Arme zwischen den schwarzen Zelten aus. Hier und da blitzten Windlichter auf, jeder Strahl stach wie eine Dolchspitze in die Haut der Nacht, doch der Leib der Nacht verharrte über den Zelten des Lagers auf der gebrochenen Spitze der Lanzen aus Licht. Eine Kuhhaut auf gebrochenen Spießen.
Die Nächte von Kelidar waren anders. Leicht und unruhig. Eine angenehme Brise durchwehte sie. Der Duft der Erde und der Gräser machte einen trunken. Der Mond von Kelidar schien aus größerer Höhe zu glänzen. Die Nacht von Kelidar war durchsichtiger. Weniger angsterregend. Immer noch gab es kein Zeichen von Delawar! Sind dies nicht die Hufschläge von Gareh-At, die von jenseits der Cholur-Hügel kommen? Was ist dieser weißsprühende Staub? Windet sich nicht das trunkene Wiehern Gareh-Ats in der Nacht von Kelidar? Ist dies nicht Gareh-At, der mit fliegender Mähne herangaloppiert?
Wo ist denn der Reiter? Wo ist Delawar?
Ist das Gareh-At, der da schweißtriefend und erschreckt zwischen den schwarzen Zelten unentschlossen sich selbst überlassen ist? Ungeduldig und verstört ist er, der Rappe! Ohne Sattel und ohne Zaum. An seinen Ohren hängen Schweißtropfen. Sein Nacken glänzt vor Feuchtigkeit. Er scharrt mit den Hufen. Unter Wiehern wühlt er die Erde auf. Seine Mähne ist zerzaust. Erregt und verwirrt ist er, der Gareh-At. Die Männer des Tupkalli-Stammes haben ihn umringt. Aber wann hätte er je einen Fremden an sich herangelassen? Er erkennt nur einen als Herrn an. Er leidet, der Gareh-At. Ohne Reiter ist er zurückgekehrt. Eine Botschaft hat er mitgebracht. Maral taucht auf. Den ledernen Wassereimer lässt sie fallen. Ein Laut aus ihren zitternden Lippen. Gareh-At hört eine bekannte Stimme. Aufgerichtete Ohren: Dies ist Maral! Er legt die Ohren an und neigt den Nacken. Maral und der Rappe gehen aufeinander zu. Der Rappe reibt die Stirn an Marals Schulter. Aus seinem Maul dringt ein Laut, ähnlich einer Klage. Gleichsam ein Weinen des Pferdes. Maral streichelt seine Mähne, legt die Arme um seinen Hals. Männer und Frauen des Lagers lassen die beiden allein. Maral führt das Pferd mit sich. Sie führt es eine Strecke, damit sein Schweiß langsam trocknet. Sie führt es zurück. Bei ihrem schwarzen Zelt lässt sie es los. Maral wünscht sich, der Rappe könne sprechen. Sie versinkt in sich selbst. Die Nacht zerbricht.
Am nächsten Tag stellt sich heraus, dass Delawar, Abduss und Radjab Keschmir zum Gendarmerieposten gebracht worden sind.
Maral vergrub die Hand in Gareh-Ats schöner langer Mähne und kraulte das Tier hinter seinen weichen Ohren. Der Rappe blickte sie an und bewegte Ohren und Schweif. In der Höhe, südlich von Maschhad, stiegen Wolken einander auf die Schultern. Diese Wolken regneten nie. Geizig, trocken, unfruchtbar waren sie. Eine hinter der anderen, eine armselige, ausgehungerte Karawane, hoch über der flachen Kawir; schlaff und müde irrten sie auf Sabolestan, den Fluss Hirmand und die afghanische Steppe zu, um sich dort zu verlieren. Unter diesen seelenlosen Wolken lagen Dörfer, Karawansereien, einige vereinzelte, kaum fruchtbare Ebenen und Wüstenstädte, die trockenen Lippen zwischen den Zähnen, durstig und mit blassem Antlitz; Haufen von Erdklumpen auf dem Weg des Windes, auf der sonnigen Ebene: Torbat und Birdjand, Gonabad und Bidocht. Maral war da überall schon vorbeigekommen. Danach hatte sie auch die Zigeuner von Torbat in den Steppen, Dörfern, auf den Ziegenpfaden entlang den Schluchten und beim Lagerplatz gesehen. Sie schlugen ihre Zelte auf, stellten Ambosse auf den Boden und machten sich ans Werk. Es war an der Zeit, die Pferde neu zu beschlagen. Die Männer brachten Pferde, Maultiere und Esel zu den Hufschmieden. Die Frauen kamen, Kebabspieße, Messer, Nadeln und Rohre für die Wasserpfeifen zu kaufen. Die heiratsfähigen Mädchen suchten die alten Frauen auf, die aus der Hand lasen. Angenehmes Sprechen, schöner Tonfall, eine Fülle von faszinierenden Ausdrücken. Die Zigeunermütter mit ihren losen Zungen hatten Musik in ihren Worten. Sie wahrsagten und erzählten alte Geschichten. Das gefiel den Kurdenmädchen. Die Zigeuner brachten Neuigkeiten aus Torbat und Kaschmer und Kalschur mit. Neuigkeiten aus dem Tamariskenwald, dem Winterquartier der Mischkalli. Dem Tamariskenwald, an der Grenze zum Wüstengebiet im Süden von Ssabsewar und Nischabur, an der Grenze zum Wüstengebiet, das bis unterhalb von Baschteyn reichte. Eine Hand streckte es nach Anarak aus. Nördlich von Anarak lag die Ebene von Schahrud, die sich bis zum Abhang des Ssangssar hinzog, sich nach Osten neigte und den Kopf an den Fuß von Kelidar legte, sich mit der Ebene von Maruss vereinte und Essferayn und Abdollahgiw und die Ebene von Djouweyn umschloss. In ebendiesem Gebiet, in der Schlucht von Malagdareh der Maruss-Ebene, im Getümmel beim Melken der Schafherden, war Maral von Mahtou zur Welt gebracht worden. Dieses Gebiet war Marals Welt. Eine Welt, nicht eng, nie eintönig. Nun aber war sie allein in ihrer Welt. Allein wie eine Mohnblume auf der Handfläche der Steppe, ein Edelstein in einer Ruine. Ungewisse Wege, aufgelöste Bindungen. Leere Steppen und schlafende Ebenen. Verstreute Städte und geduckte Dörfer. Allein der Gedanke daran lässt den Atem stocken.
Die Nacht ballte sich zusammen. Alte, verstreute Lichter züngelten hier und da. Maral musste weitergehen. Zeit zu gehen. Sie setzte den Fuß in den Steigbügel, schwang sich in den Sattel und wandte den Zügel der Stadt zu. Eine Lichtquelle, die Karawanserei von Hadj Nur-ollah, und Pir Chalu, um sie zu empfangen.
Eine kleine Tür mit einem Rundbogen in einem der Torflügel, eine Öffnung, so groß wie eine gewöhnliche Tür. Pir Chalu öffnete die kleine Tür. Als er die Tochter von Abduss erblickte, erhellte sich sein altes, breites Gesicht: »Ha! Bist dus, Mischkalli-Mädchen? Ha, wo bist du gewesen, dass dich dein Weg hier vorbeiführt? … Schön, schön, lass mich den großen Torflügel aufmachen, damit dein Pferd reinkommen kann. Komm … nun führ es rein … Schön, gewiss doch, lass mich den Riegel vorlegen … Gut, das wärs. Schön, gewiss doch.«
Maral und Gareh-At waren jetzt im Torweg. Pir Chalu schloss geschickt die Flügel von Tür und Tor und trat zu Maral, um ihr den Zügel abzunehmen. Aber der Rappe schnaubte, schüttelte die Mähne und machte eine halbe Drehung. Pir Chalu wich zurück, legte den Unterarm schützend über die Stirn und drückte sich mit dem Rücken an die Mauer des Torwegs: »Eh … schön, schön, gewiss doch. Gewiss doch, mein Tier. Schön, gewiss doch.«
Maral beruhigte das Tier und sagte mit einem Lächeln, in dem sich Stolz und Bescheidenheit mischten: »Er ist nicht an Fremde gewöhnt, Chalu, lässt Fremde nicht an sich heran. Zeig mir, wo ich den Sattel abnehmen und den Zügel anbinden kann.«
Pir Chalu zog sich in den Hof der Karawanserei zurück und sagte: »Ich wollte ihn ein wenig hier im Hof herumführen, damit sein Schweiß trocknet.«
»Er hat nicht viel geschwitzt. Ich führ ihn selbst ein paar Mal herum.«
»Dann geh ich vor, bring du das Tier zur Futterkrippe.« Pir Chalu ging zur Krippe in der Hofecke und sagte: »Ihr Nomaden müsst ja auch solche Weggefährten haben. Wie könnt ihr sonst in den Bergen und Tälern überleben, die weiten Steppen durchstreifen und mit jedem Tier und allem Möglichen fertig werden? Sehr schön, schön, gewiss doch. Ihr braucht das, ja, ja. Solche Tiere wie dies habt ihr nötiger als das tägliche Brot. Bring es her, bring es in diese Ecke. Hierher. Schön, schön, gewiss doch.« Ununterbrochen redend, machte er sich daran, den Boden der Krippe zu säubern: Mit seinen rauen, schwieligen Händen fegte er Strohhalme, Staub und Dreck, alles, was in der Krippe war, zusammen, wandte sich Maral zu und sagte: »Hier … hier … leg Sattel und Polster in diese Ecke. An die Mauer.«
Maral machte mit Gareh-At noch eine Runde, brachte ihn dann zur Krippe, lockerte den Sattelgurt, nahm Sattel und Satteltasche herunter, zog dem Rappen die Kandare aus dem Maul, knotete den Fesselriemen um den Zügelhalter – ein Holz, dessen Enden an der Mauer festgemacht waren – und richtete sich auf.
Chalu sah sich den sattellosen Gareh-At an. Was für ein Tier! Eine schwarze Schlange mit einem sanft geschwungenen Rücken: »Eine Augenweide ist er! Dass ihn der böse Blick nicht treffe! Den hab ich doch nicht unter Abduss’ Tieren gesehen?«
Maral warf sich die Satteltasche über die Schulter und sagte: »Damals war er noch ein Fohlen, Chalu. Gareh-At ist nicht älter als zweieinhalb Jahre. Vor Kurzem erst hat er seine Eckzähne bekommen.«
Chalu mochte seinen Blick nicht losreißen. Dennoch ging er zum Vorratsraum unter dem Torweg, um Heu und Gerste vorzubereiten. Maral fuhr mit der Hand über die Mähne des Pferdes und kraulte mit den Fingerspitzen seine Ohren, strich mit der weichen Handfläche über seinen Rücken, rieb seine Schultern, die Stelle zwischen den Vorderbeinen und die Brust; sie streichelte seine Kruppe, zupfte einen Strohhalm ab, der in seinen Schwanzhaaren hing, ging zu Chalu, nahm ihm das Sieb mit dem Heu und die Kupferschüssel mit der Gerste ab, trug sie hin und leerte sie in die Krippe. Der Rappe steckte den Kopf an Marals Schulter vorbei in die Krippe. Maral lehnte das leere Sieb an die Mauer, fuhr noch einmal mit der Hand über die Mähne des Tiers und entfernte sich. Im Gehen fragte sie: »Hier ists doch sicher, Chalu?«
Chalu drehte den Oberkörper Maral zu und sagte: »Wo bist du mit deinen Gedanken, Tochter von Abduss? Es sei denn, dass Gott seine Hand ausstreckt und das Pferd herauszieht! Ich sehe sonst kein Schlupfloch in diesen Mauern. Siehst du etwa eins?«
»Ich hab das nur aus Spaß gesagt, Chalu. Wer kann sich denn an Gareh-At heranmachen?«
»Ha, schön, schön, gewiss doch, gewiss doch. Nachts fliegt hier nicht mal eine Mücke rum. Ich bin ja auch wach. Schön, gewiss doch. Jetzt geh dahin, setz dich auf die Bank neben der Tür, ich mach für dich einen Becher Tee. Ich hab erstklassigen Tee aus Indien.«
Maral stieg die Stufen hinauf, nahm an der Tür von Pir Chalus Hütte die leere Satteltasche von der Schulter und setzte sich darauf. Chalu bückte sich, ging ins Zimmer und steckte den Kopf in seine mit allerlei Plunder gefüllte Truhe. Aber sein Mundwerk stand dabei nicht still. Die ganze Zeit redete und redete er: »In meiner Eschgh-abader Teekanne will ich für dich den Tee machen. Gewöhnlicher Tee steht sowieso zum Ziehen auf dem Herd. Diese Teekanne hab ich mit meinen eigenen Händen aus dem russischen Eschgh-abad hergebracht. Im türkischen Viertel von Eschgh-abad hab ich sie für viereinhalb Rubel gekauft. Zu der Zeit, als ich noch Kameltreiber war, hab ich sie gekauft. Eigentlich hatte ich sie für meine Braut gekauft.«
Eine zierliche Porzellankanne war es, granatapfelfarben, mit weißen Rosensträußen auf beiden Seiten. Die alten, breiten Hände Pir Chalus hielten die rote Kanne wie eine Taube. Er trat aus der Tür und zeigte sie Maral. Seine Augen blitzten vor Freude: »In den Jahren damals brachten wir Porzellanwaren aus Russland. Porzellanwaren und Sachen aus Messing. Auch Petroleum brachten wir. In unserem Land hatte man noch kein Petroleum gefunden. Von hier nahmen wir Rosinen und Mandeln mit. Von dort brachten wir auch Stoffe. Immerzu waren Karawanen unterwegs. Der Weg war ja noch frei. Später, als es dort bolschewistisch wurde, sperrten sie die Grenzen. Schön, schön, gewiss doch, gewiss doch. Jetzt mach ich den Tee.«
Während er so weiterredete, setzte sich Pir Chalu neben der Bank an die Feuerstelle und fachte das Feuer an. Dazu war nur ein Stück Reisig nötig. Er stützte die Hände auf den Boden, beugte Kopf und Schultern vor, blies in den Herd. Rauch stieg auf, und im Rauch, unter dem ständigen Blasen Pir Chalus, züngelte eine schwache Flamme. Die Flamme erfasste das Reisig, Pir Chalu trocknete mit dem Handrücken die tränenden Augen, setzte sich neben die Tür. »Schön, schön, gewiss doch, jetzt wird es angehen, wird angehen. Warum sitzt du auf der Satteltasche? Sehr schön, ich hab doch eine Filzmatte, gewiss doch.«
Er brachte eine Ssangssarer Filzmatte aus der Hütte, breitete sie aus und sagte: »Setz dich hier drauf. Jetzt bring ich dir auch Bettzeug, damit du dich anlehnen kannst. Du bist müde, ich weiß. Sehr schön, gewiss doch.«
Er brachte altes zusammengerolltes Bettzeug, legte es an die Wand und ging zur Feuerstelle: »Mach dirs bequem, ruh dich aus. Du bist müde. Fühl dich hier wie zu Hause. Sehr schön, gewiss doch. Gewiss doch. Der Tee ist auch gleich fertig. Schön, nun sag mal, was weißt du Neues von meinem Freund Abduss, von deinem Vater?«
Maral sagte: »Heute habe ich ihn besucht.«
»Gings ihm gut? Seit einigen Freitagen habe ich ihn nicht mehr besuchen können. Wie ging es ihm? Ha?«
»Nicht schlecht. Aber er war sehr besorgt … Chalu, er ist ungerecht behandelt worden.«
»Ja, meine Liebe, ja. Gewiss doch. Das wissen wir alle. Alle. Die Ältesten der Tupkalli haben ihn nicht anständig behandelt. Schön, und wie ging es Delawar? Deinem Bräutigam?«
»Gut, gut.«
»Gewiss doch, gewiss doch. Jetzt sag mir mal, wie es gekommen ist, dass du dich ganz allein auf den Weg in die Stadt gemacht hast.«
»Ich will nach Ssusandeh gehen, zu meiner Tante Belgeyss. Ich möchte dort im Haus meiner Tante bleiben, bis mein Vater entlassen wird. Hast du gehört, dass meine Mutter gestorben ist?«
»Gestorben? Mahtou ist gestorben? Ach, ach!«
»Vor Kummer ist sie gestorben. Von der Seuche unter den Schafen hast du wohl gehört?«
»Nun, nun?«
»Wir hatten ja keinen rechten Mann, der zur Stadt in den Basar gehen konnte, um einen Arzt und Medizin zu holen. Diejenigen, die es sich leisten konnten, sind mit heiler Haut davongekommen und haben ihre Tiere gerettet. Unsere Tiere waren es, die eins nach dem andern vor unseren Augen Durchfall bekamen, mit allen vieren zuckten und eingingen. Und Mahtou, die schon krank war, ist danach vor Kummer gestorben.«
»Weiß Abduss davon?«
»Ich habe ihm gesagt, ich hätte sie nach Ssusandeh gebracht, zu Belgeyss. Wenn du ihn siehst, Chalu – von mir hast du nicht gehört, dass Mahtou gestorben ist, ja?«
»Gewiss doch, gewiss doch. Ich werd dran denken.«
Pir Chalu brachte den Tee, stellte ihn Maral hin. »Nun, weiß deine Tante Belgeyss, dass du zu ihr unterwegs bist?«
»Sie kennt mich nicht einmal!«
»Hast du irgendwelche Nachricht von ihr?«
»Nein, woher sollte ich?«
»Schön, schön, gewiss doch. Gieß dir Tee ein. Gieß auch für mich welchen ein. Einige von Belgeyss’ Familie waren in Maschhad im Gefängnis!«
»Was sagst du da?«
»Wahrhaftig. Der älteste Sohn von Belgeyss, Chan-Mammad, mit seinem Onkel Chan-Amu. Und der Dritte war Ali-Akbar, der Sohn von Hadj Passand und Gol-Andam, der Neffe von Belgeyss. Das hast du also nicht gehört?«
»Jetzt höre ich das zum ersten Mal … Weswegen denn?«