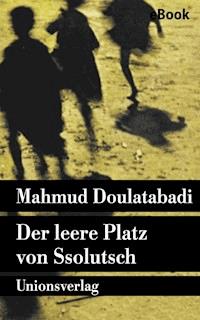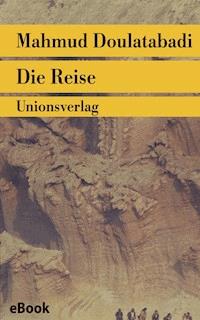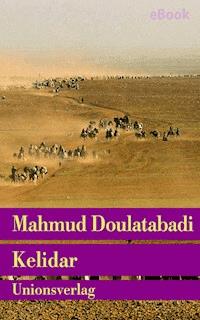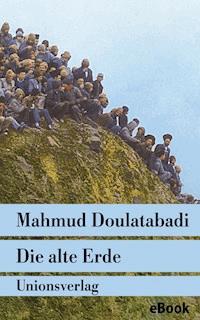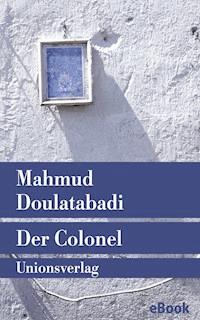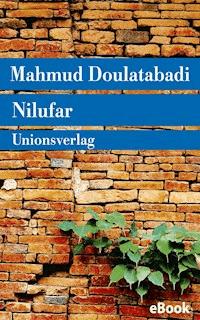
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein alter Mann im grauen Regenmantel irrt durch die Straßen einer europäischen Großstadt. Er setzt sich in ein Kaffeehaus, zieht ein zerknittertes Notizbuch aus der Tasche, liest und schreibt. Er versucht, seiner Erinnerungen an Nilufar Herr zu werden. Eines Tages war sie ihm wie eine Taube zugeflogen und hatte sich ganz einfach neben ihm auf die Parkbank gesetzt. Ein rätselhaftes Gefühl uralter Liebe, Freundschaft und Einheit verband die beiden. Im Glanz ihrer lebenssprühenden Augen fand er sein Leben wieder. Sie, und nur sie, konnte sein Schweigen brechen. Warum hat er sie wieder verloren? Mahmud Doulatabadi erzählt von der Macht einer Liebe, die an noch größeren Mächten scheitert: an den Zwängen einer traditionellen Familie, der politischen Starre und am eigenen Unvermögen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Wer ist dieser alte Mann im grauen Regenmantel, der durch die Straßen einer europäischen Großstadt irrt? Er versucht, seiner Erinnerungen an Nilufar Herr zu werden. Mahmud Doulatabadi erzählt von der Macht einer Liebe, die an noch größeren Mächten scheitert: an den Zwängen einer traditionellen Familie, der politischen Starre und am eigenen Unvermögen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Mahmud Doulatabadi (*1940) gilt als bedeutendster Vertreter der zeitgenössischen persischen Prosa. Er arbeitet als Schriftsteller und Universitätsdozent für Literatur in Teheran.
Zur Webseite von Mahmud Doulatabadi.
Bahman Nirumand (*1936) studierte in Deutschland und promovierte 1960 über Bertolt Brecht. Im Iran war er Dozent an der Teheraner Universität, musste jedoch ins Exil gehen. Er lebt als Schriftsteller und Publizist in Berlin.
Zur Webseite von Bahman Nirumand.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Mahmud Doulatabadi
Nilufar
Roman
Aus dem Persischen von Bahman Nirumand
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel Ssolouk im Verlag Tscheschmeh, Teheran.
Die Übersetzung aus dem Persischen wurde mit Mitteln der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V.
Originaltitel: Ssolouk
© by Mahmud Doulatabadi 2003
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Tanat Loungtip
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30854-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 10:21h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
NILUFAR
WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Mahmud Doulatabadi
Über Bahman Nirumand
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Mahmud Doulatabadi
Zum Thema Iran
Zum Thema Liebe
Zum Thema Asien
Er sieht diesen alten Mann, der im Nebel geht, aber genau erkennen kann er ihn nicht. Eine leise Ahnung sagt ihm, er müsste ihn kennen. Er grübelt und grübelt, aber er kann sich kein klares Bild von ihm machen, keine Erinnerung an ihn wachrufen. Woher kommt dieses Gefühl, dass er ihn kennen müsste, ihn kenne oder gekannt habe? Warum bohrt diese Neugierde so in ihm? Er beschleunigt seine Schritte, will dem alten Mann näher kommen. Aber auch der Mann beschleunigt, scheinbar achtlos, seinen Gang im Gleichschritt mit ihm, so dass der Abstand zwischen ihnen gleich bleibt. Gheiss kommt dem alten Mann nicht näher. Er muss also die Hoffnung aufgeben, ihn einzuholen, vielleicht auch mit ihm zu reden, ihm ins Auge zu schauen und beim Austausch eines höflichen Grußes seine Stimme zu hören.
Er vermutet, dass der alte Mann, der mit gesenktem Kopf durch den Nebel geht, nicht gesprächig ist. Eine in Herbstnebel gehüllte Stadt in Europa, trübes, drückendes Wetter, ein Mensch läuft gekrümmt an einer alten, feuchten, moosbewachsenen Mauer entlang. Die verwitterte Mauer trennt die lange Straße vom Friedhof, und so ist es nicht erstaunlich, dass die schattenhafte, gekrümmte, uneinholbare Gestalt, die sich vor ihm in immer gleicher Distanz gegen den düsteren Himmel abzeichnet, so wirkt, als trage sie eine besondere Bedeutung.
Gheiss weiß, dass ihn mehr als gewöhnliche Neugier zu diesem Mann hinzieht. Er ist sich sicher, dass er diesen Mann gleich wiedererkennen wird. Durch den Nebel und den Nieselregen hindurch betrachtet, wirkt es, als habe der Mann seinen Mantelkragen hochgeschlagen, um den tief zwischen die knochigen Schultern gesenkten Kopf vor dem kalten Wind zu schützen, aber auch damit sein Starren auf die Erde, auf die fahlen Pflastersteine nicht auffällt. Gheiss spürt, dass der Mann nicht daran interessiert ist, andere Menschen zu sehen. Sonst würde er nicht in einer Stadt, die so viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, auf einer verlassenen Straße den Friedhof entlanggehen, die Hände tief in die Taschen vergraben. Er geht so gekrümmt, dass man meinen könnte, er habe einen Buckel. Gheiss spürt förmlich, wie er in den Taschen die Finger zur Faust geballt hat, wie seine Adern angeschwollen sind. Er erinnert sich: In solchen Situationen hat er selbst früher die Zähne gegeneinandergepresst, bis die Fältchen um seine Augenhöhlen zu tiefen Kerben wurden, die für jedermann sichtbar waren. Sicher ist der Mann auch blass geworden, bleich wie nie zuvor. Es sieht ganz danach aus, dass dieser Mann er selbst ist.
Die Anzeichen müssten genügen, damit du diesen alten Bekannten wiedererkennst. Du bist ihm doch in verschiedenen Phasen deines Lebens begegnet. Er war es doch, der vor zwei, drei Jahren seinen Personalausweis verloren hat und in seiner ganzen Verwirrung und Orientierungslosigkeit seltsam gefasst wirkte. Vielleicht weil er wusste, dass man, wenn das Alter erreicht ist, in gewissen Situationen die Erinnerung verliert, sodass sogar der eigene Namen entschwindet.
Ja, allmählich kam Gheiss dem Mann auf die Spur. Oder konstruierte er nur das Phantombild eines Menschen, dem er im Laufe seines Lebens tatsächlich begegnet war? Wer war das bloß? Ja, er kannte diesen grimmigen Mann. Er durfte ihn keine Sekunde aus den Augen lassen und beschleunigte noch einmal seine Schritte, um ihn einzuholen. Aber es war nicht möglich …
Wie Gheiss es vermutet hatte, ging der alte Mann in den Friedhof. Gheiss verfolgte ihn wie sein Schatten. Die hochragenden Bäume mit ihren dürren Ästen streiften die Wolken. Der Alte achtete nicht auf sie. Er interessierte sich auch nicht für die Grabsteine. Mit schweren Schritten ging er über den mit Kieselsteinen bedeckten Weg und blieb dann unvermittelt stehen. Auch Gheiss hielt unwillkürlich inne. Dann lief er weiter, weil auch der alte Mann weiterlief. Einige Schritte entfernt befand sich eine Bank. Ob der alte Mann sich setzen würde? Er setzte sich. Auch Gheiss setzte sich. Wie erschöpft er ist, dachte Gheiss. Hat er einen weiten Weg hinter sich? Sicher hat der Alte ein starkes Verlangen nach einer Zigarette. Gheiss spürte es.
Ja, der alte Mann griff in seine Brusttasche, zündete sich eine Zigarette an und legte ein Bein über das andere. Um auf einer Bank oder einem Stuhl bequem zu sitzen, musste er ein Bein über das andere schlagen, das linke über das rechte. Und dazu eine Zigarette … aber Zigarettenrauch stört immer irgendjemanden.
Sie sitzt neben ihm auf der Parkbank, ein wenig schräg, das Gesicht Gheiss zugewandt. Sie lacht, wie eine Blume, wenn eine Blume lachen könnte. Ihre dunklen Pupillen glänzen, wie der Glanz der sinkenden Sonne auf den zarten Wellen eines Teichs: »Puh, so viele Zigaretten!« Sie verwedelt mit der linken Hand wie mit einem Fächer den Rauch vor ihrem Gesicht. So viel Grazie, noch in der kleinsten Bewegung … Das Leben sprüht aus ihren Wangen. Leben, das glüht und lodert. Sie sitzt neben ihm. Zwei Passanten gehen an ihnen vorbei und grüßen Gheiss. Er merkt es nicht. Aber die Frau wird lebhaft, es bricht aus ihr heraus: »Wie ehrenvoll es ist, so begrüßt und geachtet zu werden!«
Gheiss schaut sie an, zuckt die Achseln, als wäre er peinlich berührt, nickt. Sie kennt Gheiss, sie kennt ihn sehr gut. Oft sagt sie: »Niemand kennt dich so wie ich.« Und Gheiss schließt die Lider als Zeichen der Bestätigung. Sie müsste also wissen, dass ihm Ehrerweisungen nicht viel bedeuten. Manchmal schämt er sich sogar und wirkt verlegen. Er hat es ihr oft gesagt, wenn er mit ihr spazieren ging oder im Café oder Restaurant ihr gegenübersaß. Ehrerweisungen waren ihm unangenehm, er fühlte sich schon unwohl, wenn bei einem Treffen mit ihr andere dabei waren. Er hatte dann das Gefühl, er werde erdrückt und zerquetscht. Wenn andere Menschen auftauchten, packte er ihren Arm, als wolle er sie wegführen. »Was ist denn geschehen?«, fragte sie energisch. Nichts war geschehen, aber in seinem Inneren drückte ein alter Knoten, ein quälendes Gefühl aus vergangenen Zeiten. Vielleicht weil er sich bewusst war, wie erschöpft, bedrückt und verbraucht er aussah neben ihrer Frische und Lebendigkeit? Vielleicht. Aber das war nicht alles. Die Blicke der anderen lösten in ihm Angst und Unsicherheit aus. Man wird über ihn reden und tuscheln und sein Benehmen ganz und gar unpassend finden. Das war die Qual, und jeder Blick konnte die Verbitterung über gewisse Äußerungen, die er nie vergessen würde, wieder hochkommen lassen …
Doch sie ließ nicht zu, dass er in dieser bedrückten Stimmung begraben blieb. Schon mit dem nächsten Wort zog sie ihn mit ihrem blühenden Lächeln wieder aus der Gruft seiner Gedanken heraus. »Du bleibst immer, der du warst, ein gesunder, schöner, starker Mann.« Er wollte mit ihr reden, ihr ein guter Gesprächspartner sein, aber er schaffte es nicht. Er lächelte nur zurück und wusste selbst nicht weshalb. Warum war er überzeugt – und er ist es immer noch –, dass das Lächeln ihm ein unschönes Aussehen verleiht?
»Schon wieder eine Zigarette! Wie viele denn noch?«
Er warf den Stummel aus dem Fenster des Autos hinaus, kurbelte die Scheibe noch weiter nach unten, damit sie nicht auf den Gedanken käme, das Fenster auf ihrer Seite zu öffnen. Im herbstlichen Abendwind könnte sie sich erkälten. Der Rauch, den er im Auto durch Nase und Mund ausstieß, brachten sie wirklich zur Verzweiflung. Ihre Augen brannten. »Das ist die Letzte, die Allerletzte«, sagte er scherzhaft. Sie wusste, wie abhängig er von Zigaretten war, wie sehr sie Tag für Tag an ihm zehrten. Sie schaute ihn an mit einem ironischen Blick und einem Lächeln im Mundwinkel: »Wenn du zwischen mir und Zigaretten wählen müsstest, bin ich sicher, dass du dich für Zigaretten entscheiden würdest.« Gheiss wendete sein Gesicht ihr zu – sicher würde seine Haut sie jetzt an trockene Baumrinde erinnern – und verlor sich einen Augenblick in der dunklen Tiefe ihres Blicks. Er wäre darin versunken, hätte er nicht den Wagen lenken und nach vorn schauen müssen. Sie konnte ihn verstehen, die kleinsten, rasch wechselnden Nuancen seiner Stimmung nachfühlen. Sie legte ihre Hand auf seinen Handrücken und drückte sanft. Es war nur ein kurzer Augenblick, aber lang genug, um all ihre Sinne durch die Hand in seine Adern zu leiten.
Man stelle sich einen Herbsttag vor, zwischen Nachmittag und Abend, auf der Straße, die durch das Zentrum in den äußersten Süden der Stadt und zu der ältesten Brücke führt. Früher war da beidseits der Straße bis hin zur Brücke und dem Schlachthof keine einzige Hütte, nicht einmal eine Straßenlampe, die einen Fleck Erde hätte beleuchten können. Er hatte ihr erzählt, dass er an einem Sommerabend vom Schlachthof bis zu der Brücke gelaufen war und dabei laut gesungen hatte, aus Angst. Und auf dem Rückweg wieder, allerdings noch lauter, noch schneller, noch ängstlicher. Gar nicht einfach war das, überwältigt von Angst zu rennen und dabei zu singen!
»Es war lange bevor du geboren wurdest, vermutlich war damals Senemar noch im Gefängnis. Soweit ich mich erinnere, hatte damals im Irak Abd al-Karim Qasim einen Militärputsch gegen den König geführt. Dort hinter der Brücke gab es ein Teehaus, das sich Tabrisi nannte. Wie alt werde ich damals wohl gewesen sein? Und du? …«
Inzwischen waren sie wohl angekommen, auf dem alten Vierkuppeln-Platz nahe den Geschäften, Schaufenstern und Neonlichtern. Und immer, wenn sie dort waren, fragte er sie: »Möchtest du etwas kaufen?« Und sie antwortete: »Nein.« »Warum?«, fragte er dann, oder er schaute sie nur an. Und Gheiss hat nie, bis heute nicht, das rätselhafte Gefühl der Verbundenheit und Einheit begriffen, das sie ihm vermittelte mit jenem Blick, der erfüllt war von ihrer glasklaren Zufriedenheit, ihrer Zuneigung und Hinwendung. Noch immer spürt er diesen auf ihn gerichteten Blick, den keine Spur eines Hintergedankens trübte, der ihn dankbar machte und glücklich wie ein Kind. Wie war es möglich, dass der bescheidenste Wunsch von ihr, der zudem nicht überraschend kam, ihn innerlich so aufwühlte, dass er ihr dafür zutiefst dankbar war? Er wollte ihr ja nichts Besonderes kaufen. Was es war, spielte für beide keine Rolle. Aber dieser Glücksstrom, der sie einen kurzen Augenblick, so kurz wie die Dauer eines Blickes, überwältigte, war ihnen so wertvoll, dass sie um nichts auf der Welt darauf verzichten wollten.
»Kauf mir ein Eis.«
Es war, als würde sie ihm mit diesem Wunsch die ganze Welt schenken. Er lief zur Eisdiele und sah, mit dem Rücken zu ihr, immer noch dieses beglückende Lächeln vor sich. Er wünschte, dass der Eisverkäufer sich beeilen möge, und seine zittrigen Finger klaubten hastig die zerknüllten Geldscheine aus der Tasche. Er wusste nicht, wie oft er sich während des Wartens nach ihr umgedreht hatte. Sie wartete auf ihn, er wusste es, auch wenn sie nicht zu ihm hinschaute. Und schon war er mit jungenhaften Sprüngen zurück beim Auto und stellte sich neben sie, die lächelnd wieder aufblühte, ans offene Fenster, bis ihm einfiel, dass es höchste Zeit war, sich ans Steuer zu setzen und loszufahren. Nur wenn sie noch Zeit hatten, sagte er: »Lass uns noch eine Weile hierbleiben.« Sonst fuhr er los, und sie verteilte das Eis, Löffel für Löffel, einen für sich, einen für ihn, der fahren musste durch den regen Abendverkehr und vorbei an zahlreichen Autos, denen es gleichgültig schien, woher sie kamen und wohin sie fuhren. Gheiss war die Strecke wohlbekannt. Er fuhr diesen Weg schon seit zehn Jahren mindestens zwei, drei Mal in der Woche zwischen sieben und neun Uhr abends.
Einmal hatte Nilufar gesagt, er müsse ein Buch schreiben über »die Wege, die mich zu dir führen«. Das Buch ist immer noch nicht zu Ende geschrieben. Seine Notizen in den alten Heften sind sicher schon längst verloren gegangen. Aber die Strecke, die sie an jenem Abend fuhren, war wie der Rückweg aller Wege, die sie je ging, um zu Gheiss zu gelangen. Und war es nicht der gleiche Weg, den er schon als siebzehn-, achtzehnjähriger junger Mann morgens in der Frühe mit entschlossenen Schritten kreuz und quer durch die Stadt und den quälenden Verkehr gegangen war, und am späten Abend wieder auf dem Heimweg?
In den ersten Monaten und Jahren schien es dies. Aber wie konnte es sein, dass Gheiss sich so wenig Gedanken gemacht hatte über den innersten Kern jenes Menschen, den er Nilufar genannt hatte? Wieso dachte er kaum nach über sie, über ihren Geburtsort, ihre Familie, ihre Begabungen und Tätigkeiten, über diesen Menschen, der immer wieder in ihm, in der Stille wie im Chaos seiner Gedanken aufblühte und lebendig wurde? Nein, niemals, er hatte niemals, nicht für einen Augenblick, ihre Anwesenheit, ihr Kommen und Gehen, ihr Umherirren in den Straßen und Gassen, auf den Wegen, die zu ihm führten, als selbstverständlich hingenommen. Sie hatte in der Mitte all seiner Gedanken und Vorstellungen einen sicheren und ehrenvollen Platz. Und wenn sie jeweils kam … Ihre schöne Gestalt. Oder hatte er sie bloß so gesehen? Nein, sie war wirklich schön. Ihre Augen, ihre Lippen, ihre Stimme … Immer wenn sie durch die Tür kam, sagte er unwillkürlich: »Sie ist da, es gibt sie wirklich.«
»Jahrelang habe ich auf sie gewartet. Nun ist sie da. Träume ich?« Nein, es war kein Traum. Sie war wirklich. Sie kam, siebzehnjährig, Ende September – ein Monat, den Gheiss besonders liebte. Das Blut unter der Haut ihrer Wangen war hell, aus ihren Pupillen blitzte der jugendliche Scharfsinn, sie versprühte eine Kraft, die schwer zu bändigen war. Sie setzte sich auf den Stuhl, legte die Hände auf die Knie. Nur für einen kurzen Augenblick konnte sie ihm in die Augen schauen. Eine artige Schülerin, so saß sie vor ihrem Lehrer. Gheiss konnte sie gut beobachten, er sah sie klar und deutlich, wie ein erfahrener Künstler, der unerwartet vor einem ihn begeisternden Werk steht. Aber er war erfahren genug und konnte sich beherrschen, griff sofort nach der Zigarettenpackung und suchte fahrig auf seinem Schreibtisch nach Streichhölzern.
Halb geraucht, wirft Gheiss die Zigarette weg. Starr vor Kälte steht er auf dem Friedhof, wo die hochgewachsenen Tannen mit ihren dürren Ästen die Wolken berühren. Hier ist der Himmel niedrig und grau. Gheiss ist erfüllt von Sehnsucht, Sehnsucht nach dem Antlitz und der Nähe eines Menschen, der unabweisbar sein ganzes Wesen beherrscht. Er muss sie sehen. Er sieht sie. Immer, wenn er will, sieht er sie. Wie eine Taube fliegt sie dann zu ihm und setzt sich neben ihn. Auch jetzt sitzt sie neben ihm, auf der Steinbank, so wie einst auf der Steinbank in einem Stadtpark von Teheran. Er dreht sich um, schaut sie an. Ja, das ist sie, die hier auf der Steinbank sitzt. Aber, wie seltsam, sie hat kein Gesicht. Er sieht sie genau an. Sie hat kein Gesicht. Sie sitzt da, ohne sich anzulehnen, mit leerem Gesicht, leerem, unsichtbarem Blick. Achtundzwanzig, neunundzwanzig Jahre alt muss sie jetzt sein. Sie ist still, stumm, genau wie er selbst, wenn der graue Himmel ihn niederdrückt und die Kälte ihn zernagt. Das einzige Zeichen von Wärme ist die halb gerauchte Zigarette, die er vor seine Füße geworfen hat und nun mit dem Schuh zertritt. Warum, warum bloß … Er legt seine Hände auf die Knie, so wie sein Vater, der, wenn er verzweifelt war, sich auf einen Stein oder auf die Treppe setzte, ein Bein über das andere legte, die Arme über den Knien kreuzte und auf einen Punkt in der Ferne starrte. Diesen Punkt, der durch das Weltall wirbelt und mit seinen verwirrenden Drehungen und Windungen jeden vernünftigen Menschen aus dem Gleichgewicht bringt. Vielleicht war der Vater in solchen Augenblicken nicht erschöpft, aber …
Ich bin erschöpft, meine Hände haben keine Kraft mehr. Warum? Ich konzentriere mich, sammle meine ganze Aufmerksamkeit, vielleicht gelingt es mir, ihre Stimme zu hören. Aber nein, die Mühe ist vergeblich. Da ist nur eine Krähe, die auf dem höchsten Ast mit den Flügeln schlägt. Mein Kopf, mein Kopf dröhnt vor Schmerzen. Es kommt vom vielen Reden. So lange schon rede ich mit mir. Tonnenweise Sätze, in allen Tonlagen, in den unterschiedlichsten Stimmungen, voller Widersprüche … Ich redete, hörte zu, schwieg, regte mich auf, schimpfte, beherrschte mich wieder, wurde wütend und merkte, dass meine Augen dabei brannten, als würden sie Feuer sprühen. Ich wollte weinen und konnte nicht. Schon lange kann ich nicht mehr weinen. Ich habe es ihr mehrmals gesagt. Meine Augen glühen nur noch, sie sprühen Feuer, und später merke ich, dass sie kaum feucht geworden sind. Woher kommt diese rätselhafte Fähigkeit unseres Gehirns, in einem einzigen Augenblick unendlich viele Bilder, Worte und Erinnerungen aufnehmen zu können … Und wenn diese Augenblicke sich ohne Unterbrechung aneinanderreihen, scheinen sie sich grenzenlos auszudehnen. Wie lange habe ich jetzt schon geredet, wie lange werde ich weiterreden? Und nun wieder das Schweigen, die Bäume, die Wolken und der Flug der Krähe durch das ewige Grau. Ich habe darum gebeten, dass sie kommt und sich neben mich setzt. Sie ist gekommen und hat sich neben mich gesetzt, so wie sie es schon ein Dutzend Mal, hundert Mal getan hat, fröhlich, mit großer Lust. Doch dieses Mal hat sie kein Gesicht, und ich habe keine Stimme. Ich sehe den alten Mann, alleine auf der Steinbank sitzend, er holt ein Notizbuch und einen Füllhalter aus der Tasche seines Regenmantels, beginnt zu schreiben. Er sitzt gebückt, das linke Bein über dem rechten, so wie mein Vater … Aber wozu das alles? Sie, die diese Zeilen lesen soll, hat kein Gesicht, keine Augen, um die Worte und Sätze zu lesen. Für wen schreibt also der Mann mit dem gebückten Rücken? »Meine Welt ist mir geraubt worden …« Wer soll solche Sätze denn lesen? So viel Verwirrung. All die Bilder und Wörter finden keine Nähe zueinander und können nicht miteinander verschmelzen!
»In die Seele des anderen eindringen, die eigene Seele ablegen, das eigene, einmalige, gereifte Leben dem anderen widmen …«
»Du und ich sind zwei Hälften eines Menschen.«
»Nein, du und ich waren schon immer verschmolzen. Ohne dich wäre ich nicht das, was ich bin.«
»Du sprichst aus, was mir auf der Zunge liegt. Vielleicht wäre ohne dich kein Leben in mir.«
Ein Gewirr von Bildern, und Schweigen, in dem noch die Gespräche atmen. Wo sind all diese unendlich vielen Wörter geblieben? Warum stechen sie, wenn sie verschwunden sind? So viel Leben war im Schweigen und im Reden … Man sollte alles, was im Hirn abläuft, im selben Tempo aufschreiben können. Das ist unmöglich. Wer schnell und rege denkt, wird darum beim Schreiben betrogen, er kann nicht einmal einen Bruchteil der Masse seiner Gedanken zu Papier bringen … Was tun? Man muss sich einreden, dass es einem gelungen ist, die Substanz dieser Masse von Gedanken aufzuschreiben …
Der Mann mit dem gekrümmten Rücken scheint von solchen Zwängen frei zu sein. Er sitzt geduldig und schreibt seit Stunden, wie ein vernünftiger Mensch, der sein Testament schreibt.
Gheiss wird noch einmal erschüttert von der Erinnerung an jenen Stoß, der ihn in der Nacht aus der Lektüre eines Buches herausriss. Ein Blitzschlag war ihm durch den ganzen Körper, vom Kopf bis zu den Füßen, gefahren. Dann war er wie festgenagelt, starrte verdutzt ins Leere und fühlte, dass allein die Vorstellung eines hässlichen Bildes ihn zugrunde richten könnte. War er bereits zugrunde gerichtet? Nein, man kann doch nicht den eigenen Untergang von außen betrachten …
»Warum vernichtet Gott nicht mein Denkvermögen?«
Er dreht sich, um wie immer Nilufars Gesicht zu sehen, er will ihr klar und deutlich sagen: »Weißt du, wie dieses Bild mich erschütterte? Ich hatte die Vorstellung, ich sei in einen Eiszapfen verwandelt, der von einer Eissäule abgebrochen war. Ich hockte auf dem Boden und war völlig von Sinnen.«
»Warum vernichtet Gott nicht mein Denkvermögen? Wie soll ich weiterdenken, nachdem du mich verzaubert hast und jeden meiner Gedanken beherrschst?«
Aber sie hat kein Gesicht, keine Augen, sie kann nicht sehen. Gheiss denkt nur an sie, immer nur an sie. Was muss ihm zugestoßen sein, dass er sich wünscht, sein Denken, der Sinn seines Daseins, möge vernichtet werden! Einbildung … Einbildung … Er hofft auf Selbstvernichtung, weil er es nicht erträgt, dass die Bilder größter Lebenskraft und Schönheit von den niederträchtigsten Gedanken verdrängt werden. Sie treiben dich in Verzweiflung und Wahnsinn, bevor sie dich zugrunde richten.
»Man nennt jemanden schön, um ihn zu beschreiben. Das geht so nicht bei dir. Nein, du warst das Leben selbst. Dein Atem, dein Atem, deine Atemzüge …«
Wie ein unsichtbarer Hauch kam das Leben auf dich zu, streifte dich und zog dich hinein in eine atemberaubende Zauberwelt. Doch nun, welche Wende des Schicksals! Wenn Flüche wirken könnten, wäre ich längst zum Mörder geworden. Wie habe ich das verdient? Ich war doch kein gedankenloser Abenteurer, kein verantwortungsloser Nichtsnutz.
»Du kamst, und ich sagte mir: Sei willkommen, endlich ist sie erschienen.«
Ihm war, als hätte er sie schon immer gekannt. Woher? Und warum? So viele Tage und Nächte hatte er bereits verbracht in der Erwartung, dass sie käme.
»Ein Rätsel … Kann ich es begreifen? Mich ihm nähern? Kann ich es lösen?«
Mehr als einmal hatte er ihr gesagt: »Auch wenn es dich nie gegeben hätte, wäre ich zeit meines Lebens auf der Suche nach dir gewesen, herumirrend auf den Straßen und Gassen, heimatlos auf meinem Weg, der in einem verborgenen Winkel meines Geistes begann. Und als du schließlich erschienst, sagte ich bloß: Endlich, da bist du!« Er sagte ihr nicht: Dein Erscheinen hat mich wieder mit Leben erfüllt und von dem allgegenwärtigen Tod befreit, der mich bisher stets begleitet hatte. Er sagte nicht: Deine Stimme hat die gestaute Wut in mir zum Platzen gebracht, in der Mitte meines Lebens mein Innerstes aufgewühlt, mir ermöglicht, mich wieder zu fassen und zu erneuern im Glanz deiner sprühenden Augen. Wie viele Jahre habe ich warten müssen, bis du kamst. Befreit von der Last sah ich, wie du aufgeblüht bist, und war glücklich, dass du nicht die Rolle der Beschämten spieltest. Ich bewunderte deinen Mut, deine Offenheit, deine Reife. Mein Blick lag auf dir mit dem Stolz eines Mannes im mittleren Alter, der an seinem Leben verzweifelt war, bis er sich in deinem Blick unverhofft wiederfand.
Dieses kriechende, dahinalternde Leben, plötzlich nahm es dich in sich auf und war überwunden. Begeistert, berauscht, gereift und sachte ging es weiter seinen Weg. Die Trümmer der Erschöpfung aus langen Jahren fielen Stück für Stück ab von der über vierzig Jahre alten Gestalt. Wie die Rinde einer alten Platane, die am Ende eines jeden Winters ein neues Leben beginnt. Ein Fingerzeig von ihr, und schon schaffte er es, sich zu enthäuten.
Und nun dieser Hass! Nach so viel Liebe und Zuneigung, wie sollte er diesen nie zuvor gekannten Hass bewältigen? War das der Preis für die Verwandlung? Wo lag der Sinn dieser Erniedrigung und Vernichtung? Sollte Gheiss begreifen, dass die stärkste Seite seines Wesens auch seine größte Schwäche war?
»Du hattest nicht den Mut, mir zu sagen: Ich kann dich zerstören, und ich werde dich zerstören.«
Nein, zu solchen Worten war sie nicht fähig. Und doch, sie hatte versucht, es ihm begreiflich zu machen.
Er wendet das Gesicht und schaut sie an wie immer. Aber sie hat kein Gesicht. Sonst müsste sie jetzt brennen, lodern und zerschmelzen vor Scham. Ihre Tränen wären fließendes Wasser auf der Glut ihrer Wangen. Aber sie sitzt neben ihm auf der kalten Steinbank und hat kein Gesicht. Vielleicht hat sie es verloren, verkauft. »Was weiß ich!« Gheiss wundert sich über nichts mehr. Nicht einmal darüber, dass ihn all das so überrumpelt hat. War er zu leichtgläubig gewesen? Warum hatte er sich auf seine Überzeugungen verlassen?
Der alte Mann richtet den Kopf auf und erhebt sich. Fast sieht es aus, als würde er Gheiss wiedererkennen. Warum eigentlich müssen zwei Menschen sich begegnet sein, um sich aneinander zu erinnern? Nein, das muss nicht unbedingt sein. Gheiss hatte »sie« ja auch lange gesucht, noch bevor »sie« geboren wurde.
»Also kann ich mich an einen Menschen erinnern, der erst nach mir leben wird. Und dies auf einem kalten Friedhof, unter einem grauen Wolkendach. Wolken, die sich so ballen und türmen, dass sie sich zu einem Dach schließen.«
Der alte Mann steht jetzt aufrecht und ist sich sicher, dass der andere ihn unentwegt beobachtet und kein Auge von ihm ablässt. Er weiß auch, dass der andere bemerkt, wie er die Notizen angewidert auf die Steinbank legt. Er bückt sich, nimmt ein paar Steine, legt sie auf die Blätter und geht davon. Und Gheiss wird mit jedem Schritt, mit dem der andere sich entfernt, zu den Blättern herangezogen, die nun auf der verlassenen Bank liegen. Er will hasten, aber seine Schritte werden weder schneller noch langsamer als die des Alten. Als er die Bank erreicht und mit großer Neugierde nach den Notizen greift, durchzuckt ihn die Frage, ob der alte Mann, der nun nicht mehr zu sehen ist, einen Gehstock in der Hand hatte. »Seltsam, spielt es denn eine Rolle, ob der alte Mann mit oder ohne Stock gegangen ist? Was einem alles in den Sinn kommt!« … Gierig wie ein Dieb greift er nach den Blättern, die sich vom Einband gelöst haben, steckt sie in die Tasche seines Regenmantels und will so rasch wie möglich zu dem italienischen Café gelangen. Doch der Hut, der Schal, der Regenmantel und der Koffer, den er zu tragen hat, behindern ihn. Er nimmt seine ganze Kraft zusammen, mit der verzweifelten Neugierde eines verwirrten Menschen will er die zerfledderten Blätter lesen, auch wenn er in ihnen nichts Interessantes vorfinden sollte. Am Ende der Chaussee bleibt er stehen, wirft einen Blick zurück auf die Steinbank, auf der er soeben noch saß. In seinem Inneren ist schwarze Grabesstille. Wie ein Kind hofft er auf ein Wunder und wünscht sich, dass dort, hinter den braun-schwarzen Baumstämmen, ihr vertrautes Gesicht im Grau aufscheine, ihre Augen, ihr Lächeln, nur für einen einzigen Augenblick, zum letzten Abschied.
Wahn, Wahn, nichts als Wahn!
Wie ein Verzweifelter setzt er seinen Weg fort, auf dem Gehsteig, entlang der alten, moosbewachsenen Mauer. »Wie viel leichter wäre alles, wenn ich diesen verdammten Koffer nicht mitschleppen müsste, auf den Straßen und Gassen, sogar auf dem Friedhof … Und auf dem Weg entlang der Mauer, auf deren alten Steinen das Moos wuchert.« Aber es ist, wie es ist. Er muss zum italienischen Café, dort seinen Hut, Schal und Regenmantel in eine Ecke legen, einen Kaffee oder Tee bestellen und die Notizen lesen. In einigen Stunden wird er hier seinen Gastgeber treffen, er darf ihn ja nicht verpassen, wenn er aus der U-Bahn-Station herauskommt und am Fenster des Cafés vorbeiläuft. Er setzt sich auf einen Stuhl, vom dem aus er den Gehsteig im Blick hat. Der Italiener, hager, grauhaarig, stellt die Kaffeetasse und einen sauberen Aschenbecher vor ihn. Vermutlich wird er, wenn er das Restgeld auf den Tisch legt und den Aschenbecher abräumt, nicht schon wieder sagen: »Sie rauchen zu viel.« Nein, nein, allmählich wird er seine Zigarettensucht akzeptieren. Aber verstehen wird er diese Selbstzerstörung nie.