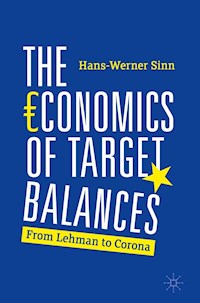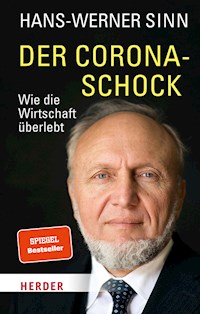
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Corona-Krise ist der tiefste wirtschaftliche Einbruch in Friedenszeiten seit der Weltwirtschaftskrise vor 90 Jahren. Die neue Krise trifft auf eine ohnehin schwächelnde europäische Wirtschaft. Wie erhalten wir unseren Wohlstand? Wie vermeiden wir einen ökonomischen Absturz mit Massenarbeitslosigkeit und Radikalisierung der Politik? Und gibt es einen Weg, den Kontinent zu alter Prosperität zurückzuführen und die Staaten politisch zu stabilisieren? Mit Hans-Werner Sinn äußert sich der bekannteste deutschsprachige Ökonom fundiert und kompakt dazu, wie wir diesen beispiellosen ökonomischen Crash überwinden und ihn dazu nutzen, längst fällige Strukturprobleme der europäischen Wirtschaft und des Geldwesen anzupacken. Nur dann hat auch die europäische Idee, die im Augenblick gefährdet ist wie nie, eine Überlebenschance. Ein wegweisendes und mutiges Zukunftsprogramm zur richtigen Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © Stefan Boness/IPON – Ullstein Bild
E-Book-Konvertierung: Arnold & Domnick, Leipzig
Herstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN Print: 978-3-451-38893-4
ISBN E-Book: 978-3-451-82194-3
Inhaltsverzeichnis
Der Corona-Schock und der Hamilton-Moment – Einleitung
„Als man in Wuhan abriegelte, waren schon ein paar Millionen Menschen verschwunden.“
„Mit einem Federstrich hat die chinesische Regierung die Todeszahlen um die Hälfte erhöht.“
„China wird und muss die Weltwirtschaft rausreißen.“
„Die deutsche Regierung hat ihre historische Chance gegenüber Italien verpasst.“
„Der Lockdown war richtig.“
„Der Sozialstaat schützt auch gegenüber konjunkturellen Krisen.“
„Eine weitaus schlimmere Rezession als nach der Lehman-Krise hat die Welt erfasst.“
„Es hängt alles davon ab, ob die zweite Welle kommt.“
„In einem Punkte war das Mittelalter schon weiter.“
„Ein Glück, dass es Flickenteppiche bei der Corona-Politik gibt.“
„Die Corona-Krise verschärft die Krise des Euroraums.“
„Der Wiederaufbaufonds ist ein Etikettenschwindel.“
„Papandreou wollte austreten.“
„Die wundersame Geldvermehrung durch das Corona-Virus“
„Wenn die Inflation beginnt, können wir sie nicht mehr abbremsen.“
„Die Begründung für die Staatspapierkäufe ist im Kern scholastisch.“
„Viele denken, bei dem großen Corona-Fonds geht es darum, Italien zu retten, es geht aber vor allem darum, die Gläubiger des italienischen Staates zu retten.“
„Dann wären wir bei über 100 Prozent Schuldenquote. Griechenland ließe schön grüßen.“
„Es macht keinen Sinn, die deutsche Automobilindustrie zu dezimieren und zu hoffen, damit der Umwelt zu dienen. Das Gegenteil könnte der Fall sein.“
„Die Corona-Krise kostet uns sehr viel Geld, und wir sollten Luxusthemen, die teuer sind, überdenken. Dazu gehören die deutschen Alleingänge in der Klimapolitik.“
„Eine Nachfragepolitik ist nur von begrenztem Wert in dieser Krise.“
„Man braucht jetzt nur Corona zu sagen, und es ist Geld für alles und jedes da.“
„Wir müssen vor allem unsere Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe erhalten.“
„Die Räder der Industriegesellschaft müssen und werden sich wieder drehen.“
„Da wird natürlich wieder der Wunsch aufkommen, die Reichen zu schröpfen.“
„Die neue Normalität wird der alten Normalität sehr ähnlich sein.“
„Ich erwarte kein Ende des Tourismus und des Flugverkehrs.“
„Nur der private Wettbewerb um den Impfstoff verspricht schnellen Erfolg.“
„Im Corona-Sturm wird ein riesiger Schattenhaushalt für die EU errichtet.“
„Die Schuldensozialisierung ist Sprengstoff für die Union.“
„Wir müssen bessere Vorsorge betreiben, damit die Politik in ihren Entscheidungen frei bleibt.“
„Die Zeit der Träumereien ist vorbei. Wir müssen realistischer agieren und unsere eigene Sicherheit besser schützen.“
„Das große Damoklesschwert ist die Demografie.“
„Wenn die Menschen langfristig denken, dann tut es zwangsläufig auch die Politik.“ – Schluss
Über den Autor
Der Corona-Schock und der Hamilton-MomentEinleitung
Als der deutsche Finanzminister Olaf Scholz in einem Interview in der ZEIT (20. Mai 2020) zur Kreditaufnahme der EU im Umfang von zunächst 500 Milliarden Euro befragt wurde, mit deren Hilfe Angela Merkel und Emmanuel Macron die aufgrund der Corona-Epidemie drohenden Staatskonkurse in Südeuropa abwenden wollen, griff er zu einem historischen Vergleich. Im Zuge einer tieferen Integration der EU sollte eine zeitweilige Aufnahme von Schulden auf europäischer Ebene kein Tabu sein, so Scholz. Für eine solche Fiskalreform gebe es historische Vorbilder: Der erste US-Finanzminister Alexander Hamilton habe im Jahr 1790 unter anderem eine eigenständige Verschuldungsfähigkeit des Zentralstaats erreicht. Hamilton hatte in der Tat kurz nach der Gründung der USA die Schulden der Einzelstaaten zu Bundesschulden gemacht. Er argumentierte, diese Schulden seien im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten entstanden und müssten nun auch gemeinsam getragen werden. Sie seien „Zement“ zur Festigung des neu gegründeten Staates. Aus einem großen Programm zur Rettung nicht wettbewerbsfähiger Volkswirtschaften des Eurogebietes konstruierte der Finanzminister – analog zu seinem großen Kollegen in den Vereinigten Staaten von Amerika – ein Gründungsmoment für die Vereinigten Staaten von Europa. Dass der EU-Kommission eine Kreditfinanzierung ihrer Ausgaben nach Artikel 311 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union verboten ist, klingt dann angesichts von so viel Pathos fast kleinlich.
Der von Olaf Scholz herangezogene Vergleich ist schief, weil Europa anders als seinerzeit die USA noch keinen gemeinsamen Staat gegründet hat. Vor allem aber ist der Vergleich wegen der schlechten Erfahrungen, die die USA nach 1790 mit der Schuldenunion machten, ziemlich beunruhigend. Die unkontrollierte Kreditaufnahme, die aus Hamiltons Schuldenunion und auch aus der Vergemeinschaftung der Schulden im zweiten Krieg gegen die Briten in den Jahren 1812 bis 1814 folgte, führte zu einer Blase, die in der zweiten Hälfte der 1830er Jahre platzte.
Die Blase entstand, weil die Gläubiger sich angesichts der Rückendeckung durch den Bund sicher wähnten und mit niedrigen Zinsen begnügten, während die Schuldner der Verlockung der niedrigen Zinsen nicht widerstehen konnten und sich immer mehr verschuldeten. Die normale Schuldenbremse, die aus dem Umstand resultiert, dass die Gläubiger aus Angst vor dem Verlust ihrer Forderungen immer höhere Zinsen verlangen, wenn die Schuldner sich nicht mäßigen wollen, und die Schuldner deshalb die Verschuldung immer unattraktiver finden, war außer Kraft gesetzt. Wie stets ließ sich die Schuldenorgie gut an. Es wurde kräftig in die Infrastruktur investiert. Straßen, Brücken und Kanäle wurden gebaut, um die Städte miteinander zu verbinden. Das schuf Jobs für die Bauarbeiter und versprach, ein Wachstumspotenzial für die Zukunft zu entwickeln. Preissteigerungen bei Grund und Boden heizten auch die private Baukonjunktur an, weil immer mehr Investoren auf den schnellen Reichtum hofften. Doch waren nicht alle Projekte rentabel, zumal die Eisenbahn, die in den 1830er Jahren aufkam, die teuren Kanäle obsolet werden ließ. Mitte der 1830er Jahre kippten die Erwartungen, und auf einmal kam es zum Investitionsstreik. Investoren und Gläubiger befürchteten Verluste. Sie stoppten ihre Projekte oder wollten ihr Geld zurück. Es kam zu vielen Privatkonkursen, denen staatliche Konkurse folgten.
In den fünf Jahren von 1837 bis 1842 mussten neun der damals existierenden 29 Staaten und Territorien der USA ihre Zahlungsunfähigkeit erklären. Der Zentralstaat hatte zwar anfangs versucht, die Lasten zu übernehmen, doch fehlten ihm die Mittel, weil die Geldgeber auch ihm misstrauten. Nichts als Hass und Streit war durch die Schuldenunion entstanden. Der Historiker Harold James hat dazu lakonisch bemerkt, Hamilton habe dem neuen Staat nicht Zement, sondern Sprengstoff geliefert. In der Tat kann man eine direkte Linie zu dem Jahre später einsetzenden Sezessionskrieg ziehen. Die unlösbare Schuldenproblematik, so James, hat zu den Spannungen beigetragen, die sich in diesem Krieg entluden.
Die Amerikaner sind aus ihrem Schaden klug geworden, denn sie reagierten darauf, indem sie strikte Schuldengrenzen für die Einzelstaaten verabredeten und der Schuldensozialisierung ein Ende bereiteten. Bis heute muss ein jeder Bundesstaat mit seinen Schulden selbst fertigwerden und kann nicht auf die Rettung durch den Zentralstaat hoffen. Nicht einmal die erst im 20. Jahrhundert gegründete Zentralbank der USA, die Federal Reserve Bank, half aus. Sie kauft keine Anleihen der Einzelstaaten und hilft jenen Staaten, die sich übernommen haben, nicht aus der Bredouille. So konnten auch Kalifornien, Minnessota und Illinois, die in den letzten Jahren ernsthafte Finanzkrisen hatten, nicht auf die Hilfe mit der Notenpresse rechnen. Diese strikte Haltung gegenüber den Schulden der Mitgliedsstaaten hat die amerikanische Föderation bis zum heutigen Tage stabil gehalten.
Der Corona-Schock ist heute unser Hamilton-Moment. Er zwingt uns zu wählen zwischen Sprengstoff und Zement.
Die Hamilton’sche Idee, ihre Wirkungsgeschichte und ihr aktuelles Wiederauftauchen zeigen: Krisenzeiten sind politisch verführerisch. Finanzielle Begehrlichkeiten lassen sich plötzlich durchsetzen, alte politische Ideen lassen sich als neue Rezepte zur Lösung aktueller Probleme verkaufen, und sachliche oder juristische Bedenken können mit dem Verweis auf die Ausnahmesituation der Krise übergangen werden. Der wahre Souverän hält sich in normalen Zeiten vornehm zurück, doch in der Krise trumpft er unmissverständlich auf und zeigt, wer das Sagen hat.
Krisenzeiten bieten aber auch politische Chancen. Kostspielige und wenig effektive staatliche Maßnahmen lassen sich beenden, Fehler können eingestanden und Fehlentwicklungen abgestellt werden, Sachargumente und Pragmatismus können gegenüber dem Wunschdenken punkten.
Deutschland und Europa haben jetzt die Wahl, ob sie, dem Druck des Augenblicks nachgebend, die alten Fehler reflexhaft wiederholen möchten oder nicht. Vielleicht ist Corona eine Chance, tatsächlich existierende Strukturprobleme zu erkennen und entsprechend zu behandeln und auch zu erkennen, welch einen Unsinn wir teilweise gemacht haben. Das betrifft beispielsweise die brandgefährliche Vergemeinschaftung von Schulden im Euroraum oder die weitgehend wirkungslose, aber teure Klimapolitik der Bundesregierung. Das betrifft die Zerstörung des Rückgrats der deutschen Wirtschaft, der Automobilindustrie, oder den bisher eher laxen Umgang mit drohenden Risiken wie einer weiteren Pandemie. Politik und Gesellschaft können die Corona-Krise nutzen, um diese Fehler endlich klar zu benennen und statt politischen Wunschdenkens ökonomischen Realismus einziehen zu lassen, damit Solidarität, Wohlstand und Friede in Deutschland und Europa dauerhaft erhalten bleiben.
Dieses Buch soll ein Anstoß sein, die richtigen ökonomischen Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen und zu einer Kultur der Vorsorge und des Realismus zu gelangen.
Zuerst beschreibe ich, wie es zum Corona-Schock kam, in welcher Verfassung sich die Wirtschaft in Deutschland und Europa vor diesem Schock befunden hat, und welche Gefährdungen hier schon vorlagen. Dann geht es um die ökonomischen Auswirkungen des Corona-Schocks und die unterschiedlichen Maßnahmen, die zu seiner Bekämpfung herangezogen und vorgeschlagen werden. Schließlich kehre ich zum Beginn dieses Buches zurück, in dem ich die wichtigsten Lehren formuliere, die wir nach meiner Meinung aus dieser Krise ziehen müssen.
Das Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung, deren Aufbau einer strengen Systematik folgt. Vielmehr ist es aus Gründen der besseren Lesbarkeit in Frage-Antwort-Form und im Tonfall eines Gesprächs gefasst, und es erlaubt sich Redundanzen und assoziative Sprünge, wie sie in einem Gespräch üblich sind. Das Gespräch hat auch tatsächlich mit Patrick Oelze, dem Lektor des Herder-Verlages, stattgefunden. Indes sind die Fragen und Antworten im Nachhinein stark verändert und umgestellt worden.
„Als man in Wuhan abriegelte, waren schon ein paar Millionen Menschen verschwunden.“
Wo liegen die Ursprünge dessen, was Sie als „Corona-Attacke“ beschrieben haben?
Es ist wahrscheinlich, dass die Epidemie in Wuhan begann, einer chinesischen Stadt mit elf Millionen Einwohnern, und sich von dort aus verbreitet hat. Ob die ersten, allerersten Ursprünge möglicherweise irgendwo sonst gelegen haben, ob das erste Virus nach Wuhan gebracht wurde oder auch nicht, ist nicht bekannt. Wir wissen aber, dass die ersten offiziell den Behörden übermittelten Informationen schon im Dezember vorlagen. Um den 26. Dezember herum hat ein Arzt (Li Wenliang) die Behörden informiert, dass ein neues Virus und damit eine neue sehr gefährliche Krankheit unterwegs sei. Man hat ihm nicht geglaubt und das zuerst totgeschwiegen. Erst im Januar hatte sich die Epidemie so weit ausgebreitet, dass die Behörden sich nicht mehr in der Lage sahen, sie weiter zu vertuschen. Und dann stand das chinesische Neujahrsfest bevor, das um den 25./26. Januar seinen Höhepunkt hat. Da fahren die chinesischen Arbeitskräfte typischerweise nach Hause zu ihren Familien. Man befürchtete, dass es dadurch zu sehr viel Ansteckung kommen würde. Außerdem gibt es dann öffentliche Feste, wo das Virus auch verbreitet worden wäre. Diese öffentlichen Feste sind von der chinesischen Politik verboten worden. Aber die Epidemie war im Gang, die Familien kamen trotzdem zusammen, und man musste Wuhan abriegeln.
Bevor die Stadt abgeriegelt wurde, waren schon einige Millionen Menschen verschwunden. Sie hatten in Erkenntnis dieser Epidemie das Weite gesucht. Das führte auch dazu, dass sich das Virus im Rest Chinas ausbreitete und man überall entsprechende Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung und Eingrenzung vorgenommen hat.
Von Wuhan kam das Virus dann vermutlich nach Italien, denn Italien hat sehr viele chinesische Kontakte. Vor einem Jahr, im Frühjahr 2019, ist ein großes Wirtschaftsabkommen zwischen China und Italien geschlossen worden, das sehr viel Personenaustausch beinhaltet. Und dann gibt es natürlich die chinesischen Touristen, die die italienischen historischen Städte lieben. Vor allem aber gibt es sehr viele chinesische Gastarbeiter in der italienischen Textilindustrie, konzentriert in der Lombardei. Die offiziellen Angaben liegen bei über 300 000 Personen.
In Prado, einer Stadt in der Nähe von Florenz, gibt es ganze chinesische Viertel. Doch überall in der Lombardei und auch in anderen Provinzen sind chinesische Gastarbeiter im Einsatz. Diese Chinesen hat man geholt, weil die italienische Textilwirtschaft angesichts der vergleichsweise hohen italienischen Löhne nicht mehr in der Lage war, der Konkurrenz der Asiaten etwas entgegenzusetzen. Ohne sie wäre die Textilindustrie vollends nach Asien abgewandert. Die Chinesen arbeiten unter Sonderbedingungen zu sehr viel niedrigeren Löhnen und auch unter einem niedrigen sozialstaatlichen Schutzniveau. Viele arbeiten schwarz, kommen mit Touristenvisen und sind dann bei chinesischen Firmen beschäftigt, die in Italien produzieren. Als diese Arbeiter Ende Januar vom Neujahrsfest zurückkamen, bei dem sie ihre Familien sahen, brachten sie das Virus mit. Die italienische Regierung hat dann am 30. Januar die Notbremse gezogen und Flüge aus China verboten. Aber das waren ja nur die Direktflüge. Die Leute sind dann auf Umwegen über andere Flughäfen trotzdem wieder nach Italien zu ihren Arbeitsplätzen zurückgekehrt.
„Mit einem Federstrich hat die chinesische Regierung die Todeszahlen um die Hälfte erhöht.“
Hat China am Ende aus Ihrer Sicht richtig gehandelt?
Die Erfolgsmeldungen kamen sicher zu früh. Ich weiß von Kollegen in China, dass, auch als man die Epidemie als beherrscht hinstellte, in Wahrheit die Restriktionen für die Bevölkerung noch ganz massiv waren, dass die Behörden vor Ort also offenbar nach wie vor ein riesiges Problem hatten. Auch muss man wissen, dass China im Nachhinein mit einem Federstrich die Todeszahlen um die Hälfte erhöht hat. Das erwies sich wohl als notwendig, weil überall in der Welt sehr viel höhere Todeszahlen gemeldet wurden als in China, wobei China der ursprüngliche Herd der Infektion war. Es war also gar nicht glaubwürdig, dass die Zahlen so niedrig sein konnten. Aber es ist wohl auch richtig, dass die Chinesen, die wie die anderen Asiaten schon mit der SARS-Infektion aus dem Jahre 2003 Erfahrungen hatten, sich insofern frühzeitig alarmiert gezeigt haben und dann sehr entschlossen umfassende Quarantänemaßnahmen ergriffen und auch Tests durchgeführt haben, um die Epidemie im Keim zu ersticken. Die Härte, die der chinesische Staat dabei gegenüber den Kranken und den gefährdeten Personen zeigte, können und wollen wir uns nicht leisten. Schon bei unseren milden Maßnahmen der häuslichen Quarantäne haben Menschen in Deutschland aufbegehrt, weil sie nicht einsahen, dass ihre Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. Ich habe dafür Verständnis, halte es aber doch mit unseren Virologen, die zur Vorsicht mahnen.
Auch in den USA gibt es massive Protestbewegungen. Die Leute sind wegen der Einschränkungen aufgebracht und protestieren überall. Sie sind aber auch aufgebracht wegen der Massenarbeitslosigkeit, die plötzlich wegen der Epidemie ausbrach und 40 Millionen Amerikaner erfasst hat. In dieser angespannten Situation wirkte das Video eines Passanten, der das brutale Vorgehen der Polizei gegen einen Schwarzen (George Floyd) aufgenommen hatte, der dabei zu Tode kam, wie ein Zündfunke, der eine brisante gesellschaftliche Gemengelage zur Explosion brachte.
In den USA gibt es viermal so viele Corona-Tote in Relation zur Bevölkerung wie in Deutschland, und in Deutschland gibt es 15-mal so viele wie in Japan und 20-mal so viele wie in Südkorea. Diese Länder haben aus der SARS-Epidemie gelernt und greifen sofort zu, wenn Krankheitsfälle auftreten. Man kann also nicht abstreiten, dass die strikten Maßnahmen vieler asiatischer Länder die Ausbreitung der Krankheit in der Bevölkerung wesentlich verhindert oder verlangsamt haben. Das gilt letztlich auch für China, auch wenn das Land wegen seiner illiberalen Vorgehensweise für uns kein Vorbild sein kann.
„China wird und muss die Weltwirtschaft rausreißen.“
Welche Rolle kann China bei der Bewältigung der aktuellen Wirtschaftskrise übernehmen?
China hat sonst immer ein jährliches Wachstum von etwa sechs Prozent verzeichnet, und nun hat es für den Februar 2020 zugestanden, dass die Industrieproduktion um 20 Prozent eingebrochen ist. Das sind klare und harte Effekte, die man direkt beobachtet hat. Inzwischen hat die Produktion aber in China schon wieder stark angezogen. Dennoch fehlt natürlich die Produktion für eine gewisse Zeit und wird das auf das ganze Jahr berechnete Wachstum deutlich reduzieren.
Auch in Deutschland sind einige Branchen von ausbleibenden Lieferungen aus China sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach einer Umfrage des ifo Instituts wissen wir, welche Unternehmen schon im März von der Epidemie betroffen waren. Das waren natürlich insbesondere die Reisebüros und das Gastgewerbe; das hat mit China nichts zu tun. An dritter Stelle kommt aber schon die Herstellung von elektronischen Ausrüstungen von Datenverarbeitungsgeräten, dann von optischen Erzeugnissen an vierter Stelle. Etwa drei Viertel der befragten Unternehmen sagten hier, dass sie beeinträchtigt sind, und das liegt daran, dass sehr viele Vorprodukte im elektrischen Bereich, Halbleiter, Transistoren und Schaltelemente, aus China kommen. Auch der Maschinenbau war mit zwei Dritteln der Nennungen sehr stark betroffen von diesen chinesischen Einschränkungen. Einerseits werden auch dort Komponenten aus China verbaut. Andererseits liegt in China ein wichtiger Absatzmarkt. Die Herstellung chemischer Erzeugnisse war ähnlich stark betroffen. Die deutsche Automobilindustrie hat sich nur zur Hälfte irritiert gezeigt, doch anschließend hatten alle deutschen Automobilhersteller ihre Werke stillgelegt, weil sie unter Absatzproblemen litten und die Vorlieferungen aus China ins Stocken kamen. Im Mai haben sie dann aber die Produktion mit begrenzter Kraft wieder aufgenommen.
China scheint sich schnell zu erholen. Das kann eben daran liegen, dass die Chinesen die Epidemie besser im Griff haben. Es kann aber auch daran liegen, dass die Regierung der Bevölkerung stärkere Verhaltenseinschränkungen und stärkere Risiken zumutet, als man das hier in Europa kann. Jedenfalls ist China wieder dabei, wirtschaftlich Fahrt aufzunehmen.
Alles, was an China hängt, so insbesondere auch die deutschen Automobilhersteller, wird von dem raschen Aufschwung profitieren. China ist der Rettungsanker für die deutsche Automobilindustrie. Dort können wieder deutsche Autos verkauft werden, und von dort kommen wieder die Vorprodukte. Das sind elektronische Komponenten, es sind aber auch mechanische Bauteile, zum Beispiel ganze Achsträger. Ohne diese Teile können manche deutsche Autos nicht produziert werden. Alle Automobilhersteller hatten ihre Produktion eingestellt, weil ebendieses Problem bestand. Jetzt sind sie aber dabei, mit begrenzter Produktion sukzessive wieder aufzumachen, weil China wieder anzieht.
Die deutschen Automobilhersteller haben den großen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten aus aller Welt, dass sie in China prächtig vertreten sind. BMW, Daimler und VW machen große Teile ihres Absatzes in China, VW sogar den allergrößten Teil. Das heißt, wenn China wieder hochkommt, wovon auszugehen ist, dann ist auch VW wieder dabei – wenn man nun endlich die Programmierung des neuen E-Golf in den Griff kriegt. Konkurrenten von anderen Teilen der Welt waren nicht so stark von der chinesischen Krise betroffen, sie kommen aber nun auch nicht wieder so schnell hoch wie die deutschen Hersteller.
Wir haben es mit einem temporär nicht erzeugten Sozialprodukt zu tun, aber es ist nichts im größeren Umfang zerstört worden, was man hätte wieder aufbauen müssen, physisch sowieso nicht und auch von den Unternehmensstrukturen her nicht viel, weil die Rettungsprogramme, in Deutschland jedenfalls, umfangreich zur Verfügung standen. Die wirklichen Probleme für die Zukunft liegen eigentlich eher in Südeuropa und liegen bei unserer Beteiligung an der Finanzierung der dortigen Staaten, die mit der Epidemie ins Stocken geriet.
„Die deutsche Regierung hat ihre historische Chance gegenüber Italien verpasst.“
Das Corona-Virus hat Italien sehr hart getroffen – hängt das auch mit dem italienischen Krisenmanagement zusammen?
Das Krisenmanagement der italienischen Regierung war vorbildlich. Die Italiener haben hart und frühzeitig durchgegriffen und damit ein Beispiel abgegeben für alle anderen europäischen Regierungen, die ihnen gefolgt sind. Italien ist strikter vorgegangen als Deutschland, und entgegen allen Vorurteilen halten sich die Italiener an die Regeln. Ministerpräsident Giuseppe Conte hat sich hier sehr viel Meriten erworben bei der energischen Anti-Corona-Politik.
Es ist eine separate Vorinfektionskette in Italien gelaufen. Das geschah zum Teil verdeckt, weil man von dem Virus anfangs nichts wusste und an eine Grippeepidemie dachte wie jene im Winter 2017/2018, bei der in ganz Europa viele ältere Leute umkamen. Und was die chinesischen Gastarbeiter betrifft, so kann man davon ausgehen, dass Sprachbarrieren zumindest dazu beigetragen haben, dass man die Krankheitsfälle zunächst nicht richtig eingeordnet hat. Wenn etwas ein Problem war in Italien, dann lag das nicht bei der aktuellen Regierung, sondern an der grundsätzlichen Organisation des Krankenhaussystems, das bei Weitem nicht deutschen Standards entspricht, sodass eine Überwältigung der italienischen Krankenhäuser, wie wir es im Fernsehen gesehen haben, früher eintrat, als es in Deutschland der Fall gewesen wäre. Das schlechte Krankenhaussystem in Verbindung mit den hohen Fallzahlen hat die schrecklichen Fernsehbilder von den Gängen der Krankenhäuser und den Leichentransporten erzeugt, die uns alle, auch die Kanzlerin, so schockiert haben.
Für den Rest der Welt waren die frühen italienischen Erfahrungen lehrreich. Sie gaben den Regierungen Zeit, sich vorzubereiten. Unverständlich ist, dass sie dennoch lange brauchten, bis sie reagierten. Erst war auch in Deutschland offiziell von einer grippeähnlichen Epidemie die Rede, als die Virologen schon längt die Alarmglocke betätigt hatten. Immerhin, die Regierungen Deutschlands und anderer Länder folgten dann in einem recht frühen Stadium der eigenen Epidemie dem italienischen Beispiel und erließen sukzessive Quarantänemaßnahmen, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Im Grunde muss man sagen, die deutsche Regierung hat sehr viel Glück gehabt, weil sie mit dem schrecklichen Beispiel Italiens vor Augen früher reagieren konnte, als sie es sonst wohl geschafft hätte.
Die Kommunikation bezüglich Italien ist schwierig. Es ist sicherlich nicht richtig, hier irgendwem Vorwürfe zu machen. Das Virus kam von außen angeflogen und hat die Italiener früher und stärker erfasst als andere. Und deswegen glaube ich auch, dass wir gut daran tun, den Italienern zu helfen. Hier sind zunächst einmal private Initiativen gefragt, und soweit ich weiß, ist spontan einiges passiert, auch wenn es nirgends dokumentiert ist. Meine Frau und ich haben privat nach unseren Möglichkeiten sehr viel an das italienische Rote Kreuz gespendet. Wir haben auch einen Aufruf getätigt, der vom Wirtschaftsbeirat Bayern, in dem Tausende bayerischer Unternehmen vertreten sind, aufgenommen wurde. Viele Unternehmen haben im vier- und fünfstelligen Eurobereich gespendet. Auch außerhalb Bayerns ist der Aufruf auf fruchtbaren Boden gefallen. Das Geld kam italienischen Hilfsorganisationen und Krankenhäusern zugute. Alles war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es sollte ein Zeichen der Solidarität mit unseren geschundenen Nachbarn sein.
Ein wirklich substanzieller Beitrag hätte von der deutschen Regierung geleistet werden können, doch hat sie ihre Chance verpasst. Sie hätte frühzeitig ein Hilfsprogramm für Italien organisieren können, mit unilateral zur Verfügung gestellten Mitteln. Wir brauchen doch nicht die EU, um unserem Nachbarn zu helfen. Man muss sich auch nicht koordinieren, wenn man hilft. Wenn ich jemand anderem helfe, dann tue ich das aus eigenem Antrieb, und ich tue das unabhängig davon, ob andere es auch tun. Hier bedarf es im Grunde überhaupt keiner koordinierten Aktion auf der Ebene der EU, zumal das dazu führt, dass sich dann die EU den Orden für die Rettung Italiens an die Brust heftet, obwohl das meiste Geld aus Deutschland kommt.
Jetzt ist das Thema auf die europäische Ebene gerutscht, und Deutschland wird bedrängt, mehr zu tun, als es kann. Es geht um ganz andere Summen, und man ist schnell der Bösewicht, wenn es nicht reicht. Der Zusammenhalt in der europäischen Union war in der Anfangszeit der Krise sehr stark dadurch strapaziert, dass sich in Italien eine massive antideutsche Stimmung aufgebaut hat, nicht so sehr eine Anti-EU-Stimmung. Wir hätten dieses Thema frühzeitig abfangen können durch Aktionen zugunsten der Italiener, zu denen uns niemand gezwungen hat. Das wäre sicher sehr gut angekommen. Die Hilfsaktionen der Mitglieder des bayerischen Wirtschaftsbeirates haben jedenfalls überschwängliche positive Reaktionen in Italien hervorgerufen.
Was Deutschland stattdessen erlebte, war in abgeschwächter Form eine Wiederholung der Geschichte mit Griechenland. 2010 war Griechenland faktisch konkursreif, es wurden riesige Rettungsschirme aufgespannt, hauptsächlich kam das Geld von Deutschland als größtem EU-Land. Trotzdem wurde Deutschland bezichtigt, Austeritätspolitik zu betreiben, also die Griechen zu einer Einschränkung ihrer Ausgaben, zu Sparsamkeit zu veranlassen. In Wahrheit wurde die Austeritätspolitik aber von den Märkten erzwungen. Der griechische Staat hatte sich mit Krediten finanziert, die aus dem Ausland kamen, und diese Kredite flossen auf einmal nicht mehr, weil die ausländischen Anleger kalte Füße bekommen hatten. Nur daher rührte die Austerität. Die Staatengemeinschaft, allen voran Deutschland, hat damals durch großzügige staatliche Mittel diese Austerität gemindert und gemildert, wie das noch nie relativ zur Wirtschaftsgröße und zur Landesgröße irgendwo in der Geschichte zuvor geschehen war. Trotzdem kriegten wir Hakenkreuzfahnen gezeigt. Das ist leider die bittere Lehre aus dieser Art Hilfsaktionen. Deswegen habe ich damals schon gesagt, es wäre doch richtiger, Deutschland würde keine Kredite geben und sich von der europäischen Politik nicht drängen lassen, sondern aus eigenem Antrieb etwas für unsere griechischen Nachbarn und Freunde tun und ihnen Geschenke zur Verfügung stellen, unilateral. Das wäre ein Zeichen der Solidarität gewesen. Und es hätte vor allem nicht irgendeinen Automatismus begründet, der die deutsche Regierung zu Leistungsversprechen und Leistungen in Zukunft veranlasst.
So etwas ist auch nach Aussage des Bundesverfassungsgerichts nicht zulässig. Der Bundestag darf keinen solchen Mechanismen zustimmen, die automatisch ablaufen und Geld hierzulande abziehen. Eine Hilfe muss immer ein einmaliger Akt sein, freiwillig betrieben vom Helfer in einem Umfang, den er selbst definiert. Sie begründet keinen Rechtsanspruch und keinen politischen Mechanismus, wie er jetzt mit den EU-Maßnahmen etabliert wird.
„Der Lockdown war richtig.“
Waren die massiven Maßnahmen von Bund und Ländern in Deutschland zur Bekämpfung der Pandemie angemessen, und wird nach den richtigen Kriterien entschieden?
In Deutschland hat man relativ spät reagiert, dann allerdings heftig und richtig. Erst dachte man, die Krise kommt nicht zu uns. Die Epidemiologen haben gewarnt und Schutzmaßnahmen von der Politik eingefordert, die nicht kamen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die vielen Diskussionen dazu im Februar. Doch dann kam die Kehrtwende der deutschen Politik, als man sich von der Theorie verabschiedete, es sei doch alles nur wie eine Grippe, und als Angela Merkel am 11. März im Fernsehen die Ansage machte, dass wir eine Durchseuchung akzeptieren müssten, sie aber wegen der Krankenhauskapazitäten verzögern müssten. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit eines Infizierten zu sterben im Schnitt zehnmal so hoch als bei einer Grippe, etwa eine halbes Prozent. Das weiß man aus Wuhan und auch aus den Untersuchungen der Bevölkerung von Heinsberg in der Nähe von Aachen, wo nach einem gravierenden Ausbruch der Epidemie flächendeckende Untersuchungen angestellt wurden. Es drohten also sehr hohe Fallzahlen, sodass man ohne die Quarantänemaßnahmen chaotische Verhältnisse in manchen Krankenhäusern befürchtete. So kam es bekanntlich nicht. Die Bilder der Schlangen von Armeelastwagen voll mit Särgen, die man von Italien kannte, wiederholten sich in Deutschland nicht.
Dass wir das in Deutschland in den Griff gekriegt haben, liegt vor allem daran, dass die Epidemiologen die Politik rechtzeitig überzeugt haben, Großveranstaltungen zu verbieten und Schulen und Kindergärten zu schließen. Das war alles schon in der ersten Märzhälfte, sodass bis Mitte März schon eine deutliche Verhaltensänderung stattgefunden hatte. Dann kam der Lockdown, also eine strikte Beschränkung der zulässigen Kontakte und der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sowie die Schließung von Ladengeschäften, Gastronomie und Freizeit- und Kultureinrichtungen aller Art um den 22. März. Man kann darüber streiten, ob der Lockdown in dieser Form nötig war oder nicht. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, wie viel nötig gewesen wäre.
Ich halte persönlich die Maßnahmen, die die Bundesländer in dieser Krise beschlossen haben, um die Epidemie zu bekämpfen, für richtig. Man muss den politischen Entscheidungsträgern zugutehalten, dass sie bei großer Unsicherheit entschieden haben, ohne genau zu wissen, was die Datenlage ist. Und dass man, wenn man einen möglichen Irrtum in Kauf nimmt, auf der richtigen Seite irren möchte, indem man eher zu radikal vorgeht, um Leben zu schützen, als umgekehrt zu wenig radikal, um die Wirtschaft zu retten. Das ist eine sinnvolle Strategie.
Allerdings wussten manche Politiker und auch wissenschaftliche Berater wohl nicht genau, worum es wirklich ging. Die öffentliche Konfusion um das Thema der Reproduktionsrate und die langfristig zu erwartende Durchseuchung war jedenfalls nicht zu übersehen, und das betraf sowohl das Robert-Koch-Institut als auch die Bundeskanzlerin, die ihre Informationen von diesem Institut bezog.
Die Konfusion bezieht sich vor allem auf die sogenannte Reproduktionsrate R. Die Reproduktionsrate gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt. Ist R konstant größer als eins, dann gibt es ein exponentielles Wachstum der Infiziertenzahl. Ist R gleich eins, dann gibt es ein lineares Wachstum, ist R kleiner als eins, dann nimmt die Zahl der Neuinfizierten laufend ab, und die Infektion verschwindet allmählich. Bemerkenswert ist, dass nach den Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts die Reproduktionsrate schon vor dem harten Lockdown, also vor dem 22. März, unter eins lag und dann aber auch nicht weiter abnahm. R war ursprünglich sehr hoch, 3,5 im Maximum am 10. März. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, was dann dieser harte Lockdown noch bewirkte.
Sehr wichtig war es mit Sicherheit, dass Großveranstaltungen schon am 9. März verboten worden waren. Und kurz danach, um den 13. März, sind in den meisten Bundesländern die Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Das hat wesentliche Effekte gebracht. Freizeitveranstaltungen mit größeren Menschenmengen wie Fußballspiele, Konzerte, kommerzielle und kirchliche Messen etc. sind Virenschleudern ersten Ranges. Es ist richtig, dass diese Veranstaltungen frühzeitig verboten wurden und auch noch lange nach der Aufhebung des harten Lockdown eingeschränkt bleiben, bis wir einen Impfstoff haben, denn sonst bricht alles wieder auf. Aber die Läden zuzumachen, was dann anschließend passiert ist, das scheint auf den ersten Blick zur Verringerung der Reproduktionsrate nichts Wesentliches beigetragen zu haben.
Die Frage ist aber, was die Reproduktionsrate als Entscheidungsgrundlage taugt. Die gemeldeten Infektionszahlen, aus denen diese Rate berechnet wird, sind für sich keine verlässlichen Daten, denn ihre Veränderung misst nicht nur, wie viele Menschen sich zusätzlich anstecken, sondern vor allem, auch wie sich die Menge der laufenden Corona-Tests verändert. Tatsächlich ist die Testkapazität dramatisch hochgefahren worden, auf ein Zehnfaches des anfänglichen Wertes. Und im Zuge dieses Hochfahrens findet man natürlich immer mehr Infektionsfälle. Wenn also berichtet wird, dass die Reproduktionsrate temporär, nachdem sie unter eins gefallen war, schon Ende März wieder über eins stieg, dann zeigt das möglicherweise nur, dass man immer mehr testete und deswegen auch immer mehr Fälle fand. Tatsächlich verlief die Entwicklung sehr viel günstiger, als ein Blick auf die gemessene Reproduktionsrate signalisiert.
Einen verlässlicheren Eindruck von der zeitlichen Entwicklung der Pandemie gewährt die Statistik der Todesfälle, konkret der täglichen Zahl der neu Verstorbenen. Die Todesfallzahlen sind die einzigen harten und verlässlichen Werte, denn wer infiziert ist und stirbt, der landet schließlich in der Statistik, und zwar bei uns zu nahezu 100 Prozent. Natürlich weiß man nicht, ob jemand, bei dem Corona-Antikörper nachgewiesen wurden, wegen der Infektion oder aus anderen Gründen gestorben ist, zumal ja sehr viele Menschen mit Vorerkrankungen betroffen waren. Es gibt hier sicherlich ebenfalls einen Messfehler. Doch solange dieser Messfehler sich im Zeitablauf nicht verändert, spielt er für die Entwicklung des Zeittrends keine Rolle.
Die Todesfallstatistik hat gezeigt, dass wir um den 20. April erstmalig einen Rückgang der Zahl der neu Verstorbenen und damit das temporäre Maximum dieser Krise überschritten hatten. Die Leute, die zu diesem Zeitpunkt gestorben sind, waren ungefähr einen Monat vorher infiziert worden, denn es dauert in der Regel sechs Tage, bis man die ersten Symptome spürt, wenn man sie spürt; es dauert dann zehn Tage, bis man möglicherweise so krank ist, dass man ins Krankenhaus muss; und es dauert im Krankenhaus dann um die 14 Tage, bis man tot ist, wenn man stirbt. So war es jedenfalls in China. Wir haben mit den Todesfallzahlen die einzige vernünftige Statistik über den Verlauf des Infektionsgeschehens, nur muss man wissen, dass sie das wirkliche Infektionsgeschehen mit einer Verzögerung von einem Monat widerspiegelt. Wegen dieser Verzögerung muss man natürlich auch die Statistik der Neuinfektionen im Auge haben, wenn man schnell reagieren will. Nur muss man sich bewusst sein, dass sie die tatsächliche Dramatik des Geschehens überschätzt.
Aus der Todesfallstatistik kann man die Statistik der wirklichen Infektionen mit einem Monat Verzögerung besser rekonstruieren als mit jeder anderen Statistik. Da etwa 0,5 Prozent der Infizierten stirbt (in Heinsberg nur 0,4 Prozent, in Wuhan 0,6 Prozent), kann man die Zahl der Verstorbenen mit 200 multiplizieren und hat dann in etwa die Zahl derjenigen, die sich vor einem Monat infiziert haben. Obwohl also die gemessene Reproduktionszahl schon am 22. März unter eins lag und dann nicht mehr gefallen ist, zeigt der dramatische Rückgang der täglichen Todesfallzahlen in der Zeit ab dem 20. April, dass die tatsächlichen Infektionen seit etwa dem 20. März massiv zurückgingen, dass also das tatsächliche R deutlich unter den Wert von 1 gerutscht sein muss, obwohl das gemessene R nur wenig darunter lag.
Mitte April hatten wir täglich bis zu 300 neu Verstorbene. Sieben Wochen später, Ende Juni, als dieses Manuskript abgeschlossen wurde, zählte man nur noch jeweils um die zehn, also gerade mal ein Dreißigstel. Die Vervielfältigung der Testkapazität und die Reduktion der Zahl der tatsächlich Infizierten könnten sich bezüglich der gemessenen Reproduktionszahl also gerade aufgehoben haben. So gesehen war der harte Lockdown vermutlich doch sehr erfolgreich.
Das Robert-Koch-Institut geriet in dieser Phase gleichwohl in die Kritik, weil es inkonsistent argumentiert hatte. Erst hatte es gesagt, es käme darauf an, die Reproduktionsrate unter eins zu bringen, und dann könnte man wieder lockern, und als diese Rate dann unter eins war, hatte man nicht gelockert, sondern den Lockdown beschlossen.
Angesichts der insgesamt etwa 9 000 Corona-Toten, die man bis Anfang Juni in Deutschland zählte, dürfte die Gesamtzahl der Infizierten in Deutschland bis Anfang Mai bei etwa 1,8 Millionen Personen gelegen haben, denn das kommt heraus, wenn man diese Zahl mit 200 multipliziert. Die Zahl von 1,8 Millionen ist meilenweit entfernt von den 50 bis 60 Millionen Infizierten, die Angela Merkel am 11. März implizit nannte, als sie nach einer Aufforderung durch die Bild