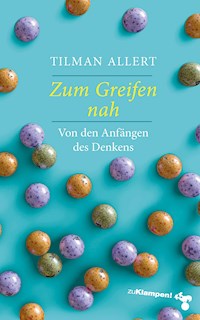9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der in fünf Sprachen übersetzte Klassiker in überarbeiteter und erweiterter Taschenbuchausgabe. Zu den Eigenheiten der Nationalsozialisten gehörte auch der »deutsche Gruß«. Es gibt keine Geste in der Geschichte, die so sehr für ein Regime steht wie dieser Gruß. In seiner mittlerweile klassischen Studie untersucht Tilman Allert, wie diese Geste erfunden und dann verbreitet wurde, wie sie zur Unterscheidung von Anhängern und Gegnern diente, aber auch Gegenstand der Belustigung war und wie es nach dem verlorenen Krieg um sie stand. Die Neuausgabe ist aktualisiert und um ein Kapitel über die Geschichte des Grußes in der DDR erweitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Prof. Dr. TILMANALLERT
Der deutsche Gruß
Geschichte einer unheilvollen Geste
Über dieses Buch
Zu den Eigenheiten der Nationalsozialisten gehörte auch der »deutsche Gruß«. Es gibt keine Geste in der Geschichte, die so sehr für ein Regime steht wie dieser Gruß. In seiner mittlerweile klassischen Studie untersucht Tilman Allert, wie diese Geste erfunden und dann verbreitet wurde, wie sie zur Unterscheidung von Anhängern und Gegnern diente, aber auch Gegenstand der Belustigung war und wie es nach dem verlorenen Krieg um sie stand.
Die Neuausgabe ist aktualisiert und um ein Kapitel über die Geschichte des Grußes in der DDR erweitert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Erstausgabe erschien 2005 beim Eichborn-Verlag, Frankfurt am Main.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München nach einer Idee von Eva Knoll, Stuttgart
Coverabbildung: akg-images, Berlin
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490140-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage
Vorbemerkung: Eine Tagebuchnotiz
1 Dem Beginnen eine Form geben
2 Der Gruß als erste Gabe
3 Wie grüßen Deutsche?
4 Der Hitlergruß: ein verkleideter Schwur
Die sprachliche Formel
Der gestische Teil des Grußes
Der Schwur im Gruß
5 Die Herkunft des Hitlergrußes und die Entstehung der Sphäre des Misstrauens
6 Die Entwertung des Gegenwärtigen und die innere Annahme des Grußes
7 Der lange Schatten einer unheilvollen Geste
8 Rituelle Differenz und rituelle Kontinuität im sozialistischen Gruß
9 Ausblick
Dank
Literatur
Abbildungsnachweis
Namenregister
Vorwort zur Neuauflage
Wie ist der Zivilisationsbruch der deutschen Gesellschaft in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts zu verstehen, wie lässt sich künftigen Generationen die Regression in die Barbarei erzählen? Millionen ermordeter Menschen, in Tötungsfabriken umgebracht – wie findet die Monstrosität der nationalsozialistischen Herrschaft im Kollektivgedächtnis einen Platz, und wie nimmt ein verantwortliches staatsbürgerliches Handeln darauf Bezug?
Im Vernichtungslager ist das Grüßen erloschen. Es ist der Ort der totalen Macht über den anderen, die vollkommene Asymmetrie und der organisierte Vollzug eines Selbstverzichts, in den das mechanisierte Töten eindringen kann. Das Lager kennt nur den Appell, die Warnung und den Fluch. Das Sprechen mit den Opfern ist untersagt, und das Nichtwahrnehmen des Gegenübers findet in der Auslöschung ihre letzte Konsequenz. Der Zusammenhang zwischen Gruß und Lager liegt nicht auf der Hand – zu weit voneinander entfernt scheinen die Trivialität einer Eröffnungsgeste und die Realität der organisierten Vernichtung zu liegen. Was rechtfertigt es demnach, aus der Totalität des historischen Phänomens Nationalsozialismus den Hitlergruß analytisch zu isolieren und zum Gegenstand einer Studie zu machen? Irgendetwas an ihm stimmt nicht – so jedenfalls eine intuitive Wahrnehmung, die meine Suche nach den sozialen Voraussetzungen und Folgen des Grüßens allgemein veranlasst hat und dabei auf eine Sinnverkehrung gestoßen ist, die im Bannkreis charismatischer Suggestion und Selbstsuggestion entstehen kann. Der Gruß ist semantisch wohlgeformt und dennoch Ausdruck einer beschädigten Sittlichkeit. Aber er kommt nicht als ein äußerer Zwang über die Menschen, sondern sein Entstehen ist selbstverantwortet.
Sich ausschließlich auf den Gruß zu konzentrieren folgt dem Bemühen, einen Schlüssel zu liefern für das Verständnis einer Zeit, in deren moralischem Horizont auch diejenigen Generationen stehen, die ohne Erfahrungsbezug zum Nationalsozialismus aufwachsen. Ein Schlüssel, der handhabbar ist, weil dem Grüßen schließlich in allen Austauschbeziehungen in der einen oder anderen Form, in der bewussten, gelangweilten, engagierten oder trotzigen Form, eine Evidenz abgewonnen werden kann. Seine alltägliche und triviale Inanspruchnahme erinnert an eine Elementarform menschlichen Lebens, und im vergleichenden Nachdenken erscheint das Ungeheuerliche in dessen sprachlicher Subversion als ein Ausdruck der Sorglosigkeit, die banal und weitreichend zugleich ist: in ihrer Verkehrung von weltlicher und religiöser Ordnung, der Auflösung des Religiösen und der Wiederaneignung des Religiösen in einer innerweltlichen Gemeinschaft sowie der beständigen Selbstsakralisierung des Handelns. Viele Geschichten liegen im Kollektivgedächtnis der Nation, in den allmählich verblassenden Erinnerungen der Eltern und Großeltern aufbewahrt. In meinen Recherchen habe ich Bruchteile davon gesammelt.
Tilman Allert, im Sommer 2016
Vorbemerkung: Eine Tagebuchnotiz
Samuel Beckett nimmt auf seiner Reise durch Deutschland am 3. März 1937 an der Dominikanerkirche von Regensburg ein über dem Nordportal angebrachtes Schild wahr und sieht, dass dessen Aufschrift ›Grüß Gott‹ durchgestrichen und durch ›Heil Hitler‹ ersetzt worden war.
Gegen jede Form zusammenfügender Deutung argwöhnisch eingestellt – Versuche, irgendeine historische Notwendigkeit zu behaupten, bereiten ihm regelrechten Ekel –, versieht Beckett das montageartige Protokoll seiner Beobachtungen mit einer Gewichtung, die beinah unmerklich in der Zeichensetzung durch drei Ausrufungszeichen zum Ausdruck kommt. Dass die Grußformel ausgetauscht wurde, fällt seinem Blick auf. Das Entdeckte fügt sich seinem Eindruck aus Begegnungen mit Deutschen in Hamburg, Berlin und anderswo und dem schon vielfach registrierten omnipräsenten Gebrauch des Hitlergrußes. Aber diese Notiz endet mit drei Ausrufungszeichen, Chiffren, die das Beobachtete der lapidaren Reportage entziehen. Das Befremdende, das dem Reisenden ins Auge springt, erscheint als eine irritierende Besonderheit. Es wird mit einem Aufruf zur Reflexion versehen.
Im April 1937, einen Monat später, verlässt Beckett Deutschland, um in Frankreich eine ständige Bleibe zu finden. Das Staunen über die wahrgenommene, aber unbegriffene sprachliche Subversion versickert in den schemenhaften Erinnerungsspuren eines jungen Mannes auf der ästhetisch-literarischen Selbstsuche. Nur wenige Jahre später wird er als Schriftsteller seinen Weltruhm darauf gründen, den Zerfall eines sittlichen menschlichen Umgangs in der Auflösung dialogischer Möglichkeiten des Sprechens zu seinem zentralen literarischen Thema gemacht zu haben. Den Ausrufungszeichen Becketts, die das intuitiv empfundene Ungeheuerliche eines Bedeutungsbruchs in das Tagebuch schreien, wollen wir nachspüren. Vom deutschen Grüßen und dessen folgenreicher Perversion soll die Rede sein.
1 Dem Beginnen eine Form geben
Wie eine Gesellschaft die Kultur der Verständigung handhabt, erfahren wir nicht durch hochtrabende Inszenierungen des Wohlmeinens. Es sind nicht die Lichterketten der guten Absicht, sondern die kleinen Gesten, etwa der Gruß und die Anrede, das »Wie geht’s, wie steht’s?«, die darüber Auskunft geben, wie die Menschen sich einander mitteilen, wie sie sich voneinander abgrenzen, was sie von sich preisgeben und wie sie das Geheimnis ihrer Person wahren. Wer grüßt, richtet seine Aufmerksamkeit auf einen anderen und macht sich für diesen in besonderer Weise zugänglich. Insofern ist der Gruß das erste symbolische Geschenk an den anderen. Er ist die abstrakteste Form der Gabe, zieht aber auch eine feste Abfolge von Verpflichtungen nach sich, und zwar für den Gegrüßten wie für den Grüßenden. Eine Trias von Geben, Annehmen und Erwidern ist untrennbar mit dem Grüßen verbunden. Als das kürzeste Stück Gesellschaft, das Menschen in der unendlich reichhaltigen Choreographie ihrer Begegnungen miteinander aufführen können, schließt der Gruß die Tür zum anderen auf, verteilt die Rollen, stellt Gegenwärtigkeit her und öffnet den Raum für Geschichte und Innovation. In jedem Gruß – selbst im verweigerten – spiegeln sich die Selbstbilder der Beteiligten und die Art und Weise, wie sie ihre Beziehung untereinander wahrnehmen. Die Erzeugungsregeln und Erscheinungsformen des Grußes allerdings unterliegen dem historischen Wandel. Auch regional sind sie verschieden. Nicht nur Grußformeln aus dem Mittelalter würden im Deutschland des 21. Jahrhunderts Kopfschütteln auslösen – schon ein bayerisches »Grüß Gott« oder »Servus« fällt in Hamburg als kurios auf, während das »Moin-Moin«, der Universalgruß der norddeutschen Küstenregion, oder das den Lauf der Dinge lakonisch abwartende »Ei« – »Ei gude wie« der Hessen außerhalb der Gegenden Staunen auslösen wird. Das Grüßen ist stets konkret normiert und zeigt hierin den Grad der Zivilität oder Würde an, in dem eine Solidargemeinschaft den sozialen Austausch für geboten und erwartbar hält. Indem er eine Verpflichtungsabfolge in Gang bringt, der sich niemand entziehen kann, verkörpert er eine universale soziale Tatsache – in den Worten Ortega y Gassets: »Er ist selbst keine wirkliche Handlung, kein Brauch mit eigenem zweckdienlichen Inhalt, sondern ist der Brauch, der alle übrigen Bräuche versinnbildlicht, der Brauch der Bräuche.«[1]
Dem Gruß kommt das Privileg zu, dem Beginnen eine Form zu geben. Seine herausragende Stellung liegt darin, dass er – gemeinsam mit dem Abschied – die menschliche Begegnung moderiert, ihr einen Rahmen setzt, der die ersten Spielregeln definiert, innerhalb deren die Kommunikation stattfindet, und der den Platz im gesellschaftlichen Gefüge anzeigt, in dem sie steht. Jeder kennt den Unterschied zwischen einem zwanglosen Gruß im Freundeskreis und einem formalen Gruß bei einem öffentlichen Zeremoniell.
Während es üblich ist, den Gruß als ein belangloses Ritual zu verstehen, dessen sich Menschen unbewusst bedienen, um sich auf das »Danach«, auf die gesetzten Ziele, den Verlauf des durch den Gruß eröffneten Austauschs zu konzentrieren, gilt unsere Aufmerksamkeit der Sinnstruktur des Grußes selbst, seinen Voraussetzungen und Folgen. Seine Natur als reine »Wechselwirkung« (Georg Simmel) und als Türöffner der Kommunikation, sein Janusgesicht als Eröffnungs- und Verhüllungsformel, seine gleichzeitige Rolle als Bindeglied und Trennwand zwischen zwei Menschen sowie die Vielgestalt seiner Erscheinungsformen machen ihn für evolutionstheoretische und zivilisationsethische Fragen besonders bedeutsam. Der Gruß gehört in die Naturgeschichte der Begegnungen und erlaubt einen Blick auf die Art und Weise, wie sich Exemplare ein und derselben Gattung im Nahbereich begegnen. Schnell geht einem das Urteil von der Zunge, der Gruß sei zu leichtgewichtig, um die Tragfähigkeit gesellschaftlicher Institutionen beeinflussen zu können – aber lässt sich eine Gesellschaft denken, die auf das Grüßen verzichtet und ohne die Handhabung des Grüßens als einer Geste der Öffnung zum anderen hin auskommt?
Jedes Nachdenken über das Benehmen, über die Manieren und über die Kultivierung des Austauschs beginnt mit der Frage nach der Handhabung des Grüßens – in den Schulen, am Arbeitsplatz, bei öffentlichen Auftritten von Funktionsträgern, aber auch im privaten Raum von Partnerschaft und Familie. Nicht zuletzt deshalb rückt er auch im Hinblick auf die Frage nach der normativen Integration komplexer Gesellschaften ins Blickfeld. »Was hält die Gesellschaft zusammen?«, lautet die moderne Version der alten soziologischen Frage danach, wie soziale Ordnung möglich ist. Die Bandbreite empirischer Erscheinungsformen des Grüßens ist so vielfältig, wie die Formen menschlicher Vergemeinschaftungen selbst es sind. Jede pflegt ihre eigenen Eröffnungs- und Beschließungsregeln, wobei häufig die Reihenfolge der Grußsequenz vorgeschrieben ist – der Statusniedrigere grüßt den Statushöheren, der Jüngere den Älteren, Männer die Frauen, Eintretende die Anwesenden.
Im Folgenden soll vom »deutschen Grüßen« die Rede sein, besonders vom historisch einmaligen Fall des »Hitlergrußes«, der für die Dauer eines Zeitraums von zwölf Jahren als allgemeine Rahmung der Kommunikation politisch verordnet war. Der Gruß mit der elliptischen Formel »Heil Hitler« und dem synchron dazu in Augenhöhe ausgestreckten rechten Arm bei geöffneter Handfläche überzieht nach der Machtergreifung der NSDAP die Kultur des Austauschs. »Nach Niederkämpfung des Parteienstaates ist der Hitlergruß zum Deutschen Gruß geworden«, so heißt es 1933 in einem Rundschreiben des Reichsministers des Innern an die obersten Reichsbehörden. Damit ist das bisherige Grüßen als eine Technik der Herstellung von Selbstverständlichkeit getilgt, vertraute Kommunikationsräume erhalten eine verordnete Rahmung. Die Richtlinien für die Kameradschaftserziehung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes formulieren den Bruch mit der bisherigen Grußpraxis folgendermaßen: »Der deutsche Gruß muß Dir selbstverständlich werden. Lege ab das ›Grüß Gott‹, ›Auf Wiedersehen‹, ›Guten Tag‹, ›Servus‹.« Und weiter heißt es: »Wer nicht in den Verdacht kommen will, sich bewußt ablehnend zu verhalten, wird daher den Hitlergruß erweisen.«
Der Wandel erfasst nicht nur die Routinen, in denen man gewohnt war, sich – mündlich oder schriftlich – in behördlichen, geschäftlichen und bürgerschaftlichen Kontakten im öffentlichen Raum zu begrüßen oder zu verabschieden, sondern gleichermaßen die Symbole und Gebäude der neuen Staatlichkeit. Während des Absingens der Nationalhymne, des Horst-Wessel-Liedes, vor den Fahnen der NSDAP und ihrer Untergruppierungen, vor den staatlichen Organen der Wehrmacht, der Polizei sowie vor den Weihestätten der nationalsozialistischen Bewegung war – »ohne Zuruf« – der Gruß zu entbieten.
Den Gruß zu befolgen galt während der Regimezeit als Loyalitätsbeweis. Seine Durchsetzung und Verbreitung markieren eine deutliche Zäsur in der Interaktionsordnung und liefern eines der markantesten Beispiele für die kollektive Regression der Deutschen auf »das seltsame Glück vormoderner Riten« (Joachim Fest).
Wie Samuel Beckett stehen viele ausländische Beobachter fassungslos vor dem Phänomen einer rapiden Verbreitung des Grußes. Natürlich gab es die Gleichgültigen, die Widerwilligen, die Unaufmerksamen, aber die Akzeptanz des Grußes schien unaufhaltsam. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, drei Jahre nach dem Herrschaftsantritt der Nationalsozialisten, marschieren die französische und die englische Mannschaft ins Stadion ein und erweisen mit ausgestrecktem Arm dem Gastgeberland ihre Reverenz, schon 1935 ist er im Großen Duden, dem Bildwörterbuch der deutschen Sprache, unter »Grußformen« aufgenommen.
Aber das ist nur die eine Seite, denn in jedem Gruß offenbaren sich das Eigeninteresse des Grüßenden und zugleich die Art und Weise, wie er die Gemeinwohlbindung seines Handelns versteht – beim »deutschen Gruß« ist dies besonders signifikant. Das Geheimnis ihrer Privatheit, das Menschen mit einem Gruß zu lüften beginnen, ist nie vollständig aus den übergreifenden Ordnungszusammenhängen des Zusammenlebens ausgegrenzt, vielmehr verweist es auf die Wahrnehmung des öffentlichen Handlungsraums, dem der Einzelne stets auch zugehörig ist. Wer im öffentlichen Raum, etwa im Betrieb, auf der Straße oder noch im Hauseingang, scheinbar begeistert den Arm hob, konnte im privaten Raum der eigenen Wohnung dennoch entschiedener Gegner des Grußes sein.
Spannender aber als die Frage nach der Verbreitung des Hitlergrußes, nach seinen Vorläufern oder seiner offenkundigen politischen Funktion ist die, wie das Grüßen als eine Elementarform menschlicher Kommunikation hat derart verformt werden können. Dass wir es schließlich nicht mit einer schleichenden Gewöhnung zu tun haben, so wie jemand beim »Morgen« aus Bequemlichkeit das »Guten« auslässt, geht exemplarisch aus der Erinnerung von Helga Hartmann, Jahrgang 1938, aus Bad Camberg (Taunus) hervor: »Ich war fünf Jahre alt, und meine Großmutter schickte mich zur Post, um Briefmarken zu kaufen. Meine siebenjährige Cousine begleitete mich. Die Poststelle war in einem Privathaus untergebracht und wurde von einer jungen Frau geleitet. Wir gingen in die Poststube und grüßten mit ›Guten Morgen‹. Die Posthalterin schaute böse, schickte uns vor die Tür mit den Worten: ›Kommt erst mal rein, wie sich das gehört‹. Wir schauten uns an und wussten nicht, was wir falsch gemacht hatten. Meine Cousine meinte dann, wir müssen vielleicht anklopfen. Wir klopften an und sagten erneut laut ›Guten Morgen‹. Daraufhin nahm uns die Postfrau bei der Hand, brachte uns vor die Tür und zeigte uns, wie man beim Betreten einer Amtsstube den Führer grüßt. Das ist meine nachhaltige Erinnerung an den Hitlergruß, die ich bis heute nicht vergessen habe.« Ähnlich die Geschichte eines jungen Ruderers, der von einem Erlebnis im Ruderclub Neptun in Konstanz erzählt: »Als ich im Frühjahr 1935 eines Abends ins Clubhaus zum Training kam und – wie üblich – mit ›Salut‹ grüßte, kam ein frecher Bengel auf mich zu und sprach mich mit sehr vernehmlicher Stimme an: ›Weißt du nicht, dass der deutsche Gruß ‚Heil Hitler‘ ist?!‹ Ich dachte vorerst an einen faulen Witz und schaute in die Runde, doch es blieb bei einer beklemmenden Stille, und kein Gesicht verzog sich. Unmissverständlich: Es war ernst gemeint. Wortlos ging ich zu meinem Garderobenkasten, packte meine Siebensachen in den Sportsack und verließ die Stätte wortlos und für immer.«[2] Die Beispiele zeigen, dass die Grußpflicht einen deutlichen Bruch der Gewohnheiten zumutet – die Kinder auf der Poststelle haben doch die Höflichkeitsregeln befolgt, und auch die Sportsfreunde im Ruderclub hätten der Ankunft des vertrauten Kameraden eine größere Bedeutung beimessen können als dessen lässiger Wahrnehmung der neuen Grußregel.
Abb. 1 Im Großen Duden von 1935 erschien der Hitlergruß als Nummer 1 unter den deutschen Grußformen
Im Grüßen begegnen wir uns selbst, nicht nur dem anderen, und der Gruß markiert einen erstaunlichen Vorgang der Vergegenwärtigung, rückt die Grüßenden in eine Ebene synchroner Zeitlichkeit, die Handlungsoptionen offeriert, zwischen denen die Grüßenden sich entscheiden – der zuerst Grüßende mit dem Handlungsvorteil der Initiative, aber dem initialen Entscheidungszwang: Gruß oder Nichtgruß; der Grußerwidernde mit durch den Gruß schon eingeschränkten Optionen, aber dem parallelen Entscheidungszwang, den Gruß anzunehmen oder nicht anzunehmen bzw. Erwiderung oder Verzicht auf Erwiderung zu üben. Geht man der Frage nach, wie Menschen ein Verhältnis zu sozial verpflichtenden Regeln entwickeln und wie sie die Fähigkeit zu Erinnerung und Antizipation als Grundlage der Vergegenwärtigung erwerben, so rückt mit den privaten Beziehungen eine Lebensform in den Blick, die gegenüber dem öffentlichen Grußtaumel eine Rückzugsmöglichkeit bietet und doch zugleich als der Ort erscheint, in dem die innere Aneignung des Grußgebots vorbereitet wird. Etwa so, dass jemand des Morgens auf die Straße tritt und ganz gegen die bisherigen Gewohnheiten dem Nachbarn ein »Heil Hitler« zuruft, das dieser annimmt und mit derselben Unbekümmertheit oder gar Entschlossenheit erwidert. Oder so, dass jemand den Gruß vermeidet, indem er ihn zu einem »Heitler« einschleift oder indem man beim unvermeidlichen Behördengang die Tür zum Amtszimmer aufstößt mit den Worten: »Ist hier jemand?« – und damit die offene Artikulation des »Heil Hitler« umgeht.
Wie kommen Menschen dazu, jahrhundertealte Formen von Gruß und Anrede in eine körperlich aufwendige und semantisch ungewöhnliche Prozedur zu ändern? Eine Prozedur, die – wie Charlie Chaplin in seinem Film Der Diktator