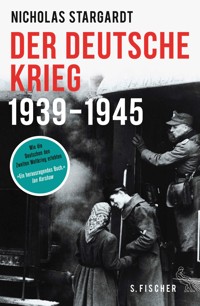
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Einzigartig und fesselnd erzählt der renommierte Oxford-Historiker Nicholas Stargardt in ›Der Deutsche Krieg‹ aus der Nahsicht, wie die Deutschen – Soldaten, Lehrer, Krankenschwestern, Nationalsozialisten, Christen und Juden – den Zweiten Weltkrieg durchlebten. Tag für Tag erleben wir mit, worauf sie hofften, was sie schockierte, worüber sie schwiegen und wie sich ihre Sicht auf den Krieg allmählich wandelte. Gestützt auf zahllose Tagebücher und Briefe, unter anderem von Heinrich Böll und Victor Klemperer, Wilm Hosenfeld und Konrad Jarausch, gelingt Nicholas Stargardt ein Blick in die Köpfe der Menschen, der deutlich macht, warum so viele Deutsche noch an die nationale Sache glaubten, als der Krieg längst verloren war und die Gewissheit wuchs, an einem Völkermord teilzuhaben. Ein verstörendes Kaleidoskop der Jahre 1939 bis 1945 im nationalsozialistischen Deutschland. »Ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung, das die ›Vogelperspektive‹ nahtlos mit einer Mikrogeschichte dieser verhängnisvollen Periode des 20. Jahrhunderts verbindet.« Jan T. Gross »Erstmals wird die Chronologie der Stimmung, der Hoffnungen und Befürchtungen (…) der deutschen Bevölkerung während des Krieges wirklich sichtbar. Eine eindrucksvolle, fesselnde Darstellung.« Mark Roseman »Hervorragend geschrieben und in seiner Argumentation überzeugend, ist dieses Buch ein Muss.« Saul Friedländer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1362
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Nicholas Stargardt
Der deutsche Krieg
1939–1945
Über dieses Buch
Das große Buch zum Zweiten Weltkrieg, 70 Jahre danach - einzigartig und fesselnd erzählt aus der Sicht der Menschen, die den Krieg durchlebten
Sommer 1939, Mobilmachung im nationalsozialistischen Deutschland. Die Menschen ahnen nicht, dass ein brutaler, zerstörerischer Krieg folgen würde. Erstmals erzählt der renommierte Oxford-Historiker Nicholas Stargardt aus der Nahsicht, gestützt auf zahllose Tagebücher und Briefe, wie die Deutschen – Soldaten, Lehrer, Krankenschwestern, Nazis, Christen und Juden – diese Zeit erlebten. Und kommt zu überraschenden Ergebnissen: Sie glaubten, dass Deutschland sich gegen seine Feinde verteidigen musste, sie glaubten an die nationale Sache, nahezu unabhängig von sozialer Stellung sowie religiöser oder politischer Überzeugung. Der Wunsch, ihr Land und ihre Familien zu retten, ließ sie weiterkämpfen,mit ungebrochener Brutalität und wider alle Vernunft - auch dann noch, als die Gewissheit wuchs, an einem ungeheuren Völkermord teilzuhaben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Nicholas Stargardt, geboren 1962 in Melbourne, Australien, ist Professor für neuere europäische Geschichte an der Universität Oxford und Fellow am Magdalen College. Er hat zahlreiche Publikationen zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert verfasst, insbesondere zur Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus. Auf Deutsch erschien von ihm 2006 ›Kinder in Hitlers Krieg‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe ist 2015 unter dem Titel ›German War. A Nation under Arms, 1939–45‹ bei Bodley Head/Penguin Random House, London, erschienen.
© Nicholas Stargardt 2015
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: buxdesign | München
Coverabbildung: © ullstein bild / Arthur Grimm
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403503-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Dramatis personae
Einleitung
Teil I Die Rechtfertigung des Angriffs
Kapitel 1 Unwillkommener Krieg
Kapitel 2 Schulterschluss
Kapitel 3 Extreme Maßnahmen
Teil II Die Herren Europas
Kapitel 4 Ausbruch
Kapitel 5 Gewinner und Verlierer
Teil III Der Schatten von 1812
Kapitel 6 Der deutsche Kreuzzug
Kapitel 7 Die erste Niederlage
Teil IV Patt
Kapitel 8 Ein offenes Geheimnis
Kapitel 9 Durch ganz Europa
Kapitel 10 An die Toten schreiben
Teil V Der Krieg erreicht die Heimat
Kapitel 11 Bomben und Vergeltung
Kapitel 12 »Durchhalten«
Kapitel 13 Gezählte Tage
Teil VI Totale Niederlage
Kapitel 14 Verschanzen
Kapitel 15 Zusammenbruch
Kapitel 16 Endkampf
Epilog: Jenseits des Abgrunds
Anhang
Bibliographie
Gedruckte Primärquellen
Sekundärquellen
Abkürzungen
Kartenverzeichnis
Abbildungsnachweise
Register
[Tafelteil 1]
[Tafelteil 2]
[Tafelteil 3]
Vorwort
Dieses Buch ist das Ergebnis eines mehr als 20 Jahre währenden Versuchs, das Erleben der Menschen in Deutschland und den von Deutschen besetzten Ländern während des Zweiten Weltkriegs zu verstehen. Es ist ein Buch, das ich ursprünglich gar nicht geplant hatte. Nachdem ich 2005 die Arbeit an »Kinder in Hitlers Krieg« beendet hatte, versprach ich mir und allen, die es hören wollten, dass ich nie wieder über Kinder, den Holocaust oder Deutschland während des Nationalsozialismus schreiben würde. Was als kurzes Essay über die Frage begann, wofür Deutsche damals kämpften – etwas, was nach meinem Dafürhalten noch gesagt werden musste, bevor ich mich anderen Dingen zuwenden konnte –, nahm 2006/2007 während eines Forschungsaufenthalts an der Freien Universität Berlin erheblich umfangreichere Formen an.
Zwischen beiden Büchern gibt es manche Kontinuität, vor allem mein Interesse, die subjektiven Dimensionen der Gesellschaftsgeschichte anhand zeitgenössischer Dokumente zu erforschen, um herauszufinden, wie Menschen Ereignisse beurteilten und verstanden, während diese geschahen und noch bevor sie deren Ausgang kannten. Es gibt jedoch auch eindeutige Unterschiede. In »Kinder in Hitlers Krieg« wollte ich mich in erster Linie mit Kindern als eigenständigen gesellschaftlichen Akteuren befassen und die unvereinbaren Sichtweisen von Kindern gegenüberstellen, die durch Krieg und rassistische Verfolgung in Sieger und Besiegte gespalten waren. Das vorliegende Buch widmet sich einem anderen Problem: Es will Ängste und Hoffnungen der breiten Gesellschaft aufdecken, um zu verstehen, wie Deutsche diesen Krieg vor sich selbst rechtfertigten. Zur Beantwortung dieser Frage habe ich mich sowohl um eine gewisse Breite als auch um Tiefe bemüht: Für Breite sorgen »Makro«-Meinungsbilder, erstellt von Berichterstattern, die für das nationalsozialistische Regime Gespräche in der Öffentlichkeit belauschten, und von Zensoren, die Feldpostbriefe in Stichproben untersuchten; für Tiefe sorgen zeitgenössische Dokumente einzelner Personen unterschiedlicher Herkunft, anhand deren sich nachvollziehen lässt, wie die persönlichen Hoffnungen und Pläne mit den wechselnden Kriegserlebnissen verflochten waren. Durch diese Herangehensweise stehen die Stimmen der Opfer zwar weniger im Vordergrund als in »Kinder in Hitlers Krieg«, fehlen aber nie: Ohne ihre kontrastierende Deutung wüssten wir nicht, wie unterschiedlich – und häufig ichzentriert – Deutsche ihre Wahrnehmung des Krieges formten.
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Buches sind Sammlungen von Briefen, die Liebespaare, enge Freunde, Eltern und Kinder sowie Eheleute einander schrieben. Viele Historiker haben solche Quellen genutzt, allerdings häufig zu anderen Zwecken. So besitzt die Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart eine berühmte Sammlung von 25000 Briefen, die von Reinhold Sterz zusammengetragen wurden. Leider sind diese Dokumente chronologisch und nicht nach Verfasser katalogisiert, so dass sich nicht ohne weiteres überprüfen lässt, ob die Briefschreiber über längere Zeit an ihren Überzeugungen festgehalten haben. Meine Auswahl war vom umgekehrten Prinzip bestimmt: Ich wollte Briefsammlungen lesen, in denen beide Seiten der Korrespondenz erhalten geblieben sind und die sich mindestens über einige Jahre erstreckten, um nachvollziehen zu können, wie sich die persönlichen Beziehungen zwischen den Briefschreibern – ihre Hauptgründe, überhaupt zu schreiben – im Laufe des Krieges entwickelt und verändert hatten. Denn das ermöglicht es, die privaten Prismen genauer zu rekonstruieren, durch die sich die individuelle Wahrnehmung größerer Ereignisse jeweils brach. Über die Anwendung dieser Forschungsmethode, die Historiker in Bezug auf den Ersten Weltkrieg seit den neunziger Jahren entwickelt haben, konnte ich viel von Christa Hämmerle lernen.
Ich hatte das besondere Glück, Einblick in Walter Kempowskis Privatarchiv zu bekommen, als er noch lebte, und denke gern an die Großzügigkeit zurück, mit der Walter und Hildegard Kempowski mich bei sich in Natum willkommen geheißen haben. Heute befindet sich das Archiv in der Akademie der Künste in Berlin. Beim Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen zeigte sich Gerhard Seitz ebenso hilfsbereit wie Irina Renz in der Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart. Zugang zu Quellen von unschätzbarem Wert ermöglichten mir Andreas Michaelis im Deutschen Historischen Museum in Berlin, Veit Didczuneit und Thomas Jander im Feldpostarchiv des Museums für Kommunikation Berlin und im Bundesarchiv sowie Christiane Botzet im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg. Klaus Baum und Konrad Schulz stellten mir im Archiv von »Jehovas Zeugen in Deutschland« in Selters im Taunus Kopien der letzten Briefe zur Verfügung, die Glaubensbrüder vor ihrer Hinrichtung wegen Kriegsdienstverweigerung geschrieben hatten. Alexander von Plato vom Institut für Geschichte und Biographie in Lüdenscheid machte mir eine große Sammlung mit Kriegserinnerungen von Schulkindern zugänglich, die Anfang der fünfziger Jahre entstanden und im Wilhelm-Roeßler-Archiv aufbewahrt werden. Zu danken habe ich auch Li Gerhalter und Günter Müller, die mir Material aus der Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen und der Sammlung Frauennachlässe der Universität Wien zur Verfügung stellten. Mein besonderer Dank gilt Jacques Schuhmacher für seine unermüdliche Bereitschaft, mir in vielen Stadien dieser Recherchen nach Kräften zu helfen. Für die finanzielle Unterstützung dieser Forschungen danke ich der Alexander von Humboldt-Stiftung und dem Leverhulme Trust.
Ein Name verleiht seinem Träger eine menschliche Identität, und das Unmenschliche im Zweiten Weltkrieg beginnt oft mit dem Verlust des eigenen Namens. Leider können in diesem Buch die Namen nicht immer genannt werden. Manche Personen, von denen berichtet wird, werden nur in offiziellen Archivakten erwähnt – wie etwa die Jugendlichen, die sich in den Erziehungsheimen oder den Tötungsanstalten der Psychiatrie befanden. In solchen Fällen habe ich die Personen anonymisiert, indem ich die Nachnamen abgekürzt habe. Einige wenige Personen werden mit einem Pseudonym bezeichnet, da ihre Geschichten sich durch das gesamte Buch ziehen und es für den Leser leichter ist, diesen Geschichten zu folgen, wenn die Menschen einen vollständigen Namen erhalten. Nur in den Anmerkungen sind diese Namen abgekürzt, um deutlich zu machen, dass der im Text verwendete Name ein Pseudonym ist.
Während des Nationalsozialismus wurden viele Begriffe geprägt, die man heute nur noch in Anführungszeichen verwendet, um sich von deren damaliger Bedeutung zu distanzieren. Das gilt vor allem für seinerzeit gängige herabsetzende, diskriminierende, rassistische und antisemitische Begriffe, aber auch für sonstige ideologisch besetzte Bezeichnungen wie das »Dritte Reich« bzw. das »Altreich« oder den »Führer«. Da diese und andere Begriffe im Text sehr häufig vorkommen, werden hier die distanzierenden Anführungszeichen nur bei der Erstnennung gesetzt, nicht nur um den Lesefluss zu erhalten, sondern auch um die damaligen Denkmuster der Deutschen möglichst präsent werden zu lassen. Orte in den besetzten osteuropäischen Ländern, aber auch im Elsass und anderen zeitweilig zu Deutschland gehörigen oder annektierten Gebieten werden mit den in Deutschland damals verwendeten Namen bezeichnet. Es gibt einige Ausnahmen, so Łódź, da der 1940 eingeführte deutsche Name Litzmannstadt sehr ungebräuchlich ist. Orte wie etwa Sankt Petersburg (von 1924 bis 1991 Leningrad) in der damaligen Sowjetunion, deren Namen inzwischen zurückgeändert wurden, werden mit dem während des Zweiten Weltkriegs geltenden Namen genannt. Im Register finden sich für alle Orte auch die heute üblichen Namen.
Die intellektuelle Dankesschuld, die ich in der langen Zeit des Arbeitens an diesem Buch bei vielen Menschen angehäuft habe, ist zu groß, als dass ich ihr an dieser Stelle gerecht werden könnte. In den Jahren 2006/2007 war mir Jürgen Kocka in Berlin ein wunderbarer Gastgeber, und viele andere haben dazu beigetragen, dass mein Aufenthalt in Deutschland eine denkwürdige und fruchtbare Zeit war. Zahlreiche Freunde und Kollegen haben mich auf meinem Weg ermutigt, mich an ihren Ideen und Forschungsergebnissen teilhaben lassen und mir den äußerst lebendigen Eindruck vermittelt, dass Geschichtsschreibung ein kollektives Bestreben ist. Unter meinen wunderbaren Kollegen im Fachbereich Geschichte und am Magdalen College in Oxford danke ich besonders Paul Betts, Laurence Brockliss, Jane Caplan, Martin Conway, Robert Gildea, Ruth Harris, Matt Houlbrook, Jane Humphries, John Nightingale, Sian Pooley und Chris Wickham.
Beim S. Fischer Verlag hatte ich den großen Vorzug, mit Tanja Hommen, die das Lektorat besorgte, und mit Nina und Peter Sillem zusammenzuarbeiten. Ulrike Bischoff schaffte es bei der Übersetzung, Sorgfalt und Genauigkeit mit Schnelligkeit zu vereinbaren. Ihnen allen danke ich für die erfreuliche Zusammenarbeit. Clare Alexander und Sally Riley bei Aitken-Alexander waren durchgängig die guten Feen, die ihren Rat und ihr Wissen mit mir immer wieder geteilt haben. Es war für mich ein großes Glück.
Ohne die großzügige geistige und praktische Unterstützung vieler Freunde wäre dieses Buch vermutlich gar nicht zustande gekommen. Paul Betts, Tom Brodie, Stefan Ludwig Hoffmann, Ian Kershaw, Mark Roseman, Jacques Schuhmacher, Jon Waterlow und Bernd Weisbrod unterbrachen ihre eigene Arbeit, um das gesamte Manuskript für mich zu lesen. Jedem von ihnen gilt mein Dank, weil sie mir wertvolle Anregungen gegeben, mir ihre eigenen Forschungsergebnisse zugänglich gemacht und mich – zumindest vor einigen – historischen Schnitzern bewahrt haben. Ruth Harris und Lyndal Roper lasen das gesamte Manuskript zweimal und haben ihm somit ihren unauslöschlichen Stempel aufgedrückt. In jedem Stadium dieses Buchprojekts hat Lyndal die Schlüsselideen, die ich zu formulieren versuchte, mit mir diskutiert. Dafür kann ich ihr gar nicht genug danken.
Oxford, 3. Juni 2015
Dramatis personae
(in der Reihenfolge ihres Erscheinens)
Ernst Guicking (geb. 1916 in Altenburschla): Bauernsohn aus Hessen, Berufssoldat bei der Infanterie; und Irene Reitz (geb. 1916 in Gießen), Gärtnerin aus Lauterbach, Hessen; beide heirateten während des Krieges.
Wilm Hosenfeld (geb. 1895 in Fulda): Katholik, Erster-Weltkriegs-Veteran und Volksschullehrer aus Thalau, Hessen, diente in der deutschen Garnison in Warschau; mit seiner Frau Annemarie, einer ausgebildeten Sängerin und zum Katholizismus konvertierten Protestantin, hatte er fünf Kinder.
Jochen Klepper (geb. 1903 in Beuthen/Oder): Schriftsteller aus Berlin-Nikolassee; verheiratet mit Johanna, einer jüdischen Konvertitin zum Protestantismus, die zwei Töchter mit in die Ehe brachte.
Liselotte Purper (geb. 1912 in Straßburg): Fotojournalistin aus Berlin; und Kurt Orgel (geb. 1909 in Zingst), Jurist aus Hamburg und Artillerieoffizier; beide heirateten während des Krieges.
Victor Klemperer (geb. 1881 in Landberg/Warthe): jüdischer Konvertit zum Protestantismus, Erster-Weltkriegs-Veteran und Romanistikprofessor; verheiratet mit Eva (geb. 1882 in Königsberg), einer ehemaligen Konzertpianistin.
August Töpperwien (geb. 1892 in Osterode): Erster-Weltkriegs-Veteran, Studienrat aus Solingen und Offizier, der in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern eingesetzt war; verheiratet mit Margarete.
Fritz Probst (geb. 1906 in Görmar/Thüringen): Tischler, eingesetzt in einem Bau-Bataillon; mit seiner Frau Hildegard hatte er drei Kinder.
Helmut Paulus (geb. 1922 in Pforzheim): Arztsohn, der Älteste von vier heranwachsenden Geschwistern, Infanterist.
Hans Albring (geb. 1918 in Gelsenkirchen) und Eugen Altrogge (geb. 1919 ebenda):Freunde aus Gelsenkirchen-Buer, Mitglieder der katholischen Jugendbewegung, dienten bei der Infanterie und bei einer Korps-Nachrichtenabteilung.
Wilhelm Moldenhauer (geb. 1906 in Nordstemmen bei Hannover): Kolonialwarenhändler, Funker.
Marianne Strauß (geb. 1923 in Essen): jüdische Kindergärtnerin.
Ursula von Kardorff (geb. 1911 in Berlin): Journalistin.
Peter Stölten (geb. 1922 in Apolda): aus Berlin-Zehlendorf, Kradmelder und Panzerkommandant.
Lisa de Boor (geb. 1894 in Kirchhain): Journalistin aus Marburg; mit ihrem Mann Wolf hatte sie drei erwachsene Kinder, Monika, Anton und Hans.
Willy Reese (geb. 1921 in Duisburg): Banklehrling, Infanterist.
Maria Kundera (geb. 1923 in Kritzendorf): Bahnbedienstete in Michelbeuern/Wien; und Hans H. (geb. 1921 in Michelbeuern), Sohn des Bahnhofsvorstehers, Fallschirmjäger.
Einleitung
Der Zweite Weltkrieg war mehr als jeder andere ein deutscher Krieg. Das nationalsozialistische Regime machte aus dem von ihm begonnenen Konflikt den grauenvollsten Krieg der europäischen Geschichte und griff bereits lange bevor es im besetzten Polen die ersten Gaskammern errichtete, zu Methoden des Völkermords. Einzigartig war das »Dritte Reich« auch insofern, als es 1945 seine eigene »totale Niederlage« betrieb und dabei die gesamten moralischen und physischen Reserven der deutschen Gesellschaft komplett erschöpfte. Selbst die Japaner kämpften nicht bis an die Tore des Kaiserpalastes in Tokio, während die Deutschen sogar noch die Reichskanzlei in Berlin verteidigten. Um einen Krieg dieses Ausmaßes zu führen, mussten die Nationalsozialisten in einem Maße die Gesellschaft mobilisieren und den Einzelnen einbinden, das weitaus tiefer reichte als alles, was sie in der Vorkriegszeit zu erreichen versucht hatten. Aber 70 Jahre nach dem Ende des Krieges wissen wir noch immer nicht – trotz ganzer Bibliotheken voller Bücher über seine Entstehung, Verlauf und Gräuel –, wofür die Deutschen zu kämpfen glaubten und wie sie es schafften, diesen Krieg bis zum bitteren Ende fortzuführen. In diesem Buch geht es darum, wie die deutsche Bevölkerung diesen Krieg erlebte, aushielt und mittrug.[1]
Mit dem allmählichen Aussterben der Zeitzeugen verliert der Zweite Weltkrieg nicht etwa an Bedeutung, sondern beschäftigt die Öffentlichkeit mehr denn je. Das gilt nirgendwo mehr als in Deutschland, wo es in den vergangenen 15 Jahren eine Flut von Filmen, Dokumentationen, Ausstellungen und Büchern gegeben hat. Sowohl in wissenschaftlichen als auch in populären Darstellungen herrscht jedoch tendenziell eine grundlegende Spaltung in der Wahrnehmung dieses Konflikts: Sie sehen die Deutschen entweder als Opfer oder als Täter. In den vergangenen zehn Jahren stand vor allem die Opfererzählung im Vordergrund, da Interviewer sich darauf konzentrierten, die verschütteten Erinnerungen von Zivilisten auszugraben, welche die Flächenbombardements deutscher Städte durch die Royal Airforce und die United States Army Airforces, die massenhafte Flucht vor der Roten Armee und die so häufig folgenden Morde und Vergewaltigungen miterlebt hatten. Viele der älteren Deutschen, die von ihren schmerzlichsten Erlebnissen erzählten, wollten einfach nur gehört werden und ihre Erinnerungen hinterlassen. Die Medien rückten das Leiden der deutschen Zivilbevölkerung während des Krieges in den Mittelpunkt des heutigen Interesses und konzentrierten sich auf Schlafentzug, Angstattacken und wiederkehrende Albträume. Es bildeten sich Gruppen selbsternannter »Kriegskinder«, und überall ordneten Kommentatoren solche Erlebnisse unter den Oberbegriff »Trauma« oder »Kollektivtrauma« ein. Aber der Traumabegriff betont tendenziell die Passivität und Unschuld der Opfer und hat einen stark moralischen Beiklang: In den achtziger und neunziger Jahren fasste man unter dem Begriff »Kollektivtrauma« die Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden zusammen und verband damit das Versprechen, die Opfer durch politische Anerkennung zu »stärken«.[2]
Nur am rechtsextremen politischen Rand, der jedes Jahr im Februar zum Gedenken an die Bombardierung Dresdens 1945 mit Plakaten gegen den »Bomben-Holocaust« demonstriert, gibt es Leute, die das Leid deutscher Zivilisten mit dem der Opfer nationalsozialistischer Vernichtungspolitik gleichsetzen. Und selbst diese Provokation ist weit entfernt vom unverbesserlichen Nationalismus im Westdeutschland der fünfziger Jahre, das deutsche Soldaten für ihr heldenhaftes »Opfer« in Ehren hielt, während es für die deutschen »Gräueltaten« eine Handvoll eingefleischter Nationalsozialisten, insbesondere SS-Leute, verantwortlich machte. Diese bequeme Kalter-Krieg-Ausrede von der »guten« Wehrmacht und der »bösen« SS – mit der die Wiederaufrüstung Westdeutschlands als Vollmitglied der NATO Mitte der fünfziger Jahre untermauert wurde – war Mitte der neunziger Jahre nicht länger haltbar. Einen nicht unerheblichen Anteil an dieser Entwicklung hatte die Wanderausstellung »Verbrechen der Wehrmacht«, die von einfachen Soldaten aufgenommene Fotografien öffentlicher Hinrichtungen und Massenerschießungen zeigte. Mindestens seit den achtziger Jahren hatte auch die Wissenschaft zur Schärfung des öffentlichen Bewusstseins für diese finstere Geschichte beigetragen, indem sie die Beteiligung der breiten Bevölkerung an deutschen Kriegsverbrechen immer eingehender erforschte. Die öffentliche Ausstellung privater Aufnahmen, die Soldaten neben den Bildern ihrer Kinder und Ehefrauen in ihren Uniformtaschen bei sich getragen hatten, löste starke Reaktionen aus, besonders in Österreich und in den neuen Bundesländern, wo man bis in die neunziger Jahre offene Debatten über solche Themen weitgehend vermieden hatte. Daraufhin kam es wiederum zu Gegenreaktionen, und als sich die Aufmerksamkeit auf deutsche Frauen und Kinder als Opfer britischer und amerikanischer Bombardierungen oder Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten richtete, fürchteten manche Kommentatoren ein Wiederaufleben der Konkurrenz um nationales Leid, wie sie in den fünfziger Jahren geherrscht hatte.[3]
Stattdessen entwickelten sich die beiden emotional stark besetzten Kriegserzählungen weiter parallel und völlig separat voneinander. Trotz des gemeinsamen moralischen Bewusstseins, das in der Entscheidung zutage trat, im heutigen Zentrum Berlins ein großes Holocaust-Mahnmal zu errichten, besteht in der Erörterung dieser Zeit bis heute eine tiefe Spaltung: Deutsche gelten weiterhin entweder als Opfer oder als Täter. Als ich die öffentliche Gewissenserforschung verfolgte, die den 60. Jahrestag des Kriegsendes 2005 in Deutschland begleitete, fiel mir auf, dass Wissenschaftler und Medien angesichts der Notwendigkeit, heute die richtigen Lehren aus dieser Vergangenheit zu ziehen und politische Prozesse und Strukturdefizite zu untersuchen, eine der wichtigsten Aufgaben historischer Forschung vernachlässigt hatten: nämlich zuerst und vor allem die Vergangenheit zu verstehen. Insbesondere haben Historiker nicht gefragt, wie Deutsche damals über ihre Rolle redeten und dachten. Inwieweit sprachen sie beispielsweise darüber, dass sie mit ihrem Kriegseinsatz und dem Tragen der Kriegslasten ein Regime unterstützten, das Völkermord beging? Und wie veränderten die Schlussfolgerungen, die Menschen damals zogen, ihre Einstellung zum Krieg insgesamt?
Man könnte meinen, dass solche Gespräche während des Krieges in einem Polizeistaat unmöglich gewesen wären. Aber tatsächlich begannen Deutsche im Sommer und Herbst 1943, unverblümt in der Öffentlichkeit über den Mord an den Juden zu sprechen und ihn mit den Bombenangriffen der Alliierten auf deutsche Zivilisten in Zusammenhang zu bringen. In Hamburg war festzustellen, »daß das einfache Volk, der Mittelstand und die übrigen Kreise von sich aus wiederholt Äußerungen unter vier Augen und selbst in größerem Kreise machten, die die Angriffe als Vergeltung gegen die Behandlung der Juden durch uns bezeichneten«. In Schweinfurt war ebenfalls weithin die Meinung zu hören, »daß die Terrorangriffe eine Auswirkung der durchgeführten Maßnahmen gegen die Juden sind«. Nach dem zweiten amerikanischen Bombenangriff auf die Stadt im Oktober 1943 blieb die Stimmung niedergedrückt, und manche beklagten sich unverhohlen, »daß wenn wir die Juden nicht so schlecht behandelt hätten, wir unter den Terrorangriffen nicht so leiden müßten«. Solche Ansichten wurden dem Reichssicherheitshauptamt und der Partei-Kanzlei damals nicht nur aus allen größeren deutschen Städten gemeldet, sondern selbst aus Rothenburg ob der Tauber im ruhigen fränkischen Hinterland. Äußerungen über Bombardierungen und deutsche »Maßnahmen gegen die Juden« hatten sich also bis in Teile des Deutschen Reichs ausgebreitet, die keine oder nur wenige Bombenangriffe erlebt hatten.[4]
Als ich das erfuhr, war ich erstaunt. Ich wusste bereits, dass die in der Nachkriegszeit verbreitete Behauptung, nichts gewusst und getan zu haben, eine bequeme Ausrede war. Neuere Forschungen zeigten, dass während des Krieges in Deutschland zahlreiche Informationen über den Völkermord kursierten. Sie sickerten auf vielfältigen Wegen durch: über Briefe und Fotos von der Front, durch Gespräche von Soldaten auf Bahnfahrten und im Heimaturlaub, durch die Familien von SS-Leuten, durch Bahnbeschäftigte und andere Augenzeugen wie auch über die deutschsprachigen BBC-Sendungen und die Presse des neutralen Auslandes. Aber ich hatte ebenso wie andere Historiker angenommen, solches Wissen sei diskret im engsten Familien- und Freundeskreis weitergegeben worden und nur in Form anonymer Gerüchte darüber hinausgedrungen. Wie hätte der Holocaust zum Gegenstand öffentlicher Erörterung werden können? Schließlich wurden solche Gespräche von derselben Geheimpolizei überwacht und analysiert, die in den vorangegangenen beiden Jahren die Deportation und Ermordung der Juden organisiert hatte. Noch seltsamer ist, dass Heinrich Himmler, der Reichsführer-SS und Chef der deutschen Polizei, noch zwei Monate nach dem Eintreffen solcher Berichte gegenüber SS-Offizieren behaupten konnte, nur sie seien in die Vernichtung der europäischen Juden eingeweiht und sollten »das Geheimnis mit ins Grab« nehmen. Wie war dieses angebliche Geheimnis also gelüftet worden? In den vergangenen 25 Jahren hat der Holocaust in unserem Denken über die nationalsozialistische Diktatur und den Zweiten Weltkrieg eine zentrale Stellung eingenommen. Das ist jedoch eine relativ junge Entwicklung, die uns nichts darüber sagt, wie die Deutschen damals über ihre eigene Rolle dachten.[5]
Am 18. November 1943 notierte Hauptmann August Töpperwien in seinem Tagebuch, er habe »furchtbare angeblich authentische Einzelheiten darüber gehört, wie wir in Litauen die Juden (vom Säugling bis zum Greis) ausgerottet haben!«. Schon 1939 und 1940 hatte er Gerüchte über Massaker erwähnt, die allerdings kein solches Ausmaß hatten. Diesmal versuchte Töpperwien die grauenhaften Tatsachen moralisch einzuordnen und fragte sich: »Wer darf in einem Kriege nach gesittetem Denken getötet werden?« Feindliche Soldaten, hinter den deutschen Linien kämpfende Partisanen und »in grundsätzlich eng begrenztem Umfang der nicht kämpfende Zivilist im Vergeltungsakt« konnten nach seinem Empfinden mit einer gewissen rechtlichen Legitimation getötet werden. Aber vier Tage später, am 22. November, gestand er sich ein, dass das Vorgehen gegen die Juden in eine ganz andere Kategorie fiel: »Wir vernichten nicht bloß den gegen uns kämpfenden Juden, wir wollen dieses Volk als solches buchstäblich ausrotten!«[6]
Von Anfang an hatte der gläubige Protestant und konservative Studienrat Dr. August Töpperwien Bedenken gegen Hitlers brutale Kriegführung gehegt. Offenbar stand er für eine moralische und politische Entfremdung vom Nationalsozialismus, die sich nicht nach außen in Widerstand äußerte, sondern in einem gewissen Maß an Nonkonformität und einem »inneren« Rückzug von den Appellen und Anforderungen des Regimes. Aber existierte ein solcher sicherer geistiger Hafen überhaupt? Sind alle Zweifel, die in Briefen an Familienmitglieder und in Tagebüchern geäußert wurden, Zeichen innerer Opposition, oder zeugen sie bloß von den eigenen Unsicherheiten und Nöten des Schreibers? Tatsächlich diente August Töpperwien bis in die letzten Kriegstage loyal in der Wehrmacht. Persönliche Tagebücher wie seines ermöglichen uns auszuloten, welche unabhängigen geistigen Ressourcen Deutsche für die Einschätzung ihrer Lage und als Orientierung für ihre Reaktion auf die laufenden Ereignisse besaßen. Nachdem Töpperwien sich eingestanden hatte, »wir wollen dieses Volk als solches buchstäblich ausrotten«, verstummte er. Dieses gewichtige Eingeständnis konnte er nicht mit seinem Nationalismus und mit seiner Überzeugung in Einklang bringen, dass Deutschland im Osten eine zivilisatorische Mission erfüllte und Europa gegen den Bolschewismus verteidigte. Er kam in seinem Tagebuch nicht wieder auf die Ermordung der Juden zurück, bis er im März 1945 schließlich – erstmals – zu begreifen begann, dass Deutschland vor der unabwendbaren totalen Niederlage stand: »So führt eine Menschheit Krieg, die gottlos geworden ist. Die russischen Bestialitäten im deutschen Osten – die Terrorangriffe der Angloamerikaner – unser Kampf gegen die Juden (Sterilisierung der gesunden Frauen, Erschießung vom Säugling bis zur Greisin, Vergasung jüdischer Transportzüge)!« Auch wenn ihm die bevorstehende Niederlage nun als eine Art göttlicher Strafe für das erschien, was die Deutschen den Juden angetan hatten, fand Töpperwien doch eindeutig, dass diese Taten nicht schlimmer waren als das, was die Alliierten den Deutschen antaten.[7]
Im Sommer und Herbst 1943 veranlasste ein drohender Untergang anderer Art Zivilisten an der Heimatfront, so unverhohlen über die deutsche Verantwortung für die Ermordung der Juden zu reden. Vom 25. Juli bis zum 2. August 1943 war Hamburg einer Serie von Bombardierungen ausgesetzt, die einen gewaltigen Feuersturm auslösten. Die Hälfte der Stadt wurde zerstört, und 34000 Menschen starben. Viele Deutsche empfanden dieses Ereignis als Apokalypse. Das »Gefühl der Sicherheit« sei wegen der nachweislichen Bedrohung größerer Städte in ganz Deutschland »urplötzlich zusammengesackt« und großer Bestürzung gewichen, berichtete der SS-Sicherheitsdienst. Am ersten Tag des Feuersturms, dem 25. Juli, kam es weiter entfernt zu einem anderen wichtigen Einschnitt: Der italienische Diktator Benito Mussolini wurde nach einundzwanzigjähriger Herrschaft in einem unblutigen Putsch gestürzt. Schon bald brachten Deutsche diese beiden Ereignisse miteinander in Verbindung. In den folgenden fünf Wochen gab es, Meldungen zufolge, unverblümte öffentliche Diskussionen, dass es vielleicht die »beste« oder sogar »letzte« Möglichkeit zu einem »Separatfrieden« mit den westlichen Alliierten sei, wenn man dem italienischen Beispiel folgen und das nationalsozialistische Regime durch eine Militärdiktatur ersetzen würde. Für die NS-Führung deuteten solche Meldungen offenbar darauf hin, dass die Kampfmoral in der Zivilbevölkerung erneut zusammenbrechen und die Kapitulation und Revolution vom November 1918 sich wiederholen könnten. Tatsächlich dauerte die Krise aber nur kurze Zeit. Anfang September 1943 war sie bereits vorüber, als das Regime in die Zivilverteidigung investierte und Massenevakuierungen aus den Städten organisierte. Mit der Besetzung großer Teile Italiens stabilisierte sich auch die militärische Lage der Wehrmacht, und schließlich setzte die Gestapo durch, dass gegen solches »defätistisches« Gerede selektiv hart durchgegriffen wurde.
Diese öffentlichen Äußerungen über die deutsche Verantwortung für die Ermordung der Juden erwuchsen ebenso wie Töpperwiens private Überlegungen aus einem tiefgreifenden moralischen und körperlichen Unbehagen, das sich einstellte, als die unablässigen britischen Luftangriffe weit über die tatsächlich bombardierten Städte hinaus für ein Gefühl der Wehrlosigkeit sorgten. Obwohl die von den Bombardierungen Hamburgs ausgelöste politische Krise nur kurz währte, hatte sie doch langfristige Auswirkungen. Denn sie brachte tiefsitzende Ängste zum Vorschein und gab für spätere Krisensituationen bestimmte Muster der öffentlichen Auseinandersetzung und Interpretation vor, in denen Deutsche das Eingeständnis ihrer Schuld und die Angst vor Vergeltung mit dem Empfinden verquickten, selbst Opfer zu sein.[8]
Bei deutschen Juden bestimmte der fortschreitende Holocaust unweigerlich die Wahrnehmung des Krieges. Bei nichtjüdischen Deutschen war es genau umgekehrt: Sie beschäftigte in erster Linie der Krieg, und ihre jeweilige Sicht dieses Krieges lieferte die Folie für ihre Einordnung des Völkermordes. Aus dem extremen Ungleichgewicht, das zwischen der Macht und den Entscheidungsmöglichkeiten von Juden und Nichtjuden in Deutschland herrschte, erwuchsen also gegensätzliche Deutungen derselben Ereignisse, die sich in grundlegend unterschiedlichen Hoffnungen und Ängsten äußerten. Dieses Problem hat meine Herangehensweise an eine Darstellung der Geschichte Deutschlands im Zweiten Weltkrieg bestimmt. Während andere Historiker die Maschinerie des Massenmordes beleuchtet und erörtert haben, wie oder warum der Holocaust stattfand, befasse ich mich stärker mit dem Phänomen, wie die deutsche Gesellschaft das Wissen um den Holocaust als vollendete Tatsache begriff und hinnahm. Wie wirkte sich die allmählich durchdringende Erkenntnis, dass die Deutschen einen völkermörderischen Krieg führten, auf sie aus? Oder umgekehrt gefragt: Wie prägte der Krieg ihre Wahrnehmung des Genozids?
Äußerungen, die die Bombenangriffe im Juli und August 1943 verstanden als eine Bestrafung durch die Alliierten oder als »jüdische Vergeltung« für das, »was wir den Juden angetan haben«, belegen, dass die Bevölkerung die unablässige Propaganda, die diese Bombardierungen – besonders im ersten Halbjahr 1943 – als »jüdische Terrorangriffe« hinstellte, allgemein akzeptiert hatte. Zum Entsetzen von Goebbels und anderen führenden Nationalsozialisten ließen solche Überlegungen zugleich jedoch merkwürdige Anflüge von Selbstvorwürfen erkennen. Aus den Erklärungsmustern sprach unterschwellig der Wunsch, diesen für beide Seiten zerstörerischen Kreislauf zu durchbrechen, da nun deutsche Städte dem Erdboden gleichgemacht wurden. Aber die »durchgeführten Maßnahmen gegen die Juden«, wie die Berichterstatter des Sicherheitsdienstes sie beschönigend nannten, lagen bereits in der Vergangenheit: Die europaweite Deportation der Juden hatte im vorangegangenen Jahr stattgefunden. Unter dem Eindruck des Feuersturms von Hamburg stellten sich Deutsche aller Schichten die Frage, ob es ein Fehler war, die Juden ermordet zu haben. Eine solche Krise hatte ganz reale und bleibende psychische Auswirkungen.
Manichäische Metaphern wie »entweder/oder«, »Sein oder Nichtsein«, »alles oder nichts«, »Sieg oder Untergang« entsprangen im Deutschland einer langen rhetorischen Tradition. Seit der Niederlage 1918 hatten sie in Hitlers Ideen eine zentrale Rolle gespielt und vorher bereits im Anschluss an Kaiser Wilhelms »Erklärung an das deutsche Volk« vom 6. August 1914 einen Grundpfeiler der Erster-Weltkriegs-Propaganda gebildet. Aber dieser apokalyptische Ausblick war keineswegs das, was Hitlers Herrschaft in den dreißiger Jahren oder selbst in den ersten Kriegsjahren populär gemacht hatte. Erst ab Mitte des Zweiten Weltkriegs wurde die deutsche Gesellschaft für eine solche Denkweise empfänglicher. Als sich das Blatt für Deutschland wendete, entsprach die extremistische Rhetorik mit einem Mal anscheinend dem gesunden Menschenverstand. Nach den »Terrorangriffen« der Alliierten erlangte die grundlegende Existenzbedrohung von »Sein oder Nichtsein« eine beunruhigende Realität. Was im Sommer 1943 die Krisenstimmung schürte, war eine weitverbreitete Angst, dass die Deutschen den Konsequenzen eines rücksichtslosen rassistischen Krieges, den sie selbst angefangen hatten, nicht entgehen konnten. Um diese Krise zu überwinden, mussten sie nicht nur ihre früheren Erwartungen und Prognosen über den Krieg aufgeben, sondern auch traditionelle moralische Hemmungen über Bord werfen und sich über bestehende Vorstellungen von Anstand und Scham hinwegsetzen. Deutsche brauchten keine Nationalsozialisten zu sein, um für ihr Land zu kämpfen, mussten aber wohl oder übel erkennen, dass es unmöglich war, von der Skrupellosigkeit dieses Krieges und der apokalyptischen Stimmung, die er erzeugte, unberührt zu bleiben.[9]
Die Erkenntnis, dass Krisen während eines Krieges zu einer Umwälzung und Radikalisierung gesellschaftlicher Wertvorstellungen führen können, hat grundlegende Auswirkungen auf unser Verständnis der Beziehung zwischen dem nationalsozialistischen Regime und der deutschen Gesellschaft. In den vergangenen 30 Jahren sind die meisten Historiker von der Annahme ausgegangen, Krisen, wie sie nach dem Feuersturm von Hamburg oder einige Monate zuvor nach der Niederlage der 6. Armee bei Stalingrad auftraten, hätten die Stimmung in der deutschen Gesellschaft unwiderruflich in Defätismus kippen lassen: Die Mehrheit der Bevölkerung habe sich zunehmend von allem abgewandt, wofür das nationalsozialistische Regime stand, und habe sich nur noch durch Terror bei der Stange halten lassen. Tatsächlich gibt es keine Kennzahlen, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen sinkender Zustimmung und zunehmender Repression in der Mitte des Krieges belegen würden: Die Zahl der von Gerichten verhängten Todesurteile stieg zwar von 1941 bis 1942 drastisch von 1292 auf 4457 – aber das war bereits vor der Niederlage von Stalingrad. Deutsche Richter reagierten damit nicht etwa auf wachsende Opposition und Unzufriedenheit in der Bevölkerung, sondern auf Druck von oben, besonders von Hitler, härter gegen Wiederholungstäter vorzugehen, was gewöhnlich Kleinkriminelle traf. Dabei handelte es sich zugleich um Rassenjustiz, da polnische und tschechische Zwangsarbeiter in Deutschland einen überproportional hohen Anteil an den zum Tode Verurteilten und Hingerichteten ausmachten. Erst im Herbst 1944, als die alliierten Truppen vor den deutschen Grenzen standen, waren »gewöhnliche Deutsche« einer wachsenden Welle von Repressionen ausgesetzt, wobei sich die schlimmsten Terrorexzesse auf die Endphase der Kämpfe im März, April und in der ersten Maiwoche 1945 beschränkten. Selbst in diesen letzten Zuckungen der Diktatur konnte die massenhafte Gewalt die deutsche Gesellschaft nicht unterkriegen und zum Schweigen bringen: im Gegenteil – viele Deutsche empfanden sich weiterhin als loyale Patrioten, die aber gerade deshalb auch das Recht hatten, Fehler der Nationalsozialisten öffentlich zu kritisieren, denn in ihren Augen hatte ihre Treue einiges Gewicht, und zwar bis zum bitteren Ende des Krieges.[10]
Der lange herrschende Konsens unter Historikern, dass die deutsche Bevölkerung defätistisch geworden sei, beruht auf einer dem Alltagsdenken entsprungenen Schlussfolgerung: Historiker setzen Erfolge des Regimes mit Zustimmung und Fehlschläge mit Kritik und Opposition gleich. In Friedenszeiten geht diese Gleichung auf – nicht aber unter den Bedingungen eines Weltkriegs. Sie kann nicht erklären, was tatsächlich passiert ist. Wie schafften es die Deutschen, von 1943 bis 1945 weiterzukämpfen – Jahre, in denen sie unvorstellbare Zerstörungen und Verluste zu verkraften hatten? Das vorliegende Buch bietet eine völlig andere Sicht darauf, welche Auswirkungen die Niederlagen und Krisen des Krieges auf die deutsche Gesellschaft hatten. Sicher spielten nationalsozialistische Zwangsmaßnahmen bis hin zum Terror gegen Oppositionelle, Deserteure und andere in gewissen Momenten eine Rolle, aber dies war nie der einzige – oder wichtigste – Grund, um weiterzukämpfen. Die Deutschen konnten weder den Nationalsozialismus noch den Krieg ablehnen, weil sie eine mögliche Niederlage für existenzbedrohend hielten. Je schlimmer der Krieg wurde, umso offenkundiger »defensiv« gestaltete er sich. Aufeinanderfolgende Krisen führten keineswegs zum Zusammenbruch, sondern wirkten als Katalysatoren eines radikalen Wandels, in dem die Deutschen die Situation zu meistern versuchten und überdachten, was sie erwarten konnten. Katastrophale Ereignisse wie die Niederlage in Stalingrad und der Feuersturm von Hamburg führten tatsächlich zu einem drastischen Popularitätsverlust des Regimes, stellten aber den patriotischen Zusammenhalt an sich nicht in Frage. Die Kriegsbelastungen äußerten sich in der deutschen Gesellschaft in einer ganzen Palette von Verstimmungen und sozialen Konflikten, wobei das Regime in vielen Fällen aufgefordert wurde, zu vermitteln und zu entschärfen. Aber so unpopulär der Krieg auch war, galt er doch weiterhin als legitim – und zwar mehr noch als der Nationalsozialismus. Deutschlands Krisen in der Mitte des Krieges führten nicht zu Defätismus, sondern zu einer Verhärtung der gesellschaftlichen Einstellungen. Mit diesen komplexeren, dynamischeren und verwirrenderen Elementen in den Reaktionen der deutschen Bevölkerung auf den Krieg befasst sich dieses Buch.
Als am 26. August 1939 die allgemeine Mobilmachung erfolgte, hatten die Deutschen keine Ahnung, was ihnen bevorstand. Das verhinderte allerdings nicht, dass die meisten den Krieg beklommen aufnahmen. Schließlich wussten sie, was hinter ihnen lag: 1,8 Millionen gefallene Soldaten im letzten Krieg, der »Rübenwinter« 1917, die spanische Grippe 1918 und die Gesichter hungernder Kinder, weil die britische Marine ihre Blockade bis 1919 aufrechterhalten hatte, um die neue deutsche Regierung zur Unterzeichnung eines demütigenden »Friedensdiktats« zu zwingen. In den zwanziger und dreißiger Jahren war die deutsche Politik von Versuchen geprägt, sich aus den Fesseln des Versailler Vertrages zu befreien, aber selbst Hitlers größte außenpolitische Triumphe wie das Münchener Abkommen 1938 waren von der Kriegsangst der Bevölkerung überschattet. Die erste Lektion aus dem Krieg 1914 bis 1918 war, dass er sich nicht wiederholen sollte. Der Beginn des neuen Krieges und die damit einhergehenden Rationierungen sorgten daher für gedrückte Stimmung. Im ersten Kriegswinter verglich die Stadtbevölkerung die Versorgungsengpässe bei Lebensmitteln, Kleidung und vor allem Kohle zum Heizen mit denen der Winter 1916 und 1917 und murrte über den chronischen Mangel. Das ließ nichts Gutes für das »Durchhaltevermögen« der Deutschen ahnen, wie der SS-Sicherheitsdienst die NS-Führung in seinen wöchentlichen »Stimmungsberichten« wiederholt warnte.
Für die Nationalsozialisten warfen die ersten Kriegsmonate entscheidende Fragen auf zur Stabilität ihrer Herrschaft, die sie seit ihrer Machtergreifung 1933 aufgebaut hatten. Oberflächlich betrachtet, hatten sie in den Vorkriegsjahren rasante Erfolge erzielt. Eine Vielzahl von Motiven – von materiellen Vorteilen über karrieristisches Mitläufertum bis hin zu echter Überzeugung – hatten die Mitgliederzahlen der NSDAP von 1932 bis zum Kriegsbeginn von 850000 auf 5,5 Millionen ansteigen lassen. Zu dieser Zeit hatten die NS-Frauenschaft 2,3 und die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel zusammen 8,7 Millionen Mitglieder; alle diese Organisationen führten ideologische Schulungen durch, die von abendlichen Zusammenkünften bis zu Sommerlagern reichten. Die Nachfolgeorganisationen der Arbeiterwohlfahrt und der Gewerkschaften, die NS-Volkswohlfahrt und die Deutsche Arbeitsfront, hatten 14 beziehungsweise 22 Millionen Mitglieder. Noch beeindruckender war, dass ihr Personal überwiegend aus ehrenamtlichen Helfern bestand. Insgesamt gehörten 1939 zwei Drittel der Bevölkerung mindestens einer der nationalsozialistischen Massenorganisationen an.[11]
Dieser Erfolg beruhte auf einem zutiefst polarisierenden Erbe von Zwang und Konsens. Zum Abschluss ihrer Straßenkampfzeiten zerschlugen die Nationalsozialisten 1933 die Linke endgültig. Mit aktiver Unterstützung von Polizei, Reichswehr und sogar Feuerwehr riegelten SA- und SS-Leute »rote« Wohnviertel ab, durchsuchten die Häuser, schüchterten die Bewohner teils mit Prügeln ein und verhafteten Aktivisten und Funktionäre. Auf diese wiederholten Razzien folgte das offizielle Verbot linker Parteien und Organisationen: der Kommunistischen Partei im März, der Gewerkschaften im Mai und schließlich der Sozialdemokratischen Partei im Juni 1933. Im Mai befanden sich bereits 50000 Oppositionelle, überwiegend Kommunisten und Sozialdemokraten, in Konzentrationslagern. Bis zum Sommer 1934 wurden im Zuge des Terrors gegen die Linke schätzungsweise bis zu 200000 Männer und Frauen durch diesen neuen Apparat der NS-Schreckensherrschaft geschleust. In den Lagern zielten öffentliche Bestrafungen und ein Repertoire an demütigendem, sinnlosem Drill darauf ab, Fügsamkeit zu erzwingen und den Willen der Gefangenen zu brechen. Der eigentliche Erfolg dieses »Umerziehungsprogramms« stellte sich allerdings erst ein, als die eingeschüchterten, geduckten Häftlinge massenhaft entlassen wurden und in ihre Familien und ihr früheres Umfeld zurückkehrten: Im Sommer 1935 befanden sich in den Konzentrationslagern nicht einmal mehr 4000 Häftlinge, aber das »andere Deutschland«, das die Linke repräsentiert hatte, war politisch zerschlagen.[12]
Als Deutschland im August 1939 mobilmachte, verhaftete die Gestapo vorsorglich erneut ehemalige sozialdemokratische Politiker. Schwieriger einzuschätzen war der Erfolg des Regimes, in Arbeiterkreisen die Subkultur zu vernichten, die seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts die linke Politik getragen hatte. Auch unter der neuen Führung hielt sich davon sicher manches in einigen Nischen. Vor 1933 hatten Arbeitersportvereine mit 700000 Mitgliedern den Fußball dominiert, gefolgt von katholischen Vereinen mit 240000 Mitgliedern. Obwohl die Deutsche Arbeitsfront sie sehr bald absorbierte, die Fußball-Ligen umstrukturierte und sie konkurrenzorientierter und spannender machte, bekam sie die Fans im Grunde nicht unter Kontrolle. Im November 1940 endete ein Freundschaftsspiel im Wiener Praterstadion – Admira Wien spielte gegen Schalke 04 – mit massiven Krawallen: Nach dem Abpfiff stürmten Wiener Fans das Spielfeld und bewarfen die Gelsenkirchener Spieler mit Steinen, bevor diese sich in Sicherheit bringen konnten. Die Fenster ihres Mannschaftsbusses wurden eingeschlagen und sogar das Auto des Gauleiters von Wien, des aus Berlin stammenden Baldur von Schirach, demoliert. Der Sicherheitsdienst der SS sah darin in erster Linie eine politische Demonstration, was ziemlich sicher eine Fehleinschätzung war. Tatsächlich besaßen beide Vereine traditionell eine äußerst loyale, ehemals »rote« Arbeiterbasis, und die Anhänger sämtlicher Wiener Fußballclubs sahen in der als »Versöhnungsspiel« angesetzten Begegnung eine Gelegenheit zur Revanche für Admiras demütigende 0:9-Niederlage gegen Schalke 04 beim Meisterschaftsfinale 1939 – eine Niederlage, für die Wiener Fans selbstverständlich nicht die unglaubliche Erfolgsserie der Mannschaft aus dem Ruhrgebiet verantwortlich machten, sondern die einseitige Schiedsrichterleistung in Berlin. Bei den Krawallen ging es mindestens ebenso um männlichen Lokalpatriotismus wie um einen österreichischen Protest gegen den Zustrom arroganter »Piefkes« nach Wien seit dem »Anschluss« im März 1938.[13]
Solche Reste von Klassenbewusstsein bei der Arbeiterschaft besaßen jedoch wenig Wirkmacht. Die Organisationen und Institutionen der Solidargemeinschaft, die Sozialdemokraten mit Genossenschaften, Wohlfahrtseinrichtungen, Chören, Turnvereinen, Sterbekassen, Kindergärten und Fahrradvereinen mühsam aufgebaut hatten, waren im Zuge der Gleichschaltung entweder in NS-Organisationen überführt oder verboten worden. Im Juli 1936 beklagten Sozialdemokraten im Exil den Zusammenbruch der traditionellen kollektiven Identität, die sie repräsentierten, und räumten ein: »Das Interesse am Klassenschicksal ist zum größten Teil völlig verschwunden, an seine Stelle ist der kleinlichste Einzel- und Familienegotismus getreten.« Als die Linke sich nach dem Krieg neu formierte, konnte sie zwar ihre Wählerschaft rasch wieder mobilisieren, schaffte es aber nicht, die dichte Organisationskultur und identitätsstiftende Kraft, die sie vor 1933 besessen hatte, wiederaufzubauen. Bei Kriegsbeginn konnten SS-Sicherheitsdienst und Gestapo selbstverständlich nicht wissen, wie erfolgreich ihre Kombination aus Zwang und Inklusion gewirkt hatte, daher behielten sie die Arbeiterschaft weiterhin im Auge, um mögliche Aktionen von dieser Seite im Keim zu ersticken.[14]
Wesentlich sicherer konnten sich die Nationalsozialisten der Unterstützung der Mittelschicht sein: der Bauern, selbständigen Geschäftsleute, Handwerker, Akademiker und leitenden Angestellten. Protestanten begrüßten die »nationale Revolution« des Jahres 1933 mit einem Enthusiasmus und einer Hoffnung auf geistige Erneuerung, die nur mit ihrer begeisterten Unterstützung des Krieges 1914 vergleichbar sind. Geschlossen lehnten sie die »gottlose« Moderne der Weimarer Republik ab, die für sie mit den »Ideen von 1789«, mit Pazifisten, Demokraten, Juden und allen verknüpft war, die Deutschlands Niederlage bereitwillig akzeptierten. Diese breite Allianz wurde bereits in den zwanziger Jahren von evangelischen Pfarrern und Theologen geschmiedet und fand mit ihrem Eintreten für die Schaffung einer neuen »Volksgemeinschaft« starke Resonanz im gesamten politischen Spektrum. Ehemalige Liberale, Konservative, Mitglieder der katholischen Zentrumspartei und sogar ehemalige SPD-Wähler hatten noch in Erinnerung, dass sie im Ersten Weltkrieg und während der Weimarer Republik die Idee einer »Volksgemeinschaft« unterstützt hatten – noch bevor die Nationalsozialisten sie zu einem ihrer zentralen Schlagworte machten. Selbst konservative jüdische Nationalisten wie die Historiker Hans Rothfels und Ernst Kantorowicz begrüßten diese »nationale Revolution« und konnten sich nur schwer umstellen, als sie wegen ihrer »nichtarischen« Abstammung zur Emigration gezwungen wurden.[15]
Die konservativen Deutschen, die keine Anhänger des Nationalsozialismus waren, sahen die nationale tätige Reue für das Versagen von 1918 als zentrale Aufgabe, die sie und ihre Landsleute auf dem Weg zur »nationalen Erlösung« zu bewältigen hatten. Viele der Argumente, die den Nationalsozialisten gute Dienste leisteten, stammten von Denkern, die nicht der NSDAP angehörten, wie dem jungen Theologen und ehemaligen Militärpfarrer Paul Althaus. Schon 1919 hatte er den Pazifismus angeprangert und vertreten, die Deutschen müssten sich des göttlichen Vertrauens erst wieder würdig erweisen, indem sie sich gegen die Versailler Verträge erhöben. Mit einer Mischung aus spitzfindigen theologischen Argumenten und militantem Nationalismus avancierte Althaus zu einem herausragenden und zunehmend zentralen Verfechter des konservativen Luthertums und der Ansicht, dass die Deutschen Gottes auserwähltes Volk nur bleiben würden, wenn sie ihren nationalen Pflichten gewachsen seien. Radikalere Nationalsozialisten mochten – erfolglos – versuchen, den Deutschen die Religion abzugewöhnen, solche Appelle zur geistigen Erneuerung der Nation unterstützten sie jedoch begeistert. Außerdem trugen nichtnationalsozialistische Theologen wie Althaus erheblich dazu bei, andere – universalistische und pazifistische – Ansichten wie die von Paul Tillich ins Abseits zu stellen und zu verunglimpfen.[16]
Als die Nationalsozialisten an die Macht gelangten, entschieden sie sich gegen eine umfassende gesellschaftliche Umwälzung und strebten zunächst eine Gefühlsrevolution an: So inszenierten sie populäre Massenspektakel wie Aufmärsche und Fackelzüge paramilitärischer Verbände mit Stiefeln, Uniformen und Fahnen. Die Ambitionen der Nationalsozialisten reichten bis in das Allerheiligste der bürgerlichen Kultur, die Stadttheater: Hier setzten sie dem klassischen Repertoire des 19. Jahrhunderts Agitprop-Stücke über den Widerstand gegen die französische Besatzung im Ruhrgebiet während der zwanziger Jahre entgegen, etwa das Drama über den Kampf und das Martyrium des Albert Leo Schlageter, eines Freikorpslers, der 1923 wegen Sprengstoffanschlägen von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt worden war. Zudem brachen sie 1933/34 die räumlichen Grenzen des Theaters auf, indem sie auf Freilichtbühnen »Thingspiele« organisierten, den mittelalterlichen Moralitäten vergleichbare Lehrstücke mit gigantischen lebenden Bildern und einem Massenaufgebot von bis zu 17000 Komparsen, die bis zu 60000 Zuschauer anzogen. Viele dieser Stücke sollten die Deutschen ihre »Schmach« des Ersten Weltkriegs erneut durchleben und schließlich überwinden lassen. So standen in Richard Euringers Werk »Deutsche Passion« die Gefallenen des Ersten Weltkriegs buchstäblich wieder auf und marschierten als Ausdruck der Sehnsucht nach Einheit und Erneuerung in Bataillonsstärke mit gespenstisch weißen Gesichtern unter ihren Stahlhelmen über die Bühne.[17]
Um 1935 hatten die in Mode gekommenen Thingspiele ebenso ausgedient wie die nationalsozialistischen Agitprop-Produktionen in den Stadttheatern. Goebbels sah sich mit einer Rebellion der Abonnenten konfrontiert, als diese ihre Abonnements kündigten. Prompt änderte er seinen Kurs, warf die erst kürzlich verpflichteten nationalsozialistischen Theaterintendanten hinaus und ersetzte sie durch kompetente Traditionalisten. Das überwiegend kleinbürgerliche und bürgerliche Publikum bekam nun wieder das, was es sehen wollte: Klassiker. Wurde der zehnte Jahrestag des Bürgerbräu-Putsches im November 1933 mit nationalsozialistischen Stücken gefeiert, so waren es zehn Jahre später Mozart-Opern. Trotz dieses Rückzugs auf inhaltlichem Gebiet stattete Goebbels die Theater weiterhin mit enormen Mitteln aus – tatsächlich erhielten sie mehr Geld, als er für die eigentliche Propaganda aufwendete.[18]
Da die Nationalsozialisten die Not und Unsicherheit der Weltwirtschaftskrise beendet hatten, bestand die Gefahr, dass allein diese Tatsache die ausschlaggebenden Beweggründe für eine Unterstützung des Dritten Reichs geliefert hatte. In führenden Partei- und Regierungsgremien war man daher besorgt, dass dieser Erfolg sich als relativ flüchtig erweisen könnte: Sie konnten nur schwer einschätzen, ob es ihnen gelang, der Bevölkerung nationalsozialistische Grundwerte und Überzeugungen einzuimpfen. Unter dem Schirm der »Volksgemeinschaft« gab es Debatten über wirtschaftliche Umverteilung und Sozialpolitik, über Lebensreform und Pädagogik und sogar darüber, ob Frauen statt Röcken Hosen tragen dürften. Hitler achtete sorgfältig darauf, in der Öffentlichkeit nie »päpstliche« Äußerungen zu machen, und der Chefideologe der Partei, Alfred Rosenberg, der dogmatische Erklärungen abgab, war wegen seiner antichristlichen Positionen weithin in Misskredit geraten und besaß in dem neuen Regime eindeutig keine Schlüsselposition.[19]
Am Vorabend des Krieges gehörten die meisten Deutschen sowohl einer christlichen Religionsgemeinschaft als auch einer NS-Organisation an. Zwei Drittel der Bevölkerung waren Mitglied einer nationalsozialistischen Organisation, ein weitaus höherer Anteil – nämlich 94 Prozent – war Mitglied einer katholischen oder evangelischen Kirche. In Deutschland waren die Kirchen die wichtigsten unabhängigen Institutionen der Zivilgesellschaft, und eine Reihe von Priestern und Pfarrern, die hartnäckig von der Kanzel aus Kritik an nationalsozialistischen Maßnahmen übten, wurden in Konzentrationslagern inhaftiert. Der Berliner Pfarrer Martin Niemöller, der unverblümteste Kritiker der Nationalsozialisten, wurde im Juli 1937 von der Gestapo verhaftet und verbrachte den Rest des Dritten Reichs im Konzentrationslager, zunächst in Sachsenhausen und ab 1941 in Dachau. Der junge evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer wurde im April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg gehängt. Beide Männer sollten zu Symbolfiguren für Zivilcourage gegenüber dem NS-Terror werden, wenn auch erst Jahrzehnte nach dem Krieg: Bonhoeffer stand für eine liberale, humanitäre Theologie, die mit Paul Tillich verdrängt wurde und deren wichtigste Vertreter ins Exil gegangen waren. Sowohl ihre Ideen als auch Bonhoeffer als Symbolfigur tauchten in der Nachkriegszeit in Westdeutschland erst Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre wieder auf. Bei Niemöller sah die Sache anders aus: Er war kein liberaler Demokrat, sondern ein konservativer, antisemitischer Nationalist, hatte es im Ersten Weltkrieg bis zum U-Boot-Kommandanten gebracht, 1919 und 1920 ein Freikorps-Bataillon kommandiert, Theologie studiert und von 1924 bis 1933 aktiv Hitler bei jedem Wahlkampf unterstützt. Bei Kriegsbeginn 1939 schrieb Niemöller aus Sachsenhausen an Großadmiral Raeder, den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, und bot freiwillig an, erneut zu dienen. Niemöllers kritische Haltung in den dreißiger Jahren war eher religiös als politisch motiviert, und das Christentum, das er vertrat, musste innerhalb der evangelischen Kirchen um seinen Platz ringen.[20]
Nachdem deutsche Protestanten die »nationale Revolution« der Nationalsozialisten 1933 begeistert begrüßt hatten, spalteten sie sich sehr bald in drei Flügel. Viele Pfarrer schlossen sich den Deutschen Christen an, die diese geistige Erneuerung zu einer theologischen und liturgischen ausweiten wollten: Sie strebten ein Verbot des Alten Testaments, eine Säuberung des Neuen Testaments von jüdischen Einflüssen und den Ausschluss jüdischer Konvertiten von Kirchenämtern an. Traditionalisten, die ihre Heilige Schrift und ihre Liturgie bewahren und die Kirche vor staatlichem Einfluss schützen wollten, schlossen sich zunächst zum Pfarrernotbund zusammen und gründeten im Mai 1934 die Bekennende Kirche. Diese Spaltung wird weithin als Auseinandersetzung zwischen Liberalen und Nationalsozialisten um das Wesen der Kirche missverstanden und dargestellt. Das war es jedoch keineswegs: Obwohl Karl Barth, der Hauptautor der Barmer Theologischen Erklärung, der Diktatur kritisch gegenüberstand und in die Schweiz zurückkehrte, wurde er nicht einmal unter Pfarrern, die der Bekennenden Kirche angehörten, viel gelesen: Denn er war kein Lutheraner wie die meisten deutschen Protestanten, sondern Calvinist. Viele Pfarrer auf beiden Seiten dieser Kluft – so auch Niemöller – vertraten dieselben nationalistischen, autoritären und gesellschaftlich einigenden politischen Grundwerte, und das eröffnete einer dritten, nicht organisierten Gruppe Lutherischer Theologen um Paul Althaus erhebliche Einflussmöglichkeiten. Althaus trat der NSDAP nicht bei, begrüßte aber Hitlers Machtergreifung als »Wunder und Geschenk Gottes«. Er beteiligte sich zwar nie aktiv an Bücherverbrennungen verbotener Autoren, rechtfertigte sie aber. Nach dem Novemberpogrom 1938 gegen deutsche Juden erklärte er, da Gott die Geschichte lenke, sei ihr jüngstes Leid ein Beleg ihrer Schuld.[21]
Auch die deutschen Katholiken waren gespalten, allerdings nach Generationen. Ihre Bischöfe waren mit ihren 60 bis 80 Jahren eine Generation älter als die Mehrheit der evangelischen Theologen und die NS-Führung und hatten überwiegend bereits vor dem Ersten Weltkrieg ihre Weihen erhalten. In ihrem Studium hatten sie eine Ausbildung in einer streng konservativen neuaristotelischen Theologie erfahren, die sich durch bestechende Logik und abstrakte Sprache auszeichnete. Sie gaben der »Moderne« die Schuld an Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus und Atheismus. Die Kluft zwischen den älteren Bischöfen und jüngeren Priestern und Laien sorgte innerhalb der Kirche für Spannungen sowohl über die Form des Abendmahls als auch über politische Inhalte. Während die Bischöfe eine engstirnige, konservative Haltung gegenüber Reformen vertraten, sahen viele jüngere Katholiken die »nationale Revolution« von 1933 als Chance, sich stärker an der Gestaltung der deutschen Gesellschaft zu beteiligen. Der Krieg sollte diesen Generationenkonflikt zwischen Konservativen und Reformern noch verschärfen.[22]
Unter Druck geriet die katholische Kirche auch durch die Nationalsozialisten: Sie verboten die katholische Jugendbewegung, versuchten das Bildungswesen stärker zu säkularisieren und die Heil- und Pflegeanstalten der Caritas zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen zur Zwangssterilisation zu drängen. Als NS-Aktivisten 1938 während der Sommerferien die Kruzifixe aus bayerischen Schulen entfernten, brachten sie die ländliche Bevölkerung gegen sich auf, die radikale Kräfte wie die SS, den zuständigen Gauleiter und den NS-Chefideologen Alfred Rosenberg dafür verantwortlich machten. Die Katholiken schoren jedoch nicht alle Nationalsozialisten über einen Kamm. Viele blieben aktive Mitglieder in NS-Organisationen und suchten Unterstützung bei führenden Nationalsozialisten, die ihrer Religion mehr Verständnis entgegenbrachten, wie Hermann Göring. Hitler selbst hielt mit seinen Ansichten zur Religion so erfolgreich hinterm Berg, dass sowohl der Erzbischof von München, Kardinal Faulhaber, als auch der Primas der katholischen Kirche in Deutschland, Kardinal Bertram von Breslau, von seiner tiefen Religiosität überzeugt waren. Ihre gemeinsamen Verpflichtungen gegenüber dem Volk brachten die katholische Kirche und das NS-Regime während des Krieges zu einer unbehaglichen »antagonistischen Kooperation«, wie Historiker es in jüngster Zeit nennen.[23]
Ohne klare geistige Führung blieb es Katholiken und Protestanten selbst überlassen, ihre Gewissenskonflikte in privaten Tagebüchern und Briefen auszutragen – und Historikern damit ein Zeugnis von unschätzbarem Wert über die Moral einiger der liberaleren und humaneren Mitglieder der »Volksgemeinschaft« zu hinterlassen.[24]
Als im September 1939 der Krieg begann, war er in Deutschland äußerst unpopulär. Aber niemand fragte eingehender nach, warum es eigentlich dazu gekommen war. Für Briten und Franzosen lag auf der Hand, dass Hitler mit seinem unprovozierten Angriff auf Polen einen Eroberungskrieg führte, dagegen war für die meisten Deutschen ebenso klar, dass alliierte Machenschaften und polnische Aggression ihnen einen Verteidigungskrieg aufgezwungen hatten. Solche Sichtweisen waren lange aus jeder ernsthaften historischen Forschung verbannt und fristeten ein Nischendasein auf Internetseiten, die Ansichten von Neonazis bedienten. Daher erscheint einem heutigen Publikum allein schon die Vorstellung merkwürdig, dass damals so viele Deutsche, die keineswegs überzeugte Nationalsozialisten waren, allen Ernstes und aufrichtig von dieser Sicht des Krieges überzeugt gewesen sein sollen. Wie konnten sie der Täuschung erliegen, einen brutalen kolonialen Eroberungskrieg, der gezielt herbeigeführt wurde, für einen Verteidigungskrieg zu halten? Wie konnten sie sich als bedrängte Patrioten sehen und nicht als Krieger für Hitlers Herrenvolk?
Der Erste Weltkrieg diente nicht nur als Maßstab für Not und Härten an der Heimatfront, sondern prägte auch grundlegend, wie die Bevölkerung die Ursachen für diesen zweiten Krieg innerhalb einer Generation wahrnahm: Am 3. September 1939 erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg, eine Parallele zu 1914, als Russland als Erster mobilgemacht hatte – worauf es schließlich in Ostpreußen eingefallen war. Im August 1914 war es zum Krieg gekommen, weil Großbritannien angeblich lange eine »Einkreisung« Deutschlands durch feindliche Mächte betrieben hatte, um sein eigenes Weltreich zu schützen und das Deutsche Reich in die Schranken zu weisen. Ganz ähnliche Überlegungen, häufig in exakt denselben Formulierungen, tauchten auch 1939 wieder in Tagebüchern Deutscher auf, die den Fortgang der Polenkrise verfolgten. Wieder waren die britischen Weltmachtambitionen die Wurzel allen Übels. Die brüske Ablehnung der wiederholten Friedensangebote Hitlers nach der Eroberung Polens und erneut 1940 nach dem Fall Frankreichs durch die britische Regierung unterstrich nur deren Kriegslust. Die Ansicht, dass Deutschland einen Verteidigungskrieg führte, war keine bloße Ausgeburt der NS-Propaganda, sondern auch bei vielen zu finden, die den Nationalsozialisten kritisch gegenüberstanden. Bei allen Deutschen war die Wahrnehmung des Zweiten Weltkriegs durch den Ersten Weltkrieg geprägt, ganz gleich ob sie ihn miterlebt hatten oder nicht. Zumindest blieb ihnen dank des in letzter Minute geschlossenen Nichtangriffspakts mit der Sowjetunion anfangs der Albtraum eines Zweifrontenkriegs erspart, in den sie 1914 hineingeraten waren. Aber Weihnachten 1941 befand sich Deutschland erneut – wie 1917 – mit Großbritannien, Russland und Amerika im Krieg.
Der Kult um die »Frontgeneration« und die Erster-Weltkriegs-Literatur – ob darin der Krieg nun wie in Erich Maria Remarques Roman »Im Westen nichts Neues« kritisch geschildert oder wie in Ernst Jüngers »In Stahlgewittern« gefeiert wurde – hatte die Soldaten von 1914 bis 1918 mit einer Aura der Einzigartigkeit umgeben. Vor allem aber hatte der Krieg eine Kluft zwischen dieser Generation und der ihrer Väter geschaffen, die nur Frieden gekannt hatte. Unabhängig davon, ob es sich beim Ersten Weltkrieg tatsächlich um einen Vater-Sohn-Konflikt handelte, wurde er letztlich als solcher wahrgenommen. Das galt für den Zweiten Weltkrieg nicht. Vielmehr förderte der Eindruck, in einem Teufelskreis ständiger Kriege um dieselben Streitpunkte gefangen zu sein, eine brüderliche »Kameradschaft« über die Generationen hinweg. Sobald Helmut Paulus 1941 an die Ostfront geschickt wurde, ging sein Vater, ein Arzt und Reserveoffizier des vorigen Krieges, dazu über, ihn in seinen Briefen als »Kamerad« anzusprechen. Als Helmuts Einheit durch Rumänien und die Südukraine vorrückte und durch Gegenden zog, die deutsche Truppen auch im vorigen Krieg besetzt hatten, trieben seine Eltern in Pforzheim umgehend Nachbarn und Bekannte auf, die das Gelände beschreiben oder auf alten Landkarten aus dem Krieg nachvollziehen konnten, wo ihre Söhne wohl gerade kämpften. Männer, die stolz darauf waren, ihre »Feuertaufe« im Schützengraben bestanden zu haben, verglichen den Artilleriebeschuss mit dem in der zehnmonatigen Schlacht von Verdun 1916 und sahen in seiner legendären Zerstörungskraft die größte Bewährungsprobe. Auch deutsche Kommandeure orientierten sich in ihren Befürchtungen am vorigen Krieg und waren bei ihrem Vormarsch auf Moskau im November 1941 ständig von der Sorge geplagt, dass sich das Blatt plötzlich und unerwartet wenden könnte, wie sie es 27 Jahre zuvor an der Marne in Reichweite von Paris erlebt hatten.
Was Väter und Söhne verband, war mehr als die gemeinsame Erfahrung: Es war ein generationenübergreifendes Verantwortungsgefühl. Die Söhne mussten erreichen, was den Vätern nicht gelungen war. Sie mussten den Teufelskreis durchbrechen, der jede Generation dazu verdammte, erneut in Russland zu kämpfen. Im Gegensatz zum linearen Fortschrittsdenken Linker und Liberaler fassten viele Konservative Geschichte als zyklisch auf wie den Kreislauf des Lebens. Die düsteren Prognosen vom Niedergang der abendländischen Kultur – wie Oswald Spengler sie in »Der Untergang des Abendlandes« skizziert hatte – waren zwar mit der »nationalen Wiedergeburt« 1933 verschwunden, aber die zyklischen Naturmetaphern waren geblieben. Der deutsche Krieg in der Sowjetunion machte aus Metaphern Realität und aus der abstrakten Gefahr zerstörerischer Wiederholung einen unmittelbaren Existenzkampf. Die ungeheure Brutalität der deutschen Kriegführung im Osten verstärkte nur noch das Gefühl, dass Deutschland diesen Kreislauf endlich durchbrechen musste – wenn es nicht die nächste Generation zu weiterem Blutvergießen verdammen wollte.
Diese Sorge hatte von Anfang an bestanden. Als Soldaten im Herbst 1939 auf den Beginn der Kämpfe im Westen warteten, fanden manche: »Es ist ja auch besser, wenn jetzt reiner Tisch gemacht wird, dann brauchen wir hoffentlich keinen Krieg wieder mitzumachen.« Deutsche Schulkinder hatten zwar seit Generationen gelernt, Frankreich als »Erbfeind« zu sehen, aber tief im Inneren war Russland der Gegner, der zählte. Seit 1890 hatten selbst die oppositionellen Sozialdemokraten geschworen, sollte das zaristische Russland Deutschland je angreifen, würden sie das Land gegen die Barbaren aus dem Osten verteidigen. Im August 1914 hatte die russische Invasion in Ostpreußen in der deutschen Presse eine Welle stark übertriebener Schauergeschichten ausgelöst, und der kaum bekannte preußische General Hindenburg, der die Russen bei Tannenberg besiegte, stieg dauerhaft zum Nationalhelden auf. So fiel es 1941 nicht schwer, die Bevölkerung zu überzeugen, dass der neue Krieg in Russland zu Ende geführt werden musste, um der nächsten Generation einen weiteren Kampf zu ersparen. In Familien verbanden alle – von Erster-Weltkriegs-Veteranen der Ostfront über junge Rekruten, die frisch aus der Schule kamen, bis hin zu Jugendlichen, die noch zu Hause wohnten – den Krieg nicht mit dem NS-Regime, sondern mit ihrer eigenen generationenübergreifenden Verantwortung für ihre Familie. Sie lieferte die stärkste Grundlage für ihren Patriotismus.[25]
Eine so umfassende, rückhaltlose Einsatzbereitschaft war nur vorstellbar, weil sie nie unbegrenzt und uneingeschränkt war. Sie galt für absehbare Zeit, wie ein Soldat seiner Frau im Februar 1940 versicherte: »Im nächsten Jahr werden wir alles nachholen, ja?« Zwei Jahre später versprach ein anderer, »später werden wir alles nachholen, was wir jetzt entbehren«. Ihre Träume von einem Leben nach dem Krieg bildeten den Fokus ihrer Hoffnungen, ihre persönliche Version, was Sieg – oder zunehmend schlicht das Vermeiden der Niederlage – für sie bedeutete. So berechtigt und notwendig der Krieg auch sein mochte, war er doch verlorene Zeit; das, was zählte, würde erst hinterher beginnen. Ein Mann sprach vielen aus dem Herzen, als er seiner Frau versprach: »Dann fängt unser Leben erst an.«[26]
Für jeden Einzelnen zog sich der Krieg unsagbar in die Länge. Die großen Ereignisse berührten zwar jede Familie, aber in den Millionen Privatbriefen, die die Feldpost täglich beförderte, zeichneten die Verfasser nach, wie sie auf ihre eigene Art mit den überbordenden Anforderungen des Krieges fertigwurden und wie beide Seiten, die Männer an der Front und die Frauen in der Heimat, sich nach und nach unbewusst anpassen mussten. In ihrem Bedürfnis, einander zu beruhigen, kaschierten viele Paare, wie schwierig ihre Beziehung sich zunehmend gestaltete, und erst als sie nach dem Krieg wieder zusammenkamen, zeigte sich, wie sehr sie sich verändert hatten. In den ersten Nachkriegsjahren stieg die Scheidungsrate sprunghaft an.
Von diesem langen Krieg handelt dieses Buch. Es verfolgt die Umwälzungen in der deutschen Gesellschaft und die subtilen, aber häufig unumkehrbaren Veränderungen, mit denen die Deutschen sich auf einen Krieg einstellten, der sich nach ihrem eigenen Empfinden zunehmend ihrer Kontrolle entzog. Es zeichnet nach, wie sich das Leben und die Erwartungen des Einzelnen, bedingt durch die unvorstellbaren Kriegsereignisse, in einem ständigen Hin und Her zwischen Hoffen und Bangen veränderten. Das Erleben einzelner Menschen liefert somit einen Maßstab für die Gefühlslage und den moralischen Zustand einer Gesellschaft auf dem Weg in die Selbstzerstörung.
Teil IDie Rechtfertigung des Angriffs
Kapitel 1Unwillkommener Krieg
»Zu warten brauchst Du nicht auf mich. Es gibt keinerlei Urlaub mehr«, schrieb der junge Soldat hastig an seine Freundin. »Ich muß sofort in die Kaserne zurück, Fahrzeuge beladen. Es ist Mob.-Alarm.« Ihm blieb gerade noch Zeit, seine persönlichen Sachen bei Irenes Tante in der Liebigstraße abzugeben. Allerdings war Wochenende, und die junge Gärtnerin war schon zu ihren Eltern gefahren. Da er sich nicht von ihr verabschieden konnte, schrieb er die Adresse auf den Umschlag: »An Fräulein Irene Reitz, Lauterbach, Bahnhofstraße 105«. Als junger Unteroffizier, der seit zwei Jahren Berufssoldat der Wehrmacht war, gehörte Ernst Guicking zu den Ersten, die mit dem 163. Infanterieregiment in Eschwege mobilisiert wurden.[1]
Am folgenden Tag, dem 26. August 1939, machte Deutschland offiziell mobil. Wilm Hosenfeld, Dorflehrer in Thalau, meldete sich in Fulda – der nächsten Kreisstadt – im Institut der Englischen Fräulein, einem Mädchengymnasium, das an diesem Tag wie viele Schulen in Deutschland zu einer militärischen Sammelstelle wurde. Hosenfeld erhielt seinen Dienstgrad aus dem Ersten Weltkrieg zurück: Feldwebel. Viele der Männer in seiner Infanteriereservekompanie waren ebenfalls Erster-Weltkriegs-Veteranen, und als er Waffen und Ausrüstung an sie ausgab, fand er die »Stimmung ernst, aber entschlossen. Wir sind der Auffassung, daß es nicht zum Krieg kommt.«[2]
In Flensburg fuhr ein junger Feuerwehrmann mit der Straßenbahn zur Junkerhohlwegkaserne, wo er zum »Geräte-Unteroffizier« ernannt wurde und ein Fahrrad bekam. Noch am selben Abend um 23 Uhr setzte sich das 26. Infanterieregiment Richtung Bahnhof in Marsch. Trotz der späten Stunde waren die Flensburger Straßen voller Menschen, die gekommen waren, um das Regiment zu verabschieden. Gerhard M. von der 12. Kompanie hatte keine Ahnung, wohin es gehen sollte. Er suchte sich in einem Viehwaggon ein Plätzchen »unter einer Bank und schlief den Schlaf des Gerechten«.[3]





























