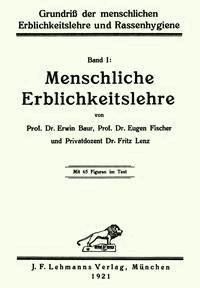0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Ähnliche
Einige Druckfehler sind korrigiert und mit Popups notiert. Rechtschreibungsformen wie »stehen« : »stehn« sind ungeändert. Ae, Oe, Ue wurden durch Ä, Ö, Ü ersetzt.
Memoiren Bibliothek
IV. Serie
Erster Band
Der Deutsche Lausbub in Amerika
1-ter Teil von
Erwin Rosen
Der Deutsche Lausbub in Amerika
Erinnerungen und Eindrücke von Erwin Rosen
Erster Teil
Achtundvierzigste Auflage
Verlag - Robert Lutz - Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
Druck von A. Bonz' Erben in Stuttgart.
Copyright 1911
by Robert Lutz, Stuttgart.
Inhalt.
Seite
Vom Beginn des Beginnens.
Der Lausbub und die Kuchen. – Beim Ochsenwirt in Freising. – Gymnasialzeiten. – Das erste Malheur. – Die Attacke auf den Glaspalast im Seminar. – Bei Glockengießermeisters. – Erste Liebe und zweites Malheur. – Die Familiengeduld reißt.
5
Im Zwischendeck der Lahn.
Im Bremer Ratskeller. – »So schmiede dir denn selbst dein Glück!« – An Bord. – Der Steward, der Zahlmeister und das Nebengeschäftchen. – Vom Itzig Silberberg aus Wodcziliska. – Atra cura … – Das Mädel mit den hungrigen Augen. – Die beiden Däninnen. – Im New Yorker Hafen.
9
Ein Tag in New York.
Wie ich mir einen Revolver kaufte. – Der policeman und der Stiefelputzer. – Wie man eingeseift und barbiert wird. – Im Geschwindigkeits-Restaurant. – Die Bowery. – Hallelujamädchen. – Im Park.
35
Das Pokerschiff.
Zwischen New York und Texas. – Vom amerikanischen Nationallaster. – »Fine game, dieses Poker!« – Die Weisheit des Bluffens. – Key West und Johnny Young aus San Antonio. – Eine bissige Bemerkung über Millionäre. – Im Salon! – Good bye, Miss Daisy … – Dies ist Texas, mein Sohn!
49
Mein letzter Dollar.
Den Weg zur Arbeit finden – den Wegweiser … – Wär' ich nur ein Schuster! – Beim Herrn Kanzleichef im deutschen Konsulat. – Auf dem Telegraphenamt. – Das letzte Silberstück. – Der gute Samariter. – Nun fängt ein neues Leben an
69
Im Reich des Königs Baumwolle.
Das Städtchen aus Sand und Holz. – Im Texasladen. – Mr. Muchow Senior. – Der Kampf mit dem Schimmel. – Ein Sommer beim König Baumwolle. – In Deutschland wär' die Farm ein Rittergut gewesen … – Baumwollpflücken und Baumwollmühle. – Die Reklamereiter. – Nigger Slim. – Im deutschen Klub. – Wie aus dem Wald das Feld wurde. – Der Neger. – Die amerikanische Krankheit des Wandertriebs.
80
Da hinten in Texas.
Der Lausbub wird Apothekerlehrling. – Im Wunderland. – Grasgrüner Wissensdurst. – Die Negerin und das Liebespulver. – Ein Nachtklingel-Erlebnis. – Der Lausbub langweilt sich. – Das Gäßchen der winzigen Häuschen. – Klein-Daisy. – Die Dame, das Parfüm und die Folgen. – Ex-Apotheker. – Der frühere Leutnant aus dem heiligen Köln und sein Rat. – Der Mann mit den leuchtenden Augen. – Vorbereitungen zu einer geheimnisvollen Reise.
118
Wie die Wanderung begann.
An der Geleiseböschung. – Der erste Sprung auf einen fahrenden Zug. – Die Fahrt. – Im Märchenland aufregendes Erlebens. – Das Hotel zur Eisenbahn. – Von der Königin Nikotin und ihrem Göttergeschenk. – Billy der Wanderer! – Das Abenteurerblut regt sich. – Ein psychischer Impuls. – Wanderer Nr. 3.
142
Unter den Romantikern des Schienenstrangs.
Von Texas nordwärts. – Ein wunderliches Leben. – Der betrogene Betrüger der guten Stadt Guthrie in Oklahoma. – Jargon des Schienenstrangs. – Ein abenteuerliches Jahr und seine Einflüsse. – Die Entwicklungsgeschichte seiner Majestät des Tramps. – Die amerikanische Vagabundenarmee. – Der Arbeitslose. – Der Tramp. – Die Romantiker. – Lebenssehnsucht und Wandertrieb. – Präsident Roosevelts Vagabundenfahrt auf der Lokomotive. – Geheimnisvolle Unterströmungen modernen Abenteurertums. – Amerikaner in exotischen Kriegen. – In der Sommerfrische von Lucky Water, Arizona. – Von flammenden Farben und meiner Frau im Mond. – Arbeiten!
158
Wie das Wandern endete.
Die Eisenbahn hat uns! – Sektion 423, Southern Pazific. – Als Streckenarbeiter in Arizona. – Der »boss«. – Von Kindern Italiens. – Wir haben wieder die Eisenbahn! – Hände in die Höhe! – Seine Ehren, der Friedensrichter. – Die braven Spitzbuben von El Dorado. – Dahinjagen und Arbeit. – Von den Schüttelfrösten der Malaria. – Krank und einsam. – Nach St. Louis. – Ein ganzer Mann.
192
Die Armen und Elenden von St. Louis.
Bei den guten Samaritern. – Allein in der Riesenstadt. – Am Ufer des Mississippi. – Vom Grauen und von der Scham. – Eine Orgie der Häßlichkeit. – Der Menschenpferch. – Auf Arbeitssuche. – Im Reich der kupfernen Töpfe. – Die Miniaturhölle des Palasthotels. – Das Glöckchen der Neugierigen.
209
Im Zeichen der Zeitung.
Witwe Dougherty. – Das Reich der Bücher. – Kipling-Begeisterung. – Ein Wegweiser des Kismet. – Mein erstes literarisches Verbrechen. – Der Beinbruch als Glückszufall. – Ich werde Depeschenübersetzer bei einer großen deutschen Zeitung. – Enthusiasmus und Neugierde. – Aller Anfang ist leicht! – Ein journalistisches Mädchen für alles. – Amerikanisches Deutschtum. – Der Schwur gegen die Potentaten. – Vom Sehen und vom Lernen. – Wieder draußen in der kalten Welt. – Reisefieber!
231
Das Inselchen der Fische in San Franzisko-Bai.
Wohin Zukunftssorgen gehören. – Ein logisches Selbstgespräch. – Das Land der Sonne. – Blühende Obstwälder. – Ankunft in San Franzisko. – Mr. Frank Reddington, schwarzes Schaf und verlorener Sohn. – Die Geschichte vom strengen Gouverneur. – Der tragikomische Hundeschwanz. – Wie der Millionärssohn energisch wurde. – Der Gott der Arbeit pfeift. – Bei den Kabeljaus. – Eine Stockfischfabrik. – Wer zuletzt lacht, lacht am besten!
257
Die Stadt des Goldenen Tors.
Das Erbe der Goldgräber. – Die lustige Königin des Westens. – Von vernünftigen schwarzen Schafen. – Die Stadt der Sieben Hügel übertrumpft! – Kletternde Straßenbahnen. – Im Park des Goldenen Tors. – Der dunkle Flecken der Sonnenstadt. – Im Chinesenviertel. – Die Straße der lebenden Schaufenster. – Wie der Lausbub zum Professor wurde. – Von Deutsch lernenden Lehrerinnen. – Die amerikanische Frau. – Kluge Mädchenerziehung und törichte Weiberherrschaft. – Die Amerikanerin in Kunst und Leben. – Die Sehnsucht nach der Zeitung.
274
Der Lausbub findet die Lebenslinie.
Von neuem Stolz. – Der Lausbub will amerikanischer Journalist werden. – Auf der Redaktion. – Jüngster Reporter. – Hallelujah! – Das erste Interview. – Die Lebenslinie.
293
Der Deutsche Lausbub in Amerika
Das Amerika der Leichtsinnigen.
Wenn Bruder Leichtfuß gar zu arg gehaust hat, und geplagte Familiengeduld reißt, so verfällt man in deutschen Landen häufig auf den bewunderungswürdig energischen und einfachen Ausweg: das schwarze Schaf der Familie nach Amerika zu schicken; nach den Vereinigten Staaten, in denen es so schöne Gelegenheiten zu segensreicher Arbeit gibt, und die so hübsch weit weg sind, daß eine respektable Entfernung die arme Familie schützt. Jeder Hapagdampfer, jedes Lloydzwischendeck trägt alljährlich Hunderte dieser Art von Menschenkindern über das große Wasser, deren Sündenregister von fast monotoner Gleichförmigkeit ist: Leichtsinnsstreiche und Schulden!
Das schwarze Schaf ist im Yankeeland. Und nun fängt der Humor an; ein grimmiger Humor voll grotesken Lachens und bitteren Weinens; eine moralische Komödie mit den schönsten tragischen Möglichkeiten. Das neue Land nimmt Bruder Leichtfuß – den verdorbenen Gymnasiasten, den leichtsinnigen Studenten, den verschuldeten jungen Leutnant oder was er sonst gewesen sein mag – liebevoll in seine Arme, verschluckt mit unbeschreiblicher Schnelligkeit die goldenen Pfennige der Heimat und spielt dann Fangball mit ihm. Hop – auf und nieder. Hop – arbeiten oder hungern. Hop – ihm die Nase auf den Boden gedrückt, wie man's mit einem Kätzchen macht. Hop – ihn zu Boden geworfen, daß alle Knochen krachen. Hop, hop, hop – ihn geschüttelt und zerzaust und geschunden! Da schnappt Bruder Leichtfuß nach Luft, ist furchtbar verwundert, fühlt sich merkwürdig elend und erkennt langsam aber sicher die primitiven Wahrheiten des Lebens von Geld und Hunger und Arbeit und Liebe, – wenn er nicht schon längst vorher elend zugrunde ging.
Manchmal aber ist unter diesem Amerikaheer von deutschen Leichtsinnigen der richtige leichtsinnige Strick mit einem Stückchen Poesie im Leib, der nach dem ersten Luftschnappen sich jubelnd in den Lebensstrom da drüben stürzt, glückselig, in seinem Element, sehnsüchtig nach Abenteuern über alle Maßen. Wundervoll frei fühlt er sich; allen Zwangs entledigt. Eine Welt des Sehens und Erlebens liegt vor ihm, und Hunger und Not erscheinen nur winzige Dinge in der immer neuen Begeisterung, die jeder neue Tag bringt. Frei wie ein Vogel in der Luft ist Bruder Leichtfuß und jedem Impuls darf er folgen in köstlicher Naivität. Er tastet – er sucht – er trinkt in vollen Zügen die groteske Romantik des ungeheuren Landes ein, das mit aller drastischen Wirklichkeit so starke Reize abenteuerlicher Poesie vereint …
So ist es mir ergangen. Um des brausenden Lebens willen ist dieses Buch meiner amerikanischen Wanderjahre geschrieben, in lächelndem Erinnern an jagende Jugend. Ein Buch des Leichtsinns.
Aber wenn ich heute auf die drei Jahre von 1894-1897 zurückblicke, die dieser erste Teil meiner Erinnerungen aus der Amerikazeit schildert, so will es mir scheinen, als sei der Leichtsinn gar ehrlich erkauft gewesen! In ehrlicher Münze zahlte der Lausbub mit Hunger und Elend und harter Arbeit für seinen jungfrischen Optimismus, denn grimmiger Lebenshumor will es, daß sich mit zügellosem Leichtsinn starke Kraft paaren muß, soll Freund Optimist im Leben bestehen. Und in dieser Kraft stecken Möglichkeiten.
Den starken Leichtsinnigen sei dieses Buch des Leichtsinns gewidmet.
Bruder Leichtfuß im Yankeeland, der du erst in Jahren verstehen wirst, weshalb dich das tätige Leben so hin und her schüttelt, sei gegrüßt! Seist du im Osten oder im Westen, im Wolkenkratzer oder auf der Prärie, sei gegrüßt von einem, der das erlebte, was du erlebst, und der mit dir weinen und mit dir lachen kann. Fast möchte ich in lächelnder Wehmut dich beneiden, Bruder Leichtfuß, denn mein Märchen der Jugend ist ausgeträumt.
Hamburg, im Sommer 1911.
Erwin Rosen. (Erwin Carlé).
Vom Beginn des Beginnens.
Der Lausbub und die Kuchen. – Beim Ochsenwirt in Freising. – Gymnasialzeiten. – Das erste Malheur. – Die Attacke auf den Glaspalast im Seminar. – Bei Glockengießermeisters. – Erste Liebe und zweites Malheur. – Die Familiengeduld reißt.
Das Übereinstimmen der beteiligten Kreise war erstaunlich.
»Oin Lausbube!« sagten die Professoren in München.
»A solchener Lausbub …« erklärte der Pedell.
»Dieser lie–ii–derliche Bursche!« stöhnte der Ordinarius dreimal täglich.
»Ja – der Lausbub!« nickten die Tanten und die Verwandten.
»Ein furchtbarer Strick bist du gewesen!« pflegt meine Mutter zu sagen. »Gräßliche Geschichten hast du gemacht!« Dann lacht sie und fragt regelmäßig, ob ich mich denn auch an Frau Schrettle erinnere und an die Kuchen …
Ich war zwölf Jahre alt. Quartaner. Lateinschüler der Klasse 3a des Königlich Bayrischen Maxgymnasiums in München. Meine Würde als Lateinschüler schützte mich aber keineswegs davor, gelegentlich zu der Frau Kolonialwarenhändlerin Schrettle an der Ecke geschickt zu werden, um irgend etwas für den Haushalt zu holen.
»An Empfehlung an d' Frau Mama!« sagte jedesmal die dicke Frau Schrettle, während ich ebenso regelmäßig vornehm nickte und dabei kein Auge von den Kuchen auf dem Ladentisch verwandte. Von Frau Schrettles berühmten Kuchen. Sie waren aus Blätterteig; sie waren mit Himbeeren belegt; sie waren Wunderwerke – und sie führten den Lateinschüler so lange in Versuchung, bis er eines Nachmittags vor Klassenanfang Hals über Kopf in den Laden stürzte.
»Einen Himbeerkuchen soll ich holen!«
»Bitt' sehr! A schöne Empfehlung!« dienerte Frau Schrettle und schrieb der Mama einen Himbeerkuchen an.
Der Raub war gelungen, und der Lausbub wiederholte die Operation einen ganzen Monat lang fast jeden Tag! Verzehrt wurden die Kuchen auf dem Schulweg, in ehrlicher Teilung mit den Spezerln und Freunderln aus der Quarta. Bis an einem Novembersonntag die Katastrophe kam – Frau Schrettle mit ihrer Rechnung. Mir fiel das Herz in die Hosen, als meine Mutter fragend sagte:
»Himbeerkuchen?«
»Guat sans, nöt?« meinte Frau Schrettle stolz.
»Aber wir haben ja gar keine Himbeerkuchen gehabt!« rief meine Mutter entrüstet.
Nun war die Reihe zum Erschrecken an Frau Schrettle.
»Der Herr Sohn hat's g'holt!« stotterte sie. »Jeden Tag!«
Kladderadatsch. Frau Schrettle erhielt ihr Geld und ich vorläufig eine Ohrfeige mit der Aussicht auf mehr, wenn der Vater nach Hause kam. Meine Mutter weinte und ich weinte und meine Mutter sagte, es sei ja fürchterlich, und ich fand, es sei noch viel fürchterlicher! Zehn Minuten später schlich ich mich heulend aus dem Haus und rannte in dichtem Schneegestöber durch die Straßen, durch den englischen Garten, der Isar zu. Bei der Bogenhausener Brücke begann die einsame Landstraße. Es war bitter kalt. Die Schneeflocken peitschten mir ins Gesicht, und ich kleiner Kerl mußte mich tüchtig gegen den scharfen Wind anstemmen. »Ich geh' nicht nach Hause!« murmelte ich immer wieder vor mich hin. »Nach Hause geh' ich ganz gewiß nicht …«
Spät abends stolperte ein halb verhungerter und halb erfrorener Lateinschüler in die Gaststube des Roten Ochsen im Städtchen Freising.
»Da schaugt's her,« rief der Ochsenwirt. »Ja was wär' denn dös! Was willst denn du nacha im Wirtshaus?«
»Was zum essen möcht' i'.«
»Wo kimmst denn her?«
»Von München. A – an Ausflug hab' ich g'macht,« log ich, beinahe weinend.
»Woas?« schrie der Wirt. »Den Sauweg von Minken bist herg'loffen in dem Sauwetter? Lüag du und der Teifi. Dös wär' a sauberer Ausflug. Wia heißt' denn und wo wohnst'?«
Wie ein Häuflein Elend stand ich schlotternd da, gab dem Riesen vor mir Auskunft und sah mit Zittern und Bangen, wie er zu dem großen Gasttisch in der Ecke schritt, wie er mit den Gästen zischelte, wie er mit Frau Wirtin tuschelte, wie der Hausknecht gerufen und mit einem Zettel fortgeschickt wurde.
»Hock di' hin an Tisch,« brummte der Wirt. »D' Frau bringt dir was zum essen.«
Ich entsinne mich noch dunkel, daß ich gierig alles verschlang, was mir vorgesetzt wurde, daß Frau Wirtin mich in die Wohnstube führte und auf ein Sofa bettete. Und daß eben auf einmal mein Vater da war und ich mich furchtbar vor ihm schämte und eine fürchterliche Angst vor ihm hatte. Aber was der Ochsenwirt von Freising zu meinem Vater beim Abschied sagte, das weiß ich noch ganz genau.
»Is nix zu danken, Herr,« sagte er. »Den 12 Uhr Zug nach Minken werd'n S' grad no' derwischen. Ja, dö Buam! Früchteln san' halt Früchteln. Is eh nix dabei. Aber an Hintern tät i' eahm halt do' vollhau'n!«
Was am nächsten Tag ausgiebigst geschah!
Der Lausbub wurde älter, stieg mit Ach und Krach von Klasse zu Klasse, und blieb ein Lausbub … »Ein leichtsinniger Schüler,« hieß es in den Zeugnissen. »Seine Leistungen stehen in bedauerlichem Mißverhältnis zu seinen Fähigkeiten; sein Betragen ist nichts weniger als zufriedenstellend«. Ich muß bei meinen Lehrern in einem erbärmlich schlechten Ruf gestanden haben. Die Abneigung beruhte jedoch auf Gegenseitigkeit. Heute noch ist mir das Gedenken an meine Gymnasialzeit das Gedenken an eine harte Zuchtanstalt, an gedankenloses Eintrichtern von Lehrbüchern, an schablonenmäßiges Auswendiglernen, an mangelnde Liebe und mangelndes Verständnis, an bakelschwingende Schulmeisterei, an groben Unteroffizierston, an fast komisches Nichtverstehen. Ich erinnere mich an ein beständig schnupfendes Ungeheuer von einem Professor mit rotem Taschentuch und fettigem Rockkragen, der über ein ut mit dem Indikativ in viertelstündige Raserei zu verfallen pflegte; ich erinnere mich an donnernde Philippiken, wie unsittlich es sei, daß ein so fauler Bursche wie ich sich ohne Arbeit nur durch sein bißchen Talent das Aufsteigen in die nächsthöhere Klasse erschwindele; ich erinnere mich an einen Ordinarius der Untersekunda, der mich mit dem geschmackvollen und gut deutschen Ausdruck "Frechjö" belegte, weil ich, nachdem er mir die Erlaubnis, das Schulzimmer zu verlassen, verweigert hatte, ihn aus einem höchst natürlichen und dringenden Grund ein zweitesmal darum bat. Aber ich kann mich nicht entsinnen, daß jemals mich ein Lehrer beiseite nahm und in Güte mit mir sprach, um herauszubekommen, was in meinem Hirn vorging; weshalb der dumme Junge so dumme Streiche machte – und ein Lausbub war.
»Düsser Bursche!« sagte der Herr Rektor wutschnaubend, als ich ihm vorgeführt wurde. »Düsser unver–bösserliche Lümmel! Das Maß üst voll. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er brücht!«
Der Schulgewaltige hatte recht. Ich war ein infamer Bengel. Von meiner Unverbesserlichkeit zeugte eine lange Reihe von Karzerstrafen, wegen Rauchens auf der Straße, wegen Nichtablieferung von Schularbeiten, wegen Betroffenwerden in dem Hinterzimmer einer Gastwirtschaft. Außerdem hatte mich das Lehrerkollegium schon längst im Verdacht, der berüchtigten Schülerverbindung des Maxgymnasiums anzugehören, die in versteckten Vorstadtkneipen studentische Gebräuche nachäffte. Trotz aller Anstrengungen des Pedells gelang es nie, die Sünder in flagranti zu erwischen. Stellten wir doch stets den jüngsten "Fuchs" als Wache auf die Straße, und wenn der Pedell oder ein Professor sich blicken ließen, wurden wir prompt gewarnt, kletterten aus Hinterfenstern, flüchteten über Höfe, stiegen über Mauern. Aber man wußte im Maxgymnasium doch so von ungefähr, welche Schüler die Schuldigen waren, und sah den verdächtigen Subjekten scharf auf die Finger. Ich jedenfalls galt als besonders verdächtig!
Nun war das Krüglein meiner Sünden übergelaufen:
Ich schwänzte drei Tage die Schule! Fürst Bismarck war nach München gekommen und in Lenbachs Villa abgestiegen. Dorthin lief ich schleunigst nach dem Mittagessen, ließ Nachmittagsunterricht eben Nachmittagsunterricht sein und stand bis zum späten Abend auf der Straße, aus Leibeskräften hurraschreiend. Weil die Freiheit gar so schön war und der junge Sommer gar so sonnig, ging ich am nächsten Tag auch nicht ins Gymnasium, und am dritten Tag erst recht nicht, sondern trieb mich in den Isarauen herum und schwelgte in unzähligen Zigaretten und machte erschrecklich schlechte Gedichte.
»Ein Schüler der 6. Klasse schwänzt! Das üst noch nücht vorgekommen!« donnerte der Rektor. »Was haben Sü zu sagen?«
Stotternd versuchte ich zu erklären, daß ich es gar nicht so böse gemeint hätte, daß –
»Oine gemeine Lüge! Gekneipt haben Sü!«
»Das ist nicht wahr. Das verbitt' ich mir,« brauste ich auf.
»Halten Sü das lose Maul! Sü sind ein Verlorener. Sü sind eine Gefahr für die tugendhaften Schüler. Der Lehrerrat wird das weitere über Sü beschließen.«
Binnen vierundzwanzig Stunden wurde ich aus dem Tempel des Humanismus hinausgeworfen, dimittiert, und damit nicht nur vom Maxgymnasium, sondern auch von jeder anderen höheren Lehranstalt in München ausgeschlossen. Meine Reue war tief und ehrlich.
Das Königliche Seminar in Burghausen, einem kleinen bayrischen Gymnasialstädtchen an der österreichischen Grenze, nahm den Entgleisten auf. Das Seminar war ein Internat, eine Art Besserungsanstalt. Die Zöglinge wurden morgens ins Gymnasium geführt und mittags wieder abgeholt; nachmittags wieder hingeführt und abends wieder abgeholt. In der Zwischenzeit aß man an langen Tischen im Speisesaal, arbeitete in den Studiersälen, schlief des Nachts in gemeinsamen Schlafsälen – jede Minute unter Aufsicht, unter strengster Zucht. Sechs Monate lang ging alles gut, und meine Zeugnisse schnellten zu verblüffender Güte empor. Dann fing's wieder an.
Die Aufsicht in unserem Studiersaal führte ein Präfekt, den wir alle aus tiefstem Herzensgrund haßten. Das kleine Männchen im bis an den Hals zugeknöpften Priesterrock pflegte auf leisen Sohlen hinter unsere Bänke zu schleichen und uns über die Schultern zu gucken. Wir Obersekundaner empfanden sein Spionieren, wie wir es nannten, als eine ungeheuerliche Beleidigung. Er war ein gestrenger Herr, der über nichts viele Worte verlor, sondern bei Verstößen gegen das Hausregiment einfach in knappen, kurz hervorgesprudelten Sätzen Strafarbeiten auferlegte. Strafarbeiten erster Güte. Mit dem Auswendiglernen von hundert Versen der Odyssee begann erst sein Repertoire. Auf den Spaziergängen verbot er uns das laute Sprechen; nachts wandelte er stundenlang im Schlafsaal auf und ab. Wir hatten natürlich keine Ahnung, daß diese nächtliche Vigil einen ganz bestimmten Zweck hatte, und nicht das geringste Verständnis dafür, daß er nur seine Pflicht tat! Wir sahen in ihm nur die Verkörperung einer erbarmungslosen Autorität, die uns stets auf dem Nacken saß. Und haßten ihn.
Nun war es Sitte im Seminar, daß einmal im Monat die höheren Klassen unter Führung ihrer Präfekten einen Ausflug machten, bei dem in irgend einem Dorfwirtshaus Bier getrunken und geraucht werden durfte; eine Vergünstigung, die als Sicherheitsventil wirken sollte. Diesmal teilte uns der Leiter des Seminars mit, daß auf Vorschlag unseres Präfekten der Ausflug in diesem Monat unterbliebe. Wir seien einer solchen Vergünstigung nicht würdig. Wir sollten gefälligst fleißiger sein und uns nicht so viele Hausstrafen zuziehen!
Unsere Wut kannte keine Grenzen.
»Der Schleicher!«
»Der Spion!«
»A solchene Gemeinheit!«
Prompt wurde eine Verschwörung organisiert. Auf dem nachmittäglichen Spaziergang stopften wir unsere Taschen voll kleiner Steinchen. Und abends, als alles ruhig geworden war im Schlafsaal und wir alle in den Betten lagen, klirrte mit scharfem Klang ein Steinchen gegen das Glashaus des Präfekten. Glashaus? Jawohl! Der Gegenstand unseres Hasses schlief in einem winzigen deckenlosen Gemach, dessen Wände aus Rahmenwerk mit Glasfenstern bestanden; in einem richtigen Glashäuschen. Die Wände verhüllten Vorhänge, durch die er uns aber beobachten konnte. Was ja auch der Zweck des Glasgemachs war. Wir Münchener nannten es den Glaspalast.
Ein zweites Steinchen prallte gegen den Glaspalast; ein drittes, ein viertes. Der Präfekt, völlig angekleidet, kam hervorgeschossen.
»Ruhe!«
Dann verschwand er wieder. Und im nächsten Augenblick knatterte es wie Gewehrfeuer gegen seine Wände. Diesmal kam er sofort und rief mit vor Entrüstung bebender Stimme:
»Lausbuben!«
»Unverschämt!« schrie eine Stimme aus einem Winkel des Schlafsaals. (Das war ich!)
»Lassen Sie die Kinderei!« befahl der Präfekt ruhiger werdend. »Bestrafen werde ich Sie morgen.«
Aber wir waren viel zu aufgeregt, um Vernunft anzunehmen. Ohn' Unterlaß klatschte der Hagelsturm von Kieselsteinen gegen die Glaswände. Der Präfekt rannte zwischen den Bettreihen auf und ab und stürmte und wütete. Unterdessen sorgten die Bettreihen, denen er jeweilig den Rücken zukehrte, für Aufrechthaltung des Bombardements. Es war eine Orgie. Schließlich lief er davon und holte den Rektor. Denn der Leiter des Seminars war gleichzeitig Rektor des Gymnasiums – ein Grobian, den wir liebten.
»Wenn während des Restes der Nacht nicht völlige Ruhe in diesem Schlafsaal herrscht,« erklärte der Rektor trocken, »so werde ich höchstpersönlich erscheinen und Sie alle körperlich züchtigen. Ich werde an dem einen Ende der Bettreihe anfangen. Und so weiter. Ad infinitum. Wenn Sekundaner sich wie Volksschüler betragen, so muß man sie prügeln wie Volksschüler. Dies ist Logik. Guten Abend!«
Ich unverbesserlicher Sünder aber lachte die halbe Nacht hindurch, indem ich mir vorstellte, wie grandios doch diese Prügelszene gewesen wäre!
Am nächsten Morgen kam alles ans Licht der Sonnen …
»Haben Sie geworfen?«
»Jawohl, Herr Rektor.«
»So? Soo? Soo–o? Weshalb haben Sie das getan?«
»Wegen des Ausflugs.«
»So–oh! Ich stehe in loco parentis und habe gute Lust, Sie zu ohrfeigen.«
Im nächsten Augenblick: Klatsch links, klatsch rechts.
»Sie sind wirklich unverbesserlich. Im Seminar kann ich Sie nach dieser Leistung nicht länger belassen. Aus dem Gymnasium werde ich Sie nicht entfernen, weil Sie wenigstens nicht gelogen haben. Aber ich warne Sie! Nur die geringste Kleinigkeit – und Sie fliegen!«
Am gleichen Nachmittag noch wurden in feierlicher Zeremonie ich und ein anderer Schüler für unwürdig des Seminars erklärt und vom Pedell ins Städtchen geführt. Mich brachte er zu einer Frau Glockengießermeister die mich in Kost und Verpflegung nahm.
Ich aber segnete den Präfekten und den Glaspalast und die Steinchen, denn nun war ich ein freier Bursch, ein Stadtschüler! Auf dem Stübchen bei Glockengießermeisters konnte man lange Pfeifen rauchen, soviel man nur wollte, und am Abend holte Glockengießermeisters Töchterlein gern eine Maß Bier. Das war wunderschön – goldene Freiheit. Fast ein Jahr lang ging alles gut, bis das Märchen kam; ein richtiges Märchen: Es war einmal eine Königin, die neigte sich zu einem Pagen, und ein groß' Gerede entstand im Königsschloß …
In wundernder Rührung gedenke ich jener Zeiten erster Liebe. Die Königin war eine junge Dame, vielumworben im Städtchen, älter als der Unterprimaner, der ein Mann zu sein glaubte, es aber durchaus nicht war. Ich weiß noch genau, wie ich mich geärgert hatte, als ein Brief meines Vaters mich zwang, zum Besuch in jener Familie "anzutreten"; mit welchem Widerstreben ich dann bei einer zufälligen Begegnung auf dem Eisplatz meine Schulverbeugung vor Mutter und Tochter machte und wohl oder übel die junge Dame zum Schlittschuhlaufen einladen mußte. Familiensimpelei nannte ich dergleichen damals. Doch es dauerte nicht lange, und der Unterprimaner wartete oft stundenlang in zitterndem Bangen auf dem Eisplatz, ob sie kommen würde – – und war glückselig, wenn sie kam. In schweigendem Glück zuerst. Und dann brach es wie ein Sturm über uns Menschlein herein. Aus dem Alltagssprechen wurden gestammelte Worte von tiefem Sinn, leises Geflüster, zaghaftes Gestehen, ein:
»Je vous aime!«
»I love you so …«
Die großen Worte, die ein so wunderbares Geheimnis zu bergen schienen und doch fast körperlich schmerzten im Gesprochenwerden, wären in deutscher Sprache nie über unsere Lippen gekommen. Das war das Glück; unvergeßliche Zeiten der Begeisterung, des Göttertums zweier junger Menschen, die ein jeder im andern die Vollkommenheit sahen, den heimlich geträumten Jugendtraum. Wir schwelgten in Goethe und Scheffel und Heine und schrieben einander lavendelfarbene Briefchen und jubelten laut in den Gängen der alten Herzogsburg droben auf dem Schloßberg. Wie glückselige Kinder.
Da fing das Städtchen zu reden an. Die Perückenzöpfe braver Bürger wackelten erschrecklich vor lauter entsetztem Kopfschütteln. Was mögen ehrsame Honoratioren und entrüstete Gymnasiallehrer alles gesagt und alles gedacht haben! Als ich zehn Jahre später wieder in das Städtchen kam, schlug Frau Glockengießermeisterin die Hände über dem Kopf zusammen und erzählte drei Stunden lang von den merkwürdigen Dingen, die damals das Städtchen geredet hatte, nicht mit Engelszungen. Die Königin aber von damals wohne weit drüben im Schwäbischen am Bodensee und sei eine stattliche junge Regimentskommandeuse geworden, die dem Herrn Oberst schon eine Schar von Kindern beschert habe –
Der Unterprimaner wurde schleunigst aus dem Gymnasium fortgejagt, unter dem ein wenig fadenscheinigen Vorwand, am offenen Fenster eine lange Pfeife geraucht und einen vorübergehenden Professor nicht gegrüßt zu haben. Ich hatte ihn nicht gesehen. Aber der Lehrerrat faßte es als Verhöhnung auf.
Der Rest ist eine häßliche Erinnerung. Durch die zweite Dimission war dem Entgleisten jedes Gymnasium in Bayern verschlossen, und übrig blieb nur eine Münchner Presse. Aber nun war Hopfen und Malz verloren; ich hatte die Empfindung, man hätte mir schweres Unrecht getan und wurde gleichgültiger denn je. Ich kneipte. Machte Schulden. Groteske Schulden.
Bis eines Tages langgeprüfte Familiengeduld riß und kurzerhand beschlossen wurde, den Unverbesserlichen drüben über dem großen Wasser für sich selbst sorgen zu lassen; ein Beschluß, der allzu energisch gewesen sein mag. Denn schließlich hatte der Lausbub weder gestohlen noch geraubt. Wenn ich mir aber den Lümmel von damals vorstelle, wie er alltäglich die schönsten Ermahnungen mit gelangweiltem Gesicht anhörte, um sich dann zu schütteln wie ein naßgewordener Hund und schleunigst eine neue Dummheit auszuhecken (die der Familie gewöhnlich ein Sündengeld kostete) – so verstehe ich alles! Glaube mir, oh Leser: Der Lausbub war ein infamer Lausbub!
Im Zwischendeck der Lahn.
Im Bremer Ratskeller. – »So schmiede dir denn selbst dein Glück!« – An Bord. – Der Steward, der Zahlmeister und das Nebengeschäftchen. – Vom Itzig Silberberg aus Wodcziliska. – Atra cura … – Das Mädel mit den hungrigen Augen. – Die beiden Däninnen. – Im New Yorker Hafen.
Den ganzen Tag waren wir in Bremen umhergerannt. Als wir bei der ärztlichen Untersuchung uns einer langen Reihe von Auswanderern anschließen und stundenlang warten mußten, sagte mein Vater auf einmal:
»Du solltest eigentlich doch die Überfahrt in der Kajüte machen und nicht im Zwischendeck!«
Aber sofort besann er sich. »Nein! Es bleibt dabei. Es ist besser, wenn du dich schon auf dem Schiff an neue Verhältnisse gewöhnst.«
Und dann kam der letzte Abend im deutschen Land.
Bis gegen Mitternacht saßen mein Vater und ich im Bremer Ratskeller, in einem stillen Winkel, verborgen zwischen bauchigen Apostelfässern. Edler Wein funkelte in den Gläsern. Von der großen Stube her klang Stimmengewirr, lustiges Lachen fröhlicher Menschen. Mir war erbärmlich zumute; ich starrte in den goldgelben Wein und kämpfte immer wieder mit Tränen und dachte an den Abschied von meiner Mutter und wagte es nicht, meinem Vater in das vergrämte Gesicht zu sehen.
Erst Jahre später habe ich das verstanden, was mir mein Vater an jenem Abend sagte. Er sprach wie ein Mann zum andern, wie ein Freund zum Freund; erklärte mir, daß es ihm bitter schwer würde, den einzigen Sohn in die Welt hinauszuschicken. Er wisse aber keinen andern Rat. Das Leben selbst mit all' seinen Härten müsse mich in die Kur nehmen …
»Geh' zugrunde, wenn du zu schwach fürs Leben bist!«
Und ich lächelte unter Tränen, denn meine Art von Stolz hatte ich trotz allen Gedrücktseins und trotz aller Reue. Das gefiel ihm.
»Du wirst nicht zugrunde gehen, glaube ich. So gefährlich auch das Experiment ist, für so richtig halte ich es. Du mußt auf deine eigenen Füße gestellt werden. Du mußt dich austoben! Auf der Universität würdest du nichts als neue Streiche machen, dich vielleicht ins Unglück stürzen; Soldat, wie du es werden möchtest, kann ich dich nicht werden lassen, denn zum armen Offizier eignet sich kein Mensch so schlecht wie du – ins kaufmännische Leben paßt du erst recht nicht. So schmiede dir denn selber dein Glück …«
Stundenlang sprach mein Vater mit mir. Meine Fahrkarte lautete nach Galveston in Texas. Mein Aufenthalt in New York würde nur wenige Stunden dauern; am nächsten Tag nach Ankunft der Lahn in New York sollte ich mit einem Dampfer der Mallorylinie nach Texas weiterfahren. Da draußen im jungen Land würde es mir weit leichter werden, mich durchzuschlagen, als in einer Riesenstadt mit ihren Tausenden von Arbeitslosen.
»Such' dir dein Brot! Halte den Kopf hoch, mein Junge; laß dir nichts schenken; gib Schlag um Schlag; hab' Respekt vor Frauen. Du wolltest ja immer Soldat werden – bist jetzt ein Glückssoldat.«
Und die Gläser klirrten zusammen.
Da bat ich schluchzend um Verzeihung – – – Nie in meinem Leben werde ich jenen Abend vergessen; denn als ich sieben Jahre später wiederkam, da hatten sie meinen Vater begraben.
Am nächsten Morgen fuhren wir nach Bremerhaven zum Lloyddock. Dort lag wie ein riesiges schwarzes Ungetüm der Schnelldampfer Lahn. Auf dem kleinen Häuschen am Dock, das irgend ein Bureau enthalten mochte, flatterte die deutsche Flagge. Am Kai drängten sich die Menschen, und an der Schiffsreeling standen in dichten Reihen Kajütenpassagiere, die Abschiedsgrüße zu ihren Freunden hinunterriefen und Taschentücher flattern ließen. Wir stiegen die Gangplanke hinan. Ein Zahlmeister des Norddeutschen Lloyd verlangte meine Zwischendeckkarte, und ein Polizist prüfte meinen Paß. Auf dem Vorderschiff war ein unbeschreiblicher Wirrwarr. Männer und Frauen und Kinder standen und saßen herum, zwischen Köfferchen und Säcken und Bündeln. Irgend jemand spielte auf einer Ziehharmonika, und ein Mädel sang dazu: »Et hat ja immer, immer jut jejange' – jut jejange' …« Die unbehilflichen Menschen, die sich gegenseitig im Wege standen, schnatterten und schimpften; die Ziehharmonika johlte einen Gassenhauer nach dem andern, bis die Walzerklänge der Schiffskapelle auf dem Promenadedeck sie übertönten. Mein Vater und ich standen an der Reeling zwischen einem russischen Juden in fettglänzendem Kaftan und einer Bauernfrau mit buntem Kopftuch. Ich schluchzte vor mich hin. Die Menschen und die Dinge schwammen mir vor den Augen; mir war, als müßte ich schreien in bitterer Reue. Mein Vater sagte ein über das andere Mal:
»Mein lieber Junge – mein lieber Junge!«
»Besucher von Bord!« riefen die Stewards. Die Glocke begann zu läuten.
Langsam setzte sich der Schiffskoloß in Bewegung. Und ich stand und starrte mit brennenden Augen nach dem Kai. Hochaufgerichtet stand mein Vater am äußersten Ende der Landungsbrücke, den Kopf in den Nacken geworfen, wie das seine Art war, und winkte mir zu. Einmal. Zweimal. Dann wandte er sich mit einem scharfen Ruck, und in wenigen Sekunden war er im Menschengewühl verschwunden – – –
Ein Steward klopfte mir auf die Schulter. »Haben Sie schon 'ne Koje?«
»Nein.«
»Na, hören Sie 'mal – dann ist's aber höchste Zeit. Machen Sie, daß Sie 'runterkommen. Die Treppe dort.«
Ich nahm meinen Handkoffer und stieg hinunter, in einen Riesenraum mit langen Reihen von Holzgestellen: nebeneinander und übereinander geschichteten Kojen. Viele Hunderte von Schlafplätzen waren es. Jedes Bett enthielt eine Strohmatraze, zwei hellbraune Wolldecken und ein Kopfkissen. Auf jedem Kopfkissen waren ein Blechbecher, ein zinnerner Teller, Messer, Gabel und Löffel hingelegt. Überall auf den Holzgestellen kletterten Männer herum, und da und dort stritt man sich um die Plätze. Ich muß recht hilflos dagestanden haben. Ein Steward sah mich prüfend an, dann ging er auf mich zu:
»Das wird Ihnen man nich' gefallen hier unten mit die Polacken un' die Jüden un' die ganze Gesellschaft – das is nix nich' für junge Herren, sag' ich. Kommen Sie mit.«
Natürlich ging ich mit. Mir war alles furchtbar gleichgültig. Durch endlose Gänge und über unzählige Treppen führte er mich ins Bureau des vierten Zahlmeisters.
»Können wir nich' 'ne Koje fixen für diesen jungen Herrn?« fragte mein Begleiter den Zahlmeister.
Jawohl, es ging. Gegen eine Entschädigung von zwanzig Reichsmark wollte der Herr Zahlmeister eine Koje für mich im Vorratsraum aufstellen lassen. Ja, sie stand merkwürdigerweise schon fix und fertig da, in einem Winkel, durch eine aufgespannte amerikanische Flagge schamhaft verhüllt.
»Das is schandbar billig,« flüsterte mir der Steward zu. »Da haben Sie Glück gehabt. Nu wollen wir aber einen trinken. So 'ne kleine Flasche Hamburger Kümmel kost' nur 'ne Mark fufzig. Haben Sie zufällig eine da, Herr Zahlmeister?«
Jawohl; es war eine da.
»Prost!« (Einundzwanzig Mark und fünfzig Pfennige wechselten ihre Besitzer). Da starrte mich der Steward auf einmal entsetzt an. »'n Strohhut? Nee, is' nich' möglich – 'n Strohhut! Mensch, haben Sie keine Mütze?«
Nein, ich hatte keine Mütze.
»Mensch! So 'n feiner Strohhut – der geht über Bord, sag' ich Ihnen. Bei dem Wind! Ich hab' zufällig 'ne Mütze. Kost 'n Taler! 'ne feine Mütze!«
Natürlich kaufte ich die Mütze.
Dann komplimentierte mich der Zahlmeister höflich aber energisch hinaus. Ich kennte ja jetzt meinen Schlafplatz. Von 7 Uhr morgens aber bis 9 Uhr abends hätte ich in seinem Bureau nichts zu suchen.
Auch das war mir sehr gleichgültig – wie alles und jedes an Bord der Lahn an jenem ersten Tag. Ich aß fast nichts, interessierte mich für nichts, lief stumpfsinnig an Deck auf und ab, stand stundenlang in einem einsamen Winkel an der Reeling, schlich mich früh am Abend in des Zahlmeisters Bureau, ging ins Bett und weinte unter der Decke wie ein kleiner Junge …
Fröhlicher Sonnenschein flutete durch die kleinen rundlichen Kajütenfenster, als ich am nächsten Morgen erwachte und schläfrig um mich blinzelte. Was war das für ein Tönen und Surren? Im ganzen Körper fühlte ich das Vibrieren des vorwärtspeitschenden Riesenschiffes – mir war, als läge ich in einer Schaukel, auf und ab schwingend; als würde ich der Decke zugeschleudert, bliebe dort einen Augenblick hängen und versänke dann in unendliche Tiefen. Ein Stückchen von mir selbst schien jedesmal zurückzubleiben; droben an der Decke und unten in der Tiefe. Einmal hatte ich das entsetzliche Gefühl, als hätte sich mein Magen von mir getrennt und schwebe irgendwo in der Kajüte. Ich sprang aus dem Bett, und sofort hörte das Rumoren in meinem Innern auf. Im Handumdrehen war ich angezogen, eilte an Deck und machte mich mit wahrem Heißhunger über Kaffee und Brötchen her, die aus einem großen Kessel und einem Ungetüm von Korb durch zwei Stewards verteilt wurden. Wenig Menschen waren an Deck. Ich trat an die Reeling. Da draußen war majestätische Ruhe. Wie die Unendlichkeit selbst sahen sie aus, die immerzu vorwärtsrollenden Wasserberge, in ihrer gewölbten Mitte tief schwarz und doch glänzend wie ein Spiegel grünblau aufsteigend, schaumig weiß an den Rändern. Dann überholte der eine Wasserberg den andern, zusammenstürzend, und eine neue Welle wurde aus ihnen geboren, zu kurzem Spiel. Nimmer aufhörende Bewegung und doch verkörperte Ruhe. Ich trank die salzige Luft ein, die einem die Augen aufleuchten ließ und das Blut schneller durch die Adern jagte. Und schaute in den Sonnenhimmel. Frisch und froh und leicht fühlte ich mich. »So schmiede dir denn selber dein Glück –« Vergangen war vergangen und feige wäre es, die Ohren hängen zu lassen. Hast du Schneid genug zu dummem Leichtsinn gehabt, so mußt du auch Schneid genug haben, nicht in nutzloser Reue zu flennen.
Ich wurde unternehmungslustig und stieg ins Zwischendeck hinab. Es war fürchterlich da unten. Armselige Häuflein menschlichen Elends lagen auf den Kojen herum, mit grüngelben Gesichtern, jammernd in den Qualen der Seekrankheit, zu energielos, um in frische Luft an Deck zu gehen. Eine Unterwelt des Stöhnens und der Gerüche. Und die Konsequenzen der Seekrankheit machten sich sehr bemerkbar, so daß ich allen Göttern für mein Schlafplätzchen im Vorratsraum dankte.
»Se belieben nix ssu sein seekrank?« fragte mich ein alter Jude, der knoblauchduftend auf einem Bündel neben seiner Koje saß.
»Nein.«
»Nu, das frait mich. Was ham Se genommen ein for de Magen?«
»Nichts. Ich blieb nur in der frischen Luft.«
»Püh, frische Luft. Wer' ich raufgehen ssu sitzen in der frischen Luft? Wer' ich nich'! Bin ich gegangen rauf und hab mer gesetzt auf Stricke. Is 'n Goj gekommen, wo hat ge–soogen an die Stricke un' bin ich gefallen auf 'n Rücken.
»'s Tauwerk is nich' zum Sitzen da,« sagt er.
»Se ver–sseihen gütigst,« sag ich. Nu bin ich gegangen ssu sitzen auf 'e Bank ganz vorne.
»Paß man auf. Da is feucht!« sagt der Goj.
Nu, ich bin geblieben sitzen. De Bank is for alle da und er hat mer nix nich' ssu sagen, denk' ich. Nu, ich sitz – un' wie ich so sitz, kommt e Welle un' macht mer himmelschreiend naß. Waih geschrien, sag ich, was is das for e Gemeinheit?«
»Siehste,« sagte der Goj.
»Nu belieben Se gütigst ssu verstehen, daß ich nix will wern naß un' nix will haben tun mit die Gojim vons Schiff. Püh! Was wern Se machen drieben, wenn ich fragen derf?«
»Weiß ich noch nicht.«
»Nu? wie haißt? Sind Se e Millionär?«
»Nee! Leider nicht. Was wollen denn Sie in Amerika anfangen?«
»Nu, der Silberberg is gegangen nach e böse Pleite in Wodcziliska in Galizien nach New York, un' is geworden e gemachter Mann. Bei de Geschäfte is' ssu machen e Rebbach, schreibt er an de Verwandtschaft. Nu – wer ich handeln – wie der Itzig Silberberg aus Wodcziliska.«
Als ich wieder oben war und dankbar die frische Luft einatmete, lachte ich laut und lange über den handelstüchtigen Sohn Israels. Dann wurde ich nachdenklich.
»Was wern Se machen drieben?…«
Zum Teufel auch, was würde ich eigentlich anfangen? Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Ich glaube, ich habe dieser wichtigen Lebensfrage etwa zehn Minuten gewidmet. Zukunftssorgen waren bis jetzt nicht meine Spezialität gewesen: In schleierhaften Erinnerungen an allerlei Indianerbücher dachte ich an galoppierende Pferde und schießende Cowboys, und … damit war der Schatz meines Wissens erschöpft. Hm, abwarten. Es war mir ja auch so unendlich gleichgültig. Da drüben, irgendwo in der zusammenfließenden Masse von Himmel und Wasser würde in so und so viel Tagen neues Land auftauchen, neue Menschen, neue Dinge. Das würde zweifellos sehr interessant und sehr lustig sein. Ich freute mich schon so auf dieses neue Land, als hätte ich weiß Gott welche wichtigen Pläne. Nebenbei mußte man dann allerdings Brot verdienen. Man mußte arbeiten oder dergleichen. Irgend etwas. Nun, das würde sich schon finden.
»Hinter dem Reiter auf dem Pferde sitzt die schwarze Sorge …«
Das war mir schon in Tertia komisch vorgekommen. Laß sie doch sitzen! Und ich pfiff mir eins und entschied, die Sache sei vorläufig erledigt. Es klang famos, ein Glückssoldat zu sein. Das Wesen eines Glückssoldaten war mir zwar sehr schleierhaft, aber ich vermutete, die Hauptsache sei, sich um nichts zu kümmern, was ich wunderschön fand, und wozu ich unbestritten großes Talent hatte.
Alles war überhaupt wunderschön. Prachtvolles Gefühl, so sein eigener Herr zu sein. Freilich – ein dutzendmal jeden Tag sah ich an mir hinunter, konstatierte, daß mein heller Sommeranzug ausgezeichnet saß und wünschte mich sehnlichst zu den eleganten Herren und Damen auf das Promenadedeck hinüber. Da gehörte ich doch hin! Von Rechts wegen!
Nach und nach waren all die Jammergestalten nach überstandener Seekrankheit an Deck gekommen und verzehrten mit großer Regelmäßigkeit unglaubliche Mengen der derben Schiffskost, als wollten sie Versäumtes wieder einholen. Da waren oldenburgische Bauern, wortkarge Hünen, die den ganzen Tag lang in besorgter Wacht auf ihren Habseligkeiten saßen und niemals mit irgend jemand sprachen. Da waren galizische Juden, ungarische Arbeiter, deutsche Handwerker.
Sie hockten gewöhnlich in Gruppen zusammen. Sie scherten sich den Teufel um die Schönheiten des Meeres und die Fremdartigkeit des Schiffskolosses, aßen und tranken und rauchten und wuschen Wäsche und flickten Zeug und machten aus dem Zwischendeck ein Dorf mit alten Gebräuchen und alten Sitten. Die Weiber säugten ihre Kinder und holten ihren Männern das Essen und tanzten kreuzfidel, wenn der lustige bayrische Bierbrauer seine Ziehharmonika herbeiholte, und die Männer stritten sich und vertrugen sich wieder und erzählten ein wenig und logen ein bißchen, und die Stewards spielten bald die Polizeigewaltigen, weil sie Deutsche waren und ihnen das im Blut steckte; bald erinnerten sie sich daran, daß sie Kellner waren, und ergatterten Nickel.
Die oldenburgischen Bauern hatten Geld im Sack und gingen nach Kansas, um sich in einer deutschen Ansiedlung Land zu kaufen. Die Handwerker berichteten Wunderdinge von amerikanischen Wunderlöhnen – die ungarischen Arbeiter schnatterten den ganzen Tag in ihrer aufgeregten Art – die Juden hockten auf Kisten und Koffern zusammen und mauschelten.
Ich hatte wenig Verständnis für sie und ihre Art; das Zwischendeck der Lahn ist mir eine verschwommene Erinnerung, aus der nur ein paar Menschen auftauchen.
Da war ein schlankes Mädel mit hungrigen Augen. Sie reiste allein und erzählte jedem, der es hören wollte, daß sie des Dienstmädchenspielens und der gnädigen Frauen überdrüssig sei und – ja, da drüben gab's Geld, viel Geld und schöne Kleider, und sie sei ganz gewiß nicht dumm. Die Frauen im Zwischendeck betrachteten sie mit tiefster Abneigung, und die Männer verdrehten die Augen, wenn sie sich blicken ließ. Sie saß stundenlang ganz vorne an der Spitze des Schiffes und starrte aufs Meer hinaus. Einmal setzte ich mich neben sie.
»Einen Pfennig für Ihre Gedanken!«