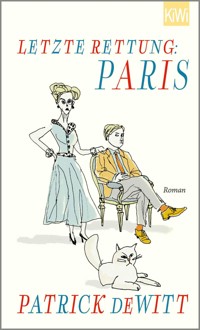9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine überragende rabenschwarze
Sittenkomödie.
Lucy Minor aus dem idyllischen Dorf Bury ist ein blasser, schwächlicher Junge. Er hat weder Freunde noch Pläne – dafür allerdings das Talent zu lügen und neuerdings ein Stellenangebot: für den Posten als Unteroberhaushofmeister auf dem Schloss des Barons Von Aux. Dort lernt Lucy allerlei skurrile Persönlichkeiten kennen und verliebt sich unsterblich in die schöne Klara. Einer allerdings bleibt im Verborgenen: der Baron Von Aux. Ebenso rätselhaft wie dessen Abwesenheit ist das Verschwinden von Lucys Vorgänger Broom. Was hat es mit dem Fehlen der beiden auf sich? Und wird Lucy das Herz von Klara erobern und sich gegen seinen Nebenbuhler Adolphus durchsetzen können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Lucy Minor aus dem idyllischen Dorf Bury ist ein blasser, schwächlicher Junge. Er hat weder Freunde noch Pläne – dafür allerdings das Talent zu lügen und neuerdings ein Stellenangebot: für den Posten des Unteroberhaushofmeisters auf dem Schloss des Barons von Aux in der abgelegenen Wildnis der östlichen Berge. Dort lernt Lucy allerlei skurrile Persönlichkeiten kennen und verliebt sich unsterblich in die schöne Klara. Einer allerdings bleibt im Verborgenen: der Baron von Aux. Ebenso rätselhaft wie dessen Abwesenheit ist das Verschwinden von Lucys Vorgänger Broom. Was hat es mit dem Fehlen der beiden auf sich? Und wird Lucy das Herz von Klara erobern und sich gegen seinen Nebenbuhler Adolphus durchsetzen können?
Weitere Informationen zu Patrick deWitt sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Patrick deWitt
Der Diener, die Dame, das Dorf und die Diebe
Roman
Aus dem Englischen vonJörn Ingwersen
MANHATTAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Undermajordomo Minor« bei Ecco, an imprint of HarperCollinsPublishers, New York.NachweisTextauszug aus: Robert Walser, »Büchners Flucht«, in: Ders., Sämtliche Werke in Einzelausgaben. Hrsg. von Jochen Greven. Band 3: Aufsätze. Mit freundlicher Genehmigung der Robert Walser-Stiftung, Bern. © Suhrkamp Verlag Zürich 1978 und 1985.
Manhattan Bücher erscheinen im
Wilhelm Goldmann Verlag, München, einen Unternehmen der Random House GmbH1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe
2015 by Patrick deWitt, All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher
Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
Redaktion: Alexander Behrmann
Umschlaggestaltung und Konzeption: buxdesign | München,
unter Verwendung eines Designs von Dan Stiles
Umschlagmotiv: © Dan Stiles
Autorenfoto: Danny Palmerlee
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-18364-6V001www.manhattan-verlag.de
Für Gustavo
»Es ist ein großer Schmerz, von einer Qual Abschied nehmen zu müssen. Und wie lautlos die ganze Welt ist!«
ROBERT WALSER
ILUCY, DERLÜGNER
Lucien Minors Mutter hatte nicht geweint, war den Tränen nicht einmal nah gewesen, als er Abschied nahm. Den ganzen Tag über hatte er einen Kloß im Hals gehabt und jede seiner Bewegungen mit Bedacht getan, als könnten sich bei allzu hektischer Tätigkeit unerwünschte Emotionen Bahn brechen. Frühstück und Mittag hatten sie gemeinsam eingenommen, ohne auch nur ein Wort zu wechseln, und nun wurde es für ihn Zeit, doch konnte er sich nicht von seinem Bett aufraffen, auf dem er lag, voll bekleidet mit Mantel und Stiefeln, die Schaffellmütze tief in die Stirn gezogen. Lucien war siebzehn Jahre alt, und seit er denken konnte, war das hier seine Kammer gewesen. Alles, was er sehen und berühren konnte, weckte verstörende Erinnerungen an seine Kindheit. Als er hörte, wie sich seine Mutter unten in der Küche unbeantwortbare Fragen stellte, drohte die Trauer ihn zu überwältigen. Auf dem Boden neben dem Bett wartete geduldig sein Handkoffer.
Schwungvoll erhob er sich von der Matratze und stampfte dreimal mit den Füßen: wumm, wumm, wumm! Dann packte er den Handkoffer am ledernen Griff, stieg die Treppe hinunter und trat zur Tür hinaus, wo er vor den Stufen der heimeligen Kate stehen blieb, um nach seiner Mutter zu rufen. Diese erschien in der Tür, blinzelte verkniffen und klopfte sich den Mehlstaub von den Händen.
»Ist es an der Zeit?«, fragte sie. Als er nickte, sagte sie: »Na, dann komm mal her.«
Er stieg die fünf knarrenden Stufen zu ihr hinauf. Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange, dann schweifte ihr Blick über die Wiese zu den sich türmenden Sturmwolken hinter den Bergen, von denen das Dorf umgeben war. Als sie sich ihm wieder zuwandte, tat sie es mit ausdrucksloser Miene. »Viel Glück, Lucy. Ich hoffe, du wirst diesem Baron zu Diensten sein. Willst du mich wissen lassen, wie es dir ergeht?«
»Das will ich.«
»Nun denn. Leb wohl.«
Sie kehrte in ihre Kate zurück und hielt den Blick gesenkt, als sie die blaue Tür hinter sich schloss. Lucy konnte sich noch gut an jenen Tag erinnern, an dem sein Vater diese Tür gestrichen hatte, zehn Jahre zuvor. Lucy hatte im Schatten eines anämischen Pflaumenbaums gesessen und das undurchschaubare Treiben eines Ameisenhaufens studiert, als sein Vater ihn rief und mit einem Pinsel deutete, dessen Borsten sich zu einem Trichter spreizten: »Eine blaue Tür für einen blauen Jungen.« Während ihm dieser Gedanke kam und er seine Mutter drinnen in der Kate ein lustiges Liedchen summen hörte, legte sich eine drückende Trauer über Lucy. Er sezierte die Sinnlosigkeit dieser Empfindung, denn im Grunde hatte er seinen Eltern nie sonderlich nah gestanden, oder besser gesagt, sie hatten sich nie in der Form um ihn gekümmert, wie er es sich gewünscht hätte, und somit war nie Gelegenheit gewesen, eine enge Bindung herauszubilden. Am Ende schien es ihm, als betrauerte er im Grunde nur den Umstand, dass er nicht viel zu betrauern hatte.
Er beschloss zu verweilen – eine seiner liebsten Beschäftigungen. Er setzte sich auf seinen Handkoffer, schlug elegant die Beine über und holte seine neue Pfeife aus der Jackentasche, mit großer Sorgfalt, ganz so wie man ein Küken halten würde. Diese Pfeife hatte er erst am Tag zuvor erworben, und da er noch nie Pfeife geraucht hatte, stopfte er den nach Schokolade und Kastanie duftenden Tabak gewissenhaft hinein. Er riss ein Streichholz an und paffte, paffte. Von duftendem Rauch umhüllt, kam er sich durchaus malerisch vor und wünschte, jemand würde ihn dabei beobachten und diesbezüglich möglicherweise eine Bemerkung fallen lassen. Lucy war spindeldürr und wirkte blass, fast kränklich, und doch hatte er auch etwas Ansehnliches – volle Lippen, schwarze, lange Wimpern, große, blaue Augen. Insgeheim hielt er sich selbst – auf obskure, wenn auch unbestreitbare Weise – für recht schmuck.
Er nahm die Haltung eines Mannes ein, der in tiefes Sinnen versunken war, wenngleich sich in seinem Geist in Wahrheit nichts, und zwar gar nichts rührte. Er legte den Pfeifenkopf in seine Hand und drehte das Mundstück von sich weg, bis es zwischen Mittel- und Ringfinger ruhte. Dann deutete er damit hierhin und dorthin, denn so machten es die Pfeife schmauchenden Männer in der Schenke, wenn sie Anweisungen gaben oder sich an einen ortsspezifischen Vorfall erinnerten. Besonders gut gefiel Lucy, dass die Pfeife den Körper ihres Besitzers verlängerte, eine nützliche Bereicherung seiner Person. Lucy freute sich darauf, in Gesellschaft anderer mit dieser Pfeife zu deuten. Er brauchte nur noch Publikum, für das es sich zu deuten lohnte, und etwas, worauf er deuten konnte. Er nahm noch einen Zug, doch da er diesbezüglich ein blutiger Anfänger war, wurde ihm bald schwindlig und schwummerig zumute. Er klopfte die Pfeife gegen seinen Handballen, ließ den pelzigen Klumpen zu Boden fallen wie eine verkohlte Feldmaus und betrachtete den rankenden Schleier von Rauch, der aus dem gerupften Tabak stieg.
Mit Blick auf die Kate rekapitulierte Lucy sein bisheriges Leben. Einsam war es gewesen, zumeist, wenn auch nicht sonderlich unglücklich. Sechs Monate zuvor war er an einer Lungenentzündung erkrankt und beinahe daran gestorben. Er dachte an das freundliche Gesicht des Dorfpfarrers Pater Raymond, als dieser ihm in seiner Kammer die letzte Ölung gab. Lucys Vater – ein gottloser Mann – kam von der Feldarbeit heim und fand in seinem Haus einen Pfarrer vor. Zielstrebig packte er den ungebetenen Gast, so wie man eine Katze aus der Kammer befördert. Pater Raymond wunderte sich, derart behandelt zu werden. Er musterte die fremde Hand an seinem Arm und konnte es kaum glauben.
»Aber Euer Sohn liegt im Sterben!«, sagte Pater Raymond (Lucy hörte es ganz deutlich).
»Und was geht Euch das an? Ich denke, Ihr findet allein raus. Vergesst nicht, die Tür hinter Euch zu schließen.« Lucy lauschte den zögerlich schlurfenden Schritten des Pfarrers. Sobald der Riegel ins Schloss gefallen war, rief sein Vater: »Wer hat den denn reingelassen?«
»Ich dachte, es könnte nicht schaden«, rief seine Mutter zurück.
»Aber wer hat ihn hierherbestellt?«
»Das weiß ich nicht, mein Guter. Er stand plötzlich vor der Tür.«
»Er hat Aas gewittert, wie ein Geier«, sagte Lucys Vater und lachte dabei.
Des Nachts allein in seiner Kammer machte Lucy Bekanntschaft mit den Empfindungen des Todes. Im Halbschlaf konnte er spüren, wie sein Geist zwischen den beiden Welten wandelte, was ebenso erschreckend wie auf prickelnde Weise angenehm war. Die Turmuhr schlug zwei Uhr, als ein Mann, den Lucy noch nie gesehen hatte, die Kammer betrat. Er war in unförmiges Sackleinen gehüllt, der Bart ordentlich getrimmt und bräunlich schwarz. Die langen Haare waren an der Schläfe gescheitelt, als hätte er sie eben erst mit Bürste und Wasser gekämmt. Die Füße waren nackt und bis zum Knöchel von Dreck verkrustet. Er tappte an Lucys Bett vorbei, um sich auf dem Schaukelstuhl in der Ecke niederzulassen. Lucys Blick folgte ihm durch verklebte, verquollene Augen. Er fürchtete sich nicht sonderlich vor dem Fremden, doch war dessen Anwesenheit auch nicht dazu angetan, ihn zu beruhigen.
Nach einer Weile sagte der Mann: »Hallo, Lucien.«
»Hallo, Herr«, krächzte Lucy.
»Wie geht es dir?«
»Ich sterbe.«
Der Mann hob einen Finger. »Nun, das hast nicht du zu bestimmen.« Darauf verfiel er in Schweigen und schaukelte eine Weile. Das Schaukeln schien ihm zu gefallen, als machte er es zum ersten Mal und empfände es als ungemein erfüllend. Abrupt jedoch nahm das Schaukeln ein Ende, als wäre ihm ein unangenehmer Gedanke gekommen. Seine Miene wurde ernst, und er fragte: »Was wünschst du dir von deinem Leben, Lucy?«
»Nicht zu sterben.«
»Davon einmal abgesehen. Falls du überleben solltest – was würdest du dir erhoffen?«
Lucys Gedanken flossen träge dahin. Die Frage des Mannes war ihm ein Rätsel. Und doch fiel ihm eine Antwort ein, und sie sprudelte aus seinem Mund, als führten seine Gedanken ein Eigenleben: »Dass irgendwas passiert«, sagte er.
Das schien den sackleinenen Mann zu interessieren. »Du bist unzufrieden?«
»Ich langweile mich.« Lucy fing ein wenig an zu weinen, nachdem er das gesagt hatte, denn es schien ihm eine wahrlich jämmerliche Äußerung zu sein, und er schämte sich für sein armseliges Leben. Doch war er zu schwach, um lange zu weinen, und als seine Tränen getrocknet waren, starrte er ins Kerzenlicht und sah die Schatten zucken und bis an die fahle, weiße Kante schwappen, wo sich Wand und Decke trafen. Seine Seele löste sich, während der Mann herüberkam, am Bett niederkniete, seinen Mund an Luciens Ohr hielt und tief einatmete. Als er das tat, spürte Lucy, wie die Hitze und das Siechtum seinen Körper verließen. Der Mann hielt die Luft an, ging hinaus und lief den Flur entlang zur Kammer von Luciens Eltern. Im nächsten Augenblick erlitt Lucys Vater einen Hustenkrampf.
Als der Morgen graute, hatte Lucy wieder Farbe im Gesicht, wohingegen sein Vater blasser war, die Augen rot gerändert, wo an den Lidern Wimpern sprossen. Als der Abend dämmerte, lag sein Vater krank im Bett, während Lucy erste behutsame Schritte in seiner Kammer wagte. Und als am nächsten Morgen die Sonne aufging, war Lucy bester Dinge, abgesehen von einer gewissen Empfindsamkeit in Muskeln und Gelenken, sein Vater jedoch lag leblos im Bett, der Mund ein blutiges Grinsen, die Hände zu Klauen verkrampft. Die Leichenbestatter kamen, um den Toten abzuholen, und einer von ihnen verlor auf der Treppe den Halt, sodass der Kopf des Vaters hart gegen eine Stufe prallte. Der Schlag war so heftig, dass er ihm ein kleines Dreieck in die Stirn schlug, und doch blutete die Wunde nicht, was seltsam war und von den Leichenbestattern in Lucys Beisein ausgiebig diskutiert und kommentiert wurde. Lucy folgte den dreien zur Tür hinaus und sah, wie sein erstarrter Vater auf einen schmutzigen Karren geladen wurde. Als dieser anfuhr, rollte der Leichnam hin und her, wie aus eigener Kraft. Ein Windstoß wehte unter Lucys Nachthemd, und der Frost im Boden hauchte kalt an seinen Knöcheln empor. Auf den Ballen seiner Füße wippend, wartete er auf ein Gefühl der Reue oder Ehrfurcht, was sich jedoch beides nicht einstellen wollte, nicht an jenem Tag und auch an keinem anderen.
In den darauffolgenden Monaten trübte sich die Beziehung zu seiner Mutter deutlich ein. Schließlich gab sie zu, sie wisse zwar, dass Lucy streng genommen keine Schuld träfe, aber dennoch hielte sie ihn für mitverantwortlich am Tode seines Vaters, weil er die Krankheit – wenn auch unwissentlich – einem eigentlich kerngesunden Mann übertragen hatte, woraufhin dieser daran verstorben war. Lucy wollte seiner Mutter von dem sackleinenen Besucher erzählen, doch spürte er, dass er darüber nicht sprechen durfte, zumindest nicht mit ihr. Der Zwischenfall nagte jedoch so sehr an ihm, dass er des Nachts stets hochschreckte, sobald das Haus zur Ruhe kam. Als er die Bürde nicht mehr tragen konnte, suchte er Pater Raymond auf.
Lucy hatte keine ausgeprägte Meinung zur Kirche. »Ich kann Adam nicht von Eva unterscheiden«, zitierte er nur zu gern eines seiner zahlreichen selbst ersonnenen Bonmots, die seiner Ansicht nach ein besseres Publikum verdient hatten als jene Frauen, die sich am Brunnen auf dem Marktplatz tummelten. Pater Raymond jedoch hatte etwas an sich, das ihm gefiel – eine Aufrichtigkeit, ein unverstelltes Mitgefühl. Pater Raymond war ein tugendhafter und barmherziger Mann. Er folgte Gott aufs Wort, und des Nachts, allein in seiner Kammer, spürte der Pater, dass der Heilige Geist seinen Körper wie ein Vogelschwarm durchflatterte. Er war sehr erleichtert, dass Lucy gesund und munter zu ihm kam. Tatsächlich war er erleichtert, dass überhaupt jemand zu ihm kam. Die Dorfbewohner waren zumeist unreligiös, und ganze Tage vergingen, ohne dass jemand an seine Tür klopfte. Heute nun führte er seinen Besucher ins Wohnzimmer und bot ihm eine Schale mit steinalten Keksen an, die zu Staub zerfielen, bevor Lucy sie in seinen Mund befördern konnte. Auch die Kanne mit dem bleichen Tee bot geschmacklich keine Ablenkung. Schlussendlich gab er den Versuch auf, etwas zu sich zu nehmen, und erzählte die Geschichte vom Besuch des Fremden. Als er fertig war, fragte Lucy, wer dieser Mann gewesen sein mochte, doch Pater Raymond verzog nur das Gesicht.
»Woher soll ich das wissen?«
»Ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht Gott war«, sagte Lucy.
Pater Raymond schien da seine Zweifel zu haben. »Gott reist nicht bei Nacht herum und sät Krankheiten.«
»Dann der Tod.«
»Möglich.« Pater Raymond kratzte sich an der Nase. »Oder vielleicht ein Räuber. Ist dir denn aufgefallen, ob im Hause etwas fehlt?«
»Nur mein Vater.«
»Hm«, machte der Pfarrer. Er nahm einen Keks, doch auch dieser zerrieselte zu Staub. Er wischte sich die Krümel von den Händen.
»Ich glaube, der Mann wird wiederkommen«, sagte Lucy.
»Hat er das gesagt?«
»Nein. Aber ich spüre es.«
»Nun, da hast du es. Wenn du diesen Burschen das nächste Mal siehst, vergiss nicht, ihn nach seinem Namen zu fragen.«
Auf diese Weise trug Pater Raymond wenig dazu bei, Lucy zu beruhigen, was den sackleinenen Fremden anging. Und doch entpuppte er sich als Hilfe, wenn auch auf gänzlich unerwartete Weise. Als Lucy zugab, keinerlei Pläne für die Zukunft zu haben, nahm der Pfarrer es auf sich, Empfehlungsschreiben an jedes Schloss im Umkreis von hundert Kilometern zu schicken, weil er meinte, Lucy könne sich vielleicht gut als Diener machen. Diese Briefe blieben sämtlich unbeantwortet, bis auf einen, verfasst von einem Mann namens Myron Olderglough, dem Oberhaushofmeister auf einem der Anwesen des Barons von Aux in der abgelegenen Wildnis der östlichen Berge. Mr Olderglough war Pater Raymonds romantischer Darstellung erlegen, die Lucy als »ankerlose Seele auf der Suche nach der Geborgenheit eines sicheren Hafens« beschrieb. (Es ging das Gerücht, Pater Raymond verbrächte seine freundlosen Nächte mit der Lektüre von Abenteuerromanen, die sowohl seine Träume als auch sein Dasein bunter machten. Ob dies der Wahrheit entsprach oder nicht, blieb unbekannt. Dass der Pfarrer eine Schwäche für blumige Ausdrücke hatte, bleibt jedoch unbestritten.) Das Schreiben endete mit einem Beschäftigungsangebot und den entsprechenden Entlohnungsbedingungen. Die Stellung war gering (Mr Olderglough gab ihr die Bezeichnung »Unteroberhaushofmeister«, was im Grunde gar kein Wort war, wie Lucy und Pater Raymond fanden), und das spiegelte sich auch in der Bezahlung wider. Doch da Lucy nichts Besseres zu tun hatte, nirgendwo anders auf der Welt erwartet wurde und ihm bei dem Gedanken an den Mann in Sackleinen nicht recht wohl war, nahm er sein Schicksal an und schrieb Olderglough, dass er dessen Angebot akzeptierte, eine Entscheidung, die manches nach sich ziehen sollte, einschließlich – wenn auch nicht ausschließlich – wahre Liebe, bittersten Herzschmerz, brennendes Entsetzen und einen akuten Tötungsimpuls.
Lucy betrachtete das Dorf Bury, das in der Senke des Tales ruhte oder sich, wie er dachte, Strandgut gleich dort angehäuft hatte. Es war ein malerischer Ort, und doch – wenn sein Blick nun über den dicht gedrängten Weiler schweifte, empfand er ein Gefühl der Niederlage, der vagen Abscheu. War er hier jemals etwas anderes als ein Außenseiter gewesen? Die Antwort lautete: Nein. An einem Ort, der dafür berühmt war, grobschlächtige Hünen hervorzubringen, stellte Lucy ein vergleichsweise minderwertiges Exemplar dar. Er konnte nicht tanzen, vertrug keinen Schnaps, hatte keinerlei Ambitionen, Bauer zu werden, hatte nie enge Freunde gehabt, und keine der ortsansässigen Frauen fand ihn auch nur einer Bemerkung wert, von Zuneigung ganz zu schweigen, bis auf Marina, und die war eine allzu kurze Ausnahme gewesen. Von jeher hatte er gespürt, dass ihn irgendetwas von seinen Mitbürgern trennte, und den Verdacht gehegt, dass er nicht da war, wo er hingehörte. Nachdem er die Stellung beim Baron von Aux angenommen hatte, stolzierte er durchs Dorf, um die Nachricht zu verbreiten, doch begegnete man ihm nur mit wohlwollendem Desinteresse und floskelhaften guten Wünschen. Sein Leben war derart ereignislos verlaufen, dass sein Abschied nicht einmal der Rede wert war.
In diesem Moment wurde Lucys Fenster aufgestoßen. Seine Mutter erschien und schlug mit einem kraftvollen Ruck den Bettvorleger aus. Eine mächtige Staubwolke explodierte glitzernd im Sonnenschein. Eine Weile hing sie in der Luft, und Lucy trat näher heran, um das verträumte Rieseln aus der Nähe zu betrachten. Als sich der Staub – sein eigener – auf Haaren und Schultern niedergelassen hatte, bemerkte ihn die Mutter und fragte: »Du bist noch da? Wirst du nicht deinen Zug verpassen?«
»Noch ist Zeit, Mutter.«
Sie warf ihm einen skeptischen Blick zu und verschwand, ließ den Bettvorleger aus dem Fenster hängen wie eine Kälberzunge. Eine Weile betrachtete Lucy das leere Fenster, dann nahm er seinen Handkoffer und machte sich auf den Weg, folgte dem Pfad zwischen den Bäumen hindurch und ins Tal hinab zum Bahnhof.
Ein Mann kam ihm entgegen, mit schäbigem Tornister in der einen Hand und behelfsmäßigem Wanderstab in der anderen. Der Mann sah aus wie ein Landarbeiter, der in seinem Sonntagsanzug steckte. Als er Lucy bemerkte, blieb er stehen und musterte eingehend dessen Handkoffer, als stellte dieser ihn vor ein Problem.
»Hast du das Zimmer im Haus der Minors bezogen?«, fragte er.
Anfangs verstand Lucy ihn nicht recht. »Bezogen? Nein, ich bin gerade erst dort ausgezogen.«
»Dann ist das Zimmer also noch zu haben?«
Lucy neigte seinen Kopf ein wenig, so wie ein Hund es tut, wenn er einen fernen Pfiff hört. »Wer hat Euch gesagt, dass dort ein Zimmer frei ist?«
»Die Frau selbst. Gestern Abend hängte sie gerade einen Zettel in der Schenke auf, als ich zufällig vorüberkam.«
Lucy wandte sich zur Kate um, obwohl diese hinter den Bäumen nicht mehr zu sehen war. Als er seine Mutter am Abend zuvor gefragt hatte, wohin sie wollte, hatte sie geantwortet, an die frische Luft.
»Sie schien mir eine ehrenhafte Frau zu sein«, sagte der Mann.
»Sie ist nicht unehrenhaft«, antwortete Lucy, während er noch immer bergan blickte.
»Und du sagst, du bist gerade dort ausgezogen?«
»Just in diesem Moment.«
Leise sagte der Mann: »Ich hoffe, dir schien die Unterkunft nicht in irgendeiner Weise mangelhaft.«
Lucy drehte sich wieder zu dem Landarbeiter um. »Nein.«
»Manchmal entdeckt man den Mangel erst, wenn es zu spät ist. So erging es mir im letzten Haus. Zum Ende meines Aufenthaltes dort nagte ich am Hungertuch.«
»Bei den Minors wird es Euch gefallen.«
»Sie schien mir eine ehrenhafte Frau zu sein«, wiederholte der Mann. »Ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel, dass ich vor der Zeit komme, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass man bei solchen Dingen baldigst zugreifen sollte.« Er deutete auf die Steigung. »Ich muss doch hier entlang, nicht wahr?«
»Der Pfad führt Euch direkt dorthin«, sagte Lucy.
»Nun, ich danke dir, Junge. Viel Glück auf allen deinen Wegen.« Er verneigte sich und ging weiter. Schon verschwand er hinter der nächsten Biegung, als Lucy ihn noch einmal rief.
»Würdet Ihr der Frau wohl sagen, dass Ihr mich getroffen habt? Der Frau des Hauses?«
»Wenn das dein Wunsch ist.« Der Mann hielt inne. »Aber was soll ich ihr sagen, wem ich begegnet bin?«
»Sagt ihr, Ihr hättet Lucy getroffen. Und berichtet ihr von unserem Gespräch.«
Das schien dem Landarbeiter ein fürwahr seltsames Ansinnen zu sein, und doch tippte er an seinen Hut. »Wird gemacht.«
Als der Mann zwischen den Bäumen verschwand, flog Lucy ein böser Gedanke an, und im selben Augenblick, als dieser Gedanke ausgeformt war, umwehte ihn ein Windhauch, blies ihm mitten ins Gesicht. Hin und wieder mochte eine Windbö wohl wie eine stumme Stimme sein, die eine persönliche Grille oder Erkenntnis kommentierte. Ob der Wind seiner Ansicht war oder einer anderen, wer konnte das schon wissen? Lucy gewiss nicht. Und es kümmerte ihn auch nicht weiter. Somit stapfte er weiter bergab. Er fühlte sich wie eine Trommel, eine Faust, ein überpralles Segel, von Sturm und Drang getrieben.
Jedenfalls war ihm nicht mehr langweilig.
Lucy dachte bei sich, es sei wohl angezeigt, Marina zu besuchen, um ihr Lebewohl zu sagen, und so machte er sich auf, um nachzusehen, ob sie denn zu Hause sei. Tors hünenhafte Stiefel standen nicht auf der Veranda, also klopfte Lucy an und lehnte am Türrahmen, als käme er rein zufällig vorbei. Als sie ihm jedoch öffnete, war sie von derart unverdorbener Schönheit, dass ihm seine wahren Empfindungen ins Gesicht geschrieben standen, eine wilde Mischung aus Anbetung und Bitterkeit. Marina hingegen empfand bezüglich seiner Anwesenheit rein gar nichts. Sie deutete auf den Handkoffer und fragte:
»Willst du irgendwohin?«
Also hatte sie noch nicht einmal mitbekommen, dass er wegging. »Ja«, sagte er. »Man bestellte mich zum Schloss von Aux. Du hast vielleicht davon gehört?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Bist du sicher? Es liegt im Osten, in den hohen Bergen – ein ausgesprochen malerischer Ort, wie es heißt.«
»Davon habe ich noch nie gehört, Lucy.« Teilnahmslos warf sie einen Blick über seine Schulter hinweg, in der Hoffnung auf die eine oder andere Ablenkung. »Und was wirst du in diesem berühmten, malerischen Schloss tun?«
»Ich werde Unteroberhaushofmeister sein.«
»Was ist das?«
»So was Ähnliches wie ein Oberhaushofmeister, mehr oder weniger.«
»Klingt eher nach weniger.«
»Ich werde mit ihm Hand in Hand arbeiten.«
»Vermutlich als sein Handlanger.« Sie löste und band ihre Schürze neu, schmiegte sie eng um ihre zierliche Taille. »Wie ist der Lohn?«
»Der Lohn ist anständig.«
»In welcher Höhe?«
»Sogar ausnehmend anständig. Selbst eine Fahrkarte für die Erste Klasse haben sie mir geschickt. Das fand ich doch überaus zuvorkommend. Sie wollen mich für sich einnehmen, so viel steht fest.« In Wahrheit hatten sie ihm einen nur armseligen Vorschuss geschickt, der nicht einmal für die Dritte Klasse reichte. Den Rest hatte er bei seiner Mutter als Darlehen aufnehmen müssen.
Marina fragte ihn: »Wie bist du an diese Stellung gekommen?«
»Der gute Pater Raymond hat mir assistiert.«
Spöttisch grinsend sagte sie: »Dieser Zottelgreis. Der ist doch staubig wie ein alter Keks.« Darüber lachte sie laut und lange. Lucy war es unbegreiflich, wie ihr Lachen derart heiter und entzückend klingen konnte, während sie selbst doch so engherzig und kleinlich war. Überdies konnte er nicht verstehen, warum er ein derart überwältigendes Verlangen nach jemandem hatte, der ganz offensichtlich durch und durch verdorben war.
»Lach du nur über den Mann, aber er hat es sich nicht nehmen lassen, mir zu helfen. Das ist mehr, als ich von jedem anderen hier in der Gegend behaupten kann.«
Marina sparte sich die Mühe, gekränkt zu sein. Sie warf einen Blick ins Haus und schien zu überlegen, ob sie hineingehen sollte, doch Lucy war noch nicht bereit, Abschied zu nehmen. Da ihm nichts Besseres einfiel, zückte er seine Pfeife und deutete auf die Sturmwolken, die mittlerweile über dem Tal eine dichte Wolkendecke bildeten. »Sieht nach Regen aus«, sagte er. Sie blickte nicht zum Himmel auf, sondern starrte seine Pfeife an.
»Seit wann rauchst du Pfeife?«, fragte sie.
»Erst kürzlich wohl.«
»Wie kürzlich?«
»Sehr kürzlich.«
Verklärten Blickes sagte sie mit seidiger Stimme: »Tor raucht Zigaretten. Er rollt sie mit einer Hand – so …« Sie wischte mit den Fingern an ihrem Daumen entlang und mimte dabei Tors Selbstzufriedenheit und Geltungsdrang. »Hast du schon gehört, dass er dabei ist, den Kaufvertrag für Schultzens Bauernhof auszuhandeln?«
Davon hatte Lucy nichts gewusst, und eine wahre Flut von Schimpfworten und Scheltnamen kam ihm in den Sinn, denn das Schultzensche Anwesen war das schönste von ganz Bury. Und doch hütete er sein Zunge, denn sein Abschied von Marina sollte friedlich werden, wenn auch nicht aus Großmut, sondern damit sie sich eines Tages, nachdem Tor sie unglücklich gemacht haben würde – woran nicht der geringste Zweifel bestand – und sie wieder allein dasäße, an Lucys Großzügigkeit erinnern würde und den schmerzhaften Stachel bitterer Reue zu spüren bekäme. In nüchternem Ton erklärte er ihr: »Schön für Tor. Oder besser: schön für euch beide. Ich hoffe, dass ihr miteinander glücklich werdet.«
Diese Worte rührten Marina, und sie kam näher, um Lucy zu umarmen. »Danke, Lucy«, sagte sie. »Danke.« Ihre Haare strichen über sein Gesicht, und er spürte ihren Atem an seinem Hals. Der unerwartete Kontakt löste in ihm ein Gefühl aus, als läutete in seinem Magen ein Glöckchen, und er musste an ihre kurze Liebelei denken, die im letzten Frühling erblüht war.
Zu Beginn hatte die Romanze meist aus Waldspaziergängen, Händchenhalten und tiefen Blicken in die Augen bestanden. Nach einem Monat etwa wurde Marina klar, dass Lucy ohne Ermutigung keinerlei Anstalten machen würde, sie zu verführen, also ermutigte sie ihn, und Lucy war schockiert, wenn auch nicht sehr lange. Die tägliche Unzucht auf den satten, hügeligen Feldern unterhalb des Dorfes wurde bald schon zur Gewohnheit. Lucy war sehr erleichtert, endlich, endlich eine Frau gefunden zu haben, und er war sicher, dass Marina ihm eine treue Seele sein würde. Während die beiden so nackt im Gras lagen und die Wolken sich gemächlich über die Bergkuppen schoben, sann er über ihre gemeinsame Zukunft nach. Wie viele Kinder würden sie wohl haben? Zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Sie würden sparsam leben, und Lucy würde Lehrer oder Flickschuster oder Dichter werden – irgendetwas, das ihm keine allzu anstrengende Tätigkeit abverlangte. Des Abends würde er heimkehren in ihr bescheidenes Häuschen. Seine Familie würde ihn mit offenen Armen empfangen und ihm seinen Lehnstuhl am Kamin bereithalten. Ob er gern ein Tässchen Tee hätte. Aber ja, das wäre nett, und seid bedankt dafür. Wie wäre es mit ein wenig Gebäck? Nun, warum nicht? Solcherart Tagträume lösten in Lucy eine körperliche Reaktion aus, eine angenehme Spannung, die von den Schultern bis unter seine Füße reichte, sodass sich die Zehen im Sonnenschein spreizten.
Seine Träume vom zufriedenen Leben wurden noch verstärkt durch die lustvolle Feldforschung, die sich – wie er fand – bemerkenswert gut machte. Als er jedoch eines Nachmittags ebensolches zu Marina sagte, verdüsterte sich ihre Miene. Er fragte, was denn los sei, und sie erklärte ihm: »Es ist nur, dass … du brauchst gar nicht so sanft mit mir umzugehen, Lucy.« Kurz darauf sagte sie sich von ihm los, und Lucy verbrachte liebeskranke Monate mit derart eingehendem Studium ihrer sonderbaren Worte, dass diese letztendlich alle Bedeutung verloren hatten – und er sich nie erklären konnte, was sie eigentlich von ihm gewollt hatte. Nun wurde ihm schmerzlich bewusst, dass Tors Hände von braun gelockten, in der Sonne blond gebleichten Haaren bewachsen waren und dass es, wenn der Kerl einen Humpen Bier ergriff, aussah, als hielte er einen Fingerhut. Lucy hasste Tor und beschloss unvermittelt, eine beträchtliche Lüge über ihn zu verbreiten. Marina nahm schon Abschied, da sagte er: »Bevor ich jedoch gehe, sollte ich dich noch etwas über diesen Tor wissen lassen.«
»Ach ja? Solltest du?«
»So leid es mir tut. Und es tut mir sehr leid.«
Sie verschränkte die Arme. »Was gibt’s?«
Er überlegte einen Moment. Als ihm die Lüge in den Sinn kam, faltete er feierlich die Hände und sagte: »Rein zufällig weiß ich aus sicherer Quelle, dass er in Hornung mit einer anderen Frau verlobt ist.«
Sie lachte. »Wer hat dir das erzählt? Das ist nicht wahr!«
»Leider doch. Und das ist auch der Grund für mein Kommen. Ich werde Bury für immer verlassen, doch konnte ich den Gedanken nicht ertragen, dass man dich zum Narren hält.«
»Wer ist hier ein Narr?«
»Fang mit dieser Auskunft an, was du willst.«
Sie sagte: »Ich glaube, du bist nur eifersüchtig auf Tor, Lucy.«
»In der Tat, Marina. Ich bin eifersüchtig auf Tor. Doch mehr noch als das bin ich voll der Verachtung für ihn. Denn wenn du die Meine wärst, würdest du gewisslich nie erleben, dass ich in Hornung mit einer anderen Frau herumstolziere und sie jedem als meine zukünftige Braut vorstelle. Sie ist, soweit ich informiert bin, etliche Jahre jünger als du.«
Wenn Lucy sich erst dazu entschlossen hatte, war er ein geschickter Lügner von jenem seltenen Schlag, der mit äußerster Überzeugungskraft glaubhaft Informationen verbreiten konnte, die jeder Wahrhaftigkeit spotteten. Er merkte, dass Marina ihn ernst zu nehmen begann, und so trieb er es noch weiter, indem er sagte: »Angeblich soll die Mitgift auch nicht unerheblich sein. In gewisser Weise kann man es Tor nicht mal verdenken.«
»Genug, Lucy«, raunte sie. »Sag, dass es gelogen ist. Wirst du mir das jetzt sagen?«
»Ich wünschte, ich könnte. Doch ist es mir unmöglich, denn was ich sage, entspricht den Tatsachen, und einstmals habe ich einen Pakt mit dir geschlossen. Du erinnerst dich?«
Ihre Augen flatterten und blickten umher. Sie hörte Lucy nur halb zu. »Einen Pakt«, sagte sie sanft.
»Du hast mich darum gebeten, dir gegenüber immer aufrichtig zu sein, und das habe ich dir geschworen. Du wirst dich daran erinnern, Marina. Schließlich hast du mir dasselbe versprochen.«
Da blickte sie traurig drein, denn nun glaubte sie ihm voll und ganz. »Lucy«, sagte sie.
»Leb wohl!«, sagte er, wandte sich um und zog von dannen.
Federnden Schrittes wie ein junges Fohlen dachte er: Welch bemerkenswert Ding doch eine Lüge ist. Er fragte sich, ob sie nicht des Menschen feinste Errungenschaft sei, und kam nach einiger Überlegung zu dem Schluss, dass das der Fall sein mochte. Grenzenlose Begeisterung für seine Zukunft überkam ihn, und es wäre ein triumphaler Abschied geworden, wäre da nicht der unglückliche Umstand gewesen, dass der stellvertretende Lokomotivführer im zweihundert Kilometer entfernten Rabenburg in der Nacht zuvor darauf bestanden hätte, eine zweite Portion Käse zum Dessert zu essen.
Eirik & Alexander
Der stellvertretende Lokomotivführer namens Eirik rang in der Schenke mit seiner Enttäuschung, nachdem ihn die Nachricht ereilt hatte, dass sein junger Kollege Alexander zum Lokomotivführer ernannt werden würde, eine Kränkung angesichts der Tatsache, dass Eirik der ältere von beiden war und auf viele Jahre treuer Dienste für die Eisenbahngesellschaft zurückblickte. Neun Pflaumenschnäpse hatte er bereits getrunken, als Alexander die Schenke betrat, nickend in die Runde grüßte, ohne jedoch seine Beförderung kundzutun, was in gewisser Weise noch schlimmer war, als es zu tun, denn ihm war deutlich anzusehen, dass er vor Stolz schier platzte. Er setzte sich neben Eirik und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Eirik spürte das Mitgefühl in dieser Hand und schüttelte sie ab, um sich der Last zu entledigen. Alexander bot an, Eirik einen guten Tropfen zu spendieren, doch dieser lehnte ab. »Ich danke dir, doch noch bin ich nicht mittellos.«