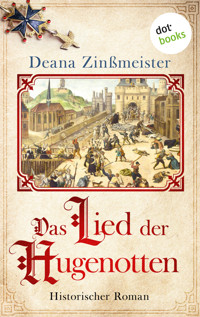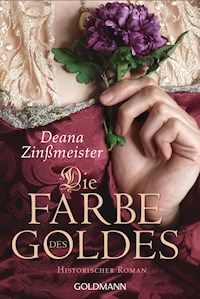Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Das große Glück war zum Greifen nah, doch das Schicksal ist schneller: "Der Duft der Erinnerung" von Bestsellerautorin Deana Zinßmeister als eBook bei dotbooks. Australien 1793: Seit ihr Mann Duncan verschwunden ist, fühlt sich Luise in Sydney nicht mehr sicher. Der rachsüchtige Friedensrichter Steel droht ihr unverhohlen und auch ihre Freundin Collette ist nicht mehr an ihrer Seite, um ihr beizustehen. So kehrt Luise allein nach Europa zurück und wartet sehnsüchtig auf eine Nachricht ihres Ehemannes. Bei Freunden hat Luise Zeit, sich von der kräftezehrenden Reise zu erholen … doch etwas stimmt nicht. Sie fühlt sich ständig beobachtet – und eines Nachts steht ein vermummter Fremder in ihrem Schlafzimmer. Reicht Steels Einfluss so weit oder droht ihr von anderer Seite Gefahr? "Deana Zinßmeisters Geschichten haben Erfolgsgarantie." Bild Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Der Duft der Erinnerung", Band 2 der großen Australien-Saga von Deana Zinßmeister wird Fans von Patricia Shaw begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Australien 1793: Seit ihr Mann Duncan verschwunden ist, fühlt sich Luise in Sydney nicht mehr sicher. Der rachsüchtige Friedensrichter Steel droht ihr unverhohlen und auch ihre Freundin Collette ist nicht mehr an ihrer Seite, um ihr beizustehen. So kehrt Luise allein nach Europa zurück und wartet sehnsüchtig auf eine Nachricht ihres Ehemannes. Bei Freunden hat Luise Zeit, sich von der kräftezehrenden Reise zu erholen … doch etwas stimmt nicht. Sie fühlt sich ständig beobachtet – und eines Nachts steht ein vermummter Fremder in ihrem Schlafzimmer. Reicht Steels Einfluss so weit oder droht ihr von anderer Seite Gefahr?
»Deana Zinßmeisters Geschichten haben Erfolgsgarantie.« Bild
Über die Autorin:
Deana Zinßmeister widmet sich seit einigen Jahren ganz dem Schreiben historischer Romane. Bei ihren Recherchen wird sie von führenden Fachleuten unterstützt, und für ihren Bestseller »Das Hexenmal« ist sie sogar den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Saarland.
Bei dotbooks veröffentlichte sie bereits ihren Erfolgsroman »Fliegen wie ein Vogel«.
Webseite der Autorin: www.deana-zinssmeister.de
***
eBook-Neuausgabe Februar 2017
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Moments in der area verlag gmbh, Erftstadt
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / KathySG / Christopher Meder / Danuta / Konrad Mostert / Rachael Towne / ESOlex / Leah-Ann Thompson / bmphotographer
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-759-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Duft der Erinnerung« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Deana Zinßmeister
Der Duft der Erinnerung
Roman
dotbooks.
Für meine Kinder
Carsten und Madeleine Zinßmeister, das Beste in meinem Leben!
»Auf Vandiemensland pflügen«
»Ihr braven Wild’rer alle, vernehmet jetzt mein Lied,
Wenn ihr mit Hund und Falle durch Englands Wälder zieht.
Fasanen in der Tasche, den Hasen in der Hand,
Mit keiner Silbe denkend an Vandiemensland.
Drei kühne Männer waren wir, die furchtlos einst die Beute
In Englands Wäldern jagten, bis uns dann die Leute
Des Waldbesitzers fassten. Sie lauerten im Sand –
Auf vierzehn Jahre mussten wir nach Vandiemensland.
Kaum war’n wir auf der Insel, verkauft’ man uns wie Pferde,
In Reih und Glied, so standen wir da auf der harten Erde;
Wir mussten wie die Ochsen am unheilvollen Strand
Den harten Boden pflügen dort auf Vandiemensland.
In einer alten Hütte aus Soden und Lehm,
Auf faulem Stroh als Bettstatt lebt sich’s nicht angenehm,
Und jede Nacht ward Feuer rings um uns abgebrannt
Zum Schutz vor Wolf und Tiger auf Vandiemensland.
Oft, wenn ich nächtens schlafe, kommt mir ein süßer Traum, mit meiner Allerliebsten streif’ ich am Waldessaum entlang, wie ich’s gern hatte daheim im Vaterland, dann wach ich auf, mein Herz steht still: Hier ist Vandiemensland.
Drum merket auf, das ist mein Rat, es gilt den Wild’rern allen:
Lasst Büchse, Hund und Schlinge fahr’n, verzichtet auf die Fallen.
Denn jeden, man fasst, bringt gnadenlos man her,
Jetzt wisst ihr, wie es uns erging – drum wilderet nicht mehr.«
(Aus: Robert Hughes: AUSTRALIEN. Die Besiedelung des Fünften Kontinents)
Dies ist eine Ballade, die auf der Gefängnisinsel Vandiemensland entstanden ist.
Die bloße Nennung dieser Insel ließ jeden erschauern. Wegen der Strenge und Härte, die dort herrschte, schwingt Angst in vielen Sträflingsliedern mit.
Vandiemensland war die Verkörperung der Strafe.
Kapitel 1
Südafrika, 4. September 1793
»Prego, Signora, Sie dürfen die Luft nicht anhalten! Mi dispiace.«
Wie durch einen Nebelschleier drangen laut gesprochene Worte, die mit einer fremden Sprache vermischt waren, zu Luise durch. Immer wieder wurde ihr Körper von Krämpfen geschüttelt. Als ob sie Fieber plagen würde, stand Schweiß auf ihrer Stirn. Die Haare klebten feucht an den Schläfen.
»Es ist zu früh! Mindestens sechs Wochen zu früh!«, fuhr es ihr voller Panik durch den Kopf. Wieder hörte sie fremdländische Worte, die sie nicht verstand. Eine neue Welle der Schmerzen schien ihren Unterleib zu zerreißen und hinderte sie am Sprechen. Als sie wieder durchatmen konnte, stammelte sie: »Holen Sie Kapitän Fraser und Mrs. Reeves. Bitte.«
»No, Signora, non e possibile. Capitano Fraser ist heute Morgen nach l’Inghilterra gesegelt. Großer Sturm soll kommen – deshalb sehr eilig. La signora e signore wollten arrivederci sagen, aber Sie haben geschlafen. Scusi, mi dispiace.«
Luise wollte nicht glauben, was sie da hörte. Kapitän Fraser und Peggy konnten sie unmöglich jetzt schon allein gelassen haben. Hier, auf diesem fremden Kontinent und in diesem Zustand. Sie hatten doch erst später abreisen wollen, wenn feststand, dass mit Luise alles in Ordnung war. Am liebsten hätte sie ihre Angst laut hinausgeschrien, doch sie brachte keinen Ton hervor. Das war wieder die Situation, die sie bereits kannte und vor der sie sich stets fürchtete. Sie war erneut allein.
Weil Kapitän Fraser durch Luises Zustand einen längeren Aufenthalt in Kapstadt gehabt hatte, galt es, die verlorene Zeit aufzuholen. Er konnte es sich nicht erlauben, durch einen Sturm noch länger in Südafrika festzusitzen. Obwohl Luise die Entscheidung ihrer Freunde verstehen und nachvollziehen konnte, breitete sich in ihrem Kopf ein Gefühl der Leere aus, zu dem sich Traurigkeit gesellte. Weiter kam sie nicht in ihren Gedanken, denn wieder ergriff der Schmerz Besitz von ihrem Unterleib und schien sie in den Wahnsinn treiben zu wollen. Verkrampft umfassten ihre Hände die Bettdecke und suchten in dem weißen Leinen nach Halt. Ihr Nachthemd war durchnässt von dem Schweiß der Überanstrengung. Wieder hielt sie den Atem an, bis ihr Gesicht rot anlief. Dann ließ Luise die Luft keuchend entweichen. Im selben Moment schämte sie sich. Aber es tat gut, und selbst das kreideblasse Gesicht von Giuseppe Zingale konnte sie nicht davon abhalten. Luise war am Ende ihrer Kräfte. Jedes Mal, wenn der Schmerz nachließ, hoffte sie, dass er nicht wiederkommen würde. Mit einem feuchten Tuch kühlte Giuseppes Frau Maria Luises Gesicht und flößte ihr kalten Tee ein. Maria war eine stämmige Italienerin, mit einem runden Gesicht, fast schwarzen Augen und ebensolchen Haaren. Durch ihre Körperfülle wirkte sie größer als ihr zierlicher Mann. Sehr zum Verdruss Giuseppes hatte sich seine ehemals volle Haarpracht gelichtet. Nur noch ein Kranz dunkler Haare zierte seine sonst glänzende Schädeldecke. Luise hatte auf ihrer Hinreise nach Australien Herrn Zingale in seinem Schneideratelier kennen gelernt und sich bei ihm ein Kleid aus blauem Stoff gekauft.
Nun sah Luise aus den Augenwinkeln, wie Maria etwas zu ihrem Mann sagte. Dieser stand bleich vor ihr, bekreuzigte sich und fing an zu beten. Allerdings ließ der Nebelschieier der Erschöpfung, der um Luises Kopf immer dichter wurde, kaum ein Wort durchdringen. Doch für einen Moment verzog er sich und sie verstand: »Dottore, avanti!« Dann kam der Dunst zurück, umhüllte ihren Körper gänzlich, und sie schlief entkräftet ein.
Luise träumte von ihrem Vater. Bilder von Gut Wittenstein zogen wie Wolken am Himmel in diesem Traum vorbei. Sie hörte Anni singen und ihren Vater laut lachen. Plötzlich stand ihre Freundin Colette vor ihr und zog sie auf eine blühende Wiese. Dort breiteten sie ihre Arme aus und ahmten den Flügelschlag der Vögel nach. Lachend liefen nun ihr Vater, die Köchin Anni, Colette und Luise durch das Blumenmeer der Sonne entgegen. Überall summten die Bienen, und der Blütenstaub der Gräser wirbelte durch die Luft. Nichts trübte diesen warmen Sommertag. Ausgelassen tanzten alle über die Wiese und ließen sich lachend unter den Kirschbäumen nieder. Obwohl Luise mitten unter ihren liebsten Menschen war, fühlte sie sich einsam. Tränen der Verzweiflung brannten in den Augen. Als das Gefühl der Hoffnungslosigkeit sie zu erdrücken drohte, lächelte ihr Vater sie an. Voller Liebe war sein Blick, als er ihr seine Hand reichte und sie bat, mit ihm zu kommen. Zuerst sträubte sie sich. Als er ihr aber über das Haar streichelte und zärtlich flüsterte: »Hab’ keine Angst, mein kleiner Rebell. Vertraue mir!«, fühlte sie sich sicher und geborgen. Sie wollte gerade nach seiner Hand greifen, als sie unsanft zurückgerissen wurde. »Na, Signora, wer wird denn aufgeben wollen?«
Luise musste husten, da der Geruch des Riechsalzes in ihrer Nase brannte. Ihr Kissen war feucht, und sie spürte das Nass der Tränen schwer in ihren Wimpern hängen. Als sie langsam die Augen öffnete, saß ein fremder Mann auf der Bettkante und lächelte ihr aufmunternd zu. Fragend blickte sie ihn an. Dunkle Augen, die freundlich ihr Gesicht musterten, nahmen ihr die Angst vor dem Unbekannten.
»Wenn ich mich vorstellen darf? Mein Name ist Pedro Caesare, und ich stamme wie ihre Gastgeber aus Italien, genauer gesagt aus Rom.«
»Il dottore!«, fügte Giuseppe entspannt lächelnd hinzu.
»Richtig, Signore Zingale, ich bin Arzt, und ich hoffe, ich kann Ihnen helfen, Signora …?«
»Fairbanks, mein Name ist Luise Fairbanks«, keuchte sie, denn die Schmerzen kamen zurück.
Als sie abgeklungen waren, fragte der Arzt vorsichtig: »Darf ich Sie untersuchen, Mrs. Fairbanks?«
Luise konnte nur stumm nicken. Doktor Caesare schlug die Bettdecke zur Seite und tastete über ihrem Nachthemd den gewölbten Bauch vorsichtig ab. Die Bauchdecke war hart und gab unter den Fingern des Arztes, der versuchte, die Konturen des Kindes zu erfühlen, kaum nach. Er zählte ihren Puls und hörte mit einem Rohr die Herztöne des Kindes ab. »Wann soll der Geburtstermin sein?«
»Frühestens in sechs Wochen.«
Er nickte zustimmend. »Seit wann haben Sie die Schmerzen, Signora?«
»Schon längere Zeit. Aber seit drei Tagen werden sie stärker. Ich habe das Gefühl, als ob meine Bauchdecke zerreißen würde.«
Wieder nickte der Arzt. Behutsam tastete er nochmals den Bauch ab und horchte nach den Kindstönen. »Mrs. Fairbanks, wo ist der Vater des Kindes?«, fragte er mit ernster Miene.
»Warum? Ist etwas nicht in Ordnung? Ich bin verheiratet, falls Sie das meinen«, antwortete Luise energisch.
»Bitte, regen Sie sich nicht auf«, entschuldigte sich der Arzt, »ich zweifle nicht an Ihrer Ehrbarkeit. Es ist nur … ich muss eine Entscheidung treffen und hätte gerne mit Ihrem Mann darüber gesprochen.«
»Ich bin bei vollem Verstand und kann für mich selbst sprechen.«
Der Arzt gab ihr keine Antwort, sondern blickte zweifelnd.
Entkräftet stammelte sie: »Mein Mann ist noch in Australien. Er ist seit Monaten unterwegs.« Als Caesare sie verständnislos ansah, fügte sie hinzu: »Duncan ist auch Arzt und betreut die Sträflinge in den Gefängnissen.«
Das musste als Erklärung reichen, fand Luise. Sie hatte Angst, sich in Widersprüche zu verstricken oder Dinge preiszugeben, die niemanden etwas angingen.
Caesare schien zufrieden und fragte: »Wenn Ihr Mann ebenfalls Arzt ist, kennen Sie sich im medizinischen Bereich etwas aus, Signora?«
»Wenn Sie meinen, ob ich schon mal bei einer Geburt dabei war, ja, das war ich. Ich kann auch Zähne ziehen, und ich habe schon schlimmste Verletzungen gesehen, bei denen manch einer in Ohnmacht gefallen wäre.« Kurz dachte sie an Colette und die Wunden, die entflohene Gefangene ihr bei einem Überfall auf Duncans und Luises Weingut ›Second Chance‹ zugefügt hatte; an das viele Blut. Doch bevor sie weiter überlegen konnte, sagte der Arzt: »Wie ich höre, kann ich ehrlich zu Ihnen sein …« Weiter kam er nicht, da eine neue Wehe Luises Körper überrollte und ihr für einen Moment den Atem raubte.
»Mrs. Fairbanks, hören Sie mir bitte zu. Wenn wieder eine Wehe kommt, dürfen Sie auf keinen Fall die Luft anhalten. Sie müssen gleichmäßig weiteratmen.«
»Doktor Caesare, was stimmt mit meinem Kind nicht?«
Angst schimmerte in Luises wasserblauen Augen, unter denen dunkle, fast schwarze Schatten lagen. Als er antwortete, klang seine Stimme besorgt: »Das Kind hat sich für die Geburt noch nicht gedreht. Es will aber schon auf diese Welt. Keine Angst, es lebt. Aber ich weiß nicht, wie lange das kleine Wesen die Strapazen noch durchhalten kann.
Aber auch, wie lange Sie, Signora, die Schmerzen noch verkraften können. Ihr Körper zeigt Zeichen der Erschöpfung, und ihr Puls wird nach jeder Wehe schwächer. Als ich vorhin eintraf, glaubte ich schon, dass ich zu spät käme …«
Immer wieder musste er in seinen Erklärungen innehalten, da die Wehen in kürzeren Abständen kamen. Maria versuchte, Luise so gut es ging zu unterstützen. Sie wischte ihr erneut den Schweiß von der Stirn und hielt deren Hand, wenn der Schmerz zurückkam. Giuseppe Zingale hatte man des Raumes verwiesen. Er sollte sich um seine fünf eigenen Kinder kümmern, was ihm nur recht war.
»Bitte, helfen Sie mir, das Kind lebend und gesund zur Welt zu bringen«, flehte Luise leise.
»Mrs. Fairbanks, das Problem ist, dass wir keine Zeit mehr haben, um Sie ins Hospital zu bringen. Hätte ich nur geahnt, wie ernst ihre Situation ist, dann hätte ich wenigstens die Hebamme mitgebracht. Signora, ich bin ehrlich zu Ihnen. Die Überlebenschancen Ihres Kindes sind nicht sehr groß. Es kommt fast zwei Monate zu früh.«
»Ich will das alles nicht wissen«, schrie Luise mit letzter Kraft, »Ich will dieses Kind, Duncans Kind, lebend zur Welt bringen, und Sie werden mir dabei helfen. Ich weiß, worauf Sie hinauswollen, aber ich werde nichts einnehmen, und wenn ich vor Schmerzen wahnsinnig werde, dann soll es so sein. Aber ich werde nichts nehmen, was meinem Kind schadet.«
Feurig brannten ihm ihre Augen entgegen. Entschlossen wie eine Löwin, die ihr Junges verteidigt, genauso würde Luise ihr Ungeborenes beschützen.
Caesare blickte sie lange an. Ohne Widerrede respektierte er Luises Lebenswillen für sich und das Kind.
Er ging einige Schritte auf und ab und dachte nach. Dann sagte er zu Luise: »Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Signora, allerdings wird sie meines Wissens nach bis jetzt nur beim Tod der Mutter vorgenommen, um das ungeborene Kind zu retten. Und ich habe es noch nie praktiziert.« Fragend schaute sie zu ihm auf. »Ich schneide Sie!«, erklärte er und schluckte schwer an seiner eigenen Courage.
Erschrocken presste Maria die Hand auf den Mund und bekreuzigte sich mehrere Male. Luise wusste, was er meinte. Sie hatte darüber in einem von Duncans Arztbüchern gelesen.
»Aber dazu müssten Sie ein Schlafmittel nehmen, Signora«, meinte der Doktor ernst.
»Ich weiß. In meiner Tasche befindet sich eine kleine Flasche Laudanum. Das bin ich bereit zu nehmen.«
Caesare akzeptierte den Vorschlag und erklärte Luise die Einzelheiten des Eingriffes. Dann sagte er auf Italienisch etwas zu Maria. Diese holte Luises Tasche und gab ihr die kleine braune Flasche mit dem Betäubungsmittel. Luise trank die Flüssigkeit in kleinen Schlucken. Doktor Caesare nahm ein kleines silbernes Kästchen und fragte Maria etwas in ihrer Sprache. Diese antwortete ihm und zeigte dabei nach oben. Er nickte und seine schlaksige Gestalt verließ den Raum. Ein paar Minuten später kam er zurück und wusch sich gründlich die langen, feingliedrigen Hände.
Langsam spürte Luise, wie die Schmerzen nachließen und ihr Körper scheinbar leichter wurde. Ein warmes Gefühl breitete sich in ihrem Körper aus und ließ zu, dass sie sich entspannte. In diesem Moment sehnte sie sich so sehr nach ihrem Mann. Sie wünschte Duncan an ihre Seite, um ihre Hand zu halten. Sie wollte von ihm hören, dass alles gut werden würde. Aber Duncan war Tausende von Meilen entfernt, auf einem anderen Kontinent, und wusste nichts von ihren Ängsten. Luise betete inständig, dass er ihren Brief gefunden und gelesen hatte. Dass er sich auf das Kind freuen und ihnen bald folgen würde.
Als Luise sah, wie der Doktor die Instrumente bereitlegte, schnürte Furcht ihre Kehle zu. Um diese verdrängen zu können, müsste sie mit jemandem reden. Über ihre Ängste, ihre Wünsche und Hoffnungen. Aber mit wem? Maria und Giuseppe Zingale beherrschten ihre Sprache nicht gut genug. Doktor Caesare war mit den Vorbereitungen beschäftigt, und Kapitän Fraser und Peggy waren aus Kapstadt fortgesegelt.
Luise fühlte sich allein, hilflos und dieser Situation ausgeliefert. Am liebsten wäre sie aufgestanden und fortgelaufen. Das Blut rauschte in ihren Ohren, die Hände wurden feucht und der Mund trocken. Aber es gab kein Entrinnen. Diesen Weg musste sie alleine gehen. Plötzlich dachte sie an ihren Vater, der im Beten oft Trost und Ruhe gefunden hatte. Auch für Luise war der Glaube ein Bestandteil ihres Lebens gewesen. Doch hatte sie an Gott zu zweifeln begonnen, als der kleine Danny, der Sohn ihrer Londoner Freunde, an einer Erkältung gestorben war, ohne dass sie etwas hätte tun können. Als Jack brutal ermordet worden war, hatte sie begonnen, Gott zu hassen. Dann, als Colette – nach dem Überfall völlig traumatisiert – weggelaufen und verschwunden blieb, wollte sie von Gott nichts mehr wissen.
Luise spürte, wie sie langsam in das Dunkel der Bewusstlosigkeit glitt. Sie sah das Skalpell in der Hand des Arztes aufblitzen. Bevor sie das Schwarz der schmerzfreien Nacht vollends umhüllte, tat sie das, was sie nie wieder tun wollte, und schrie mit letzter Kraft: »Lieber Gott, hilf mir und meinem Kind!« Dann wirkte das Laudanum, und Luise spürte nicht mehr, wie das Messer ihre Bauchdecke zerschnitt.
Kapitel 2
Auf der ›Miss Britannia‹, 28. August 1793
Langsam wurde der Tag von der Nacht abgelöst. Wolkenloser Himmel und Flaute hatten den Menschen auf der ›Miss Britannia‹ einen ungewohnt heißen Tag beschert. Einen dieser Tage, die Luise schon auf der Hinreise gehasst hatte. Wie damals stand sie auf Deck und hoffte, dass sich mit der Abenddämmerung die Luft abkühlen und ihr Erleichterung bringen würde.
Die ›Miss Britannia‹ befand sich auf Höhe von Südafrika und sollte den Hafen von Kapstadt anlaufen. Aber noch war der Kontinent nur als dünner Fadenstrich in der Ferne zu erkennen.
Seit über einem Vierteljahr segelte Luise auf diesem Schiff in Richtung England. Mit den drei Monaten, die Duncan vor ihrer Abreise schon weg war, hieß das, dass sie seit über sieben Monaten nichts mehr von ihrem Ehemann gehört hatte. Doch egal, wie lange die Trennung bereits dauerte und auch noch dauern würde, nicht nur täglich oder stündlich dachte sie an ihren Mann, nein, nicht eine Minute verstrich, in der sie sich nicht mit jeder Faser ihres Körpers nach Duncan sehnte. Der Schmerz im Herzen war so gewaltig, dass er ihre Seele zerschnitt. Was würde er gerade tun? Würde er sie vermissen? War er vielleicht schon auf dem Weg zu ihr? Immer wieder beschäftigten sie diese Fragen, auf die es keine Antwort gab. Ihr blieb nur die Hoffnung, die manchmal größer wurde und ihr ein Gefühl der Euphorie bescherte, dann aber plötzlich gänzlich schwand und sie verzagen ließ. Oft war Luise froh, wenn es endlich Schlafenszeit war und sie nicht mehr nachdenken musste. Aber häufig verfolgten sie Angst und Sehnsucht bis in ihre Träume. So verbrachte sie manche Nacht wach liegend und grübelnd in ihrer Koje.
Ihre Schwangerschaft war nun weit vorgeschritten. Sie spürte die Bewegungen ihres Kindes und hoffte, dass es gesund war. So sehr sie sich auch über das Baby freute, so bereitete ihr der Zustand auch großes Unbehagen. Abgesehen von der ständigen Übelkeit, deren Schuld Luise aber mehr der Hitze und dem Schaukeln des Schiffes zuschrieb, beunruhigten sie schon seit längerem leichte Krämpfe, die wellenartig durch ihren Körper liefen, mal stärker, mal schwächer. Oft verschlimmerte die kleinste Bewegung die Schmerzen. Deshalb verbrachte sie seit fast drei Wochen die meiste Zeit im Bett. Dadurch war sie von den übrigen Mitreisenden abgesondert. Allerdings – mit Abstand betrachtet – musste Luise sich eingestehen, dass ihr das nicht unrecht war. Sie ahnte, dass sie durch ihre Reise ohne Begleitung und durch Frasers Fürsorglichkeit den Unmut der Mitreisenden auf sich zog und dadurch Anlass zum Tratsch gab.
Schon von Anbeginn der Seereise an war sie für die übrigen Passagiere eine Person, die ein Geheimnis umgab. Oft bemerkte Luise das Tuscheln hinter ihrem Rücken. Als Schwangere, allein reisende Frau, über die man nichts wusste und die auch nichts von sich preisgab, hatte sie für Gesprächsstoff auf der langen Reise gesorgt, auf der nicht viel passierte. Aber es war Luise einerlei. Sie hatte weder Veranlassung, sich für ihr Fehlen zu entschuldigen, noch ihre Situation fremden Menschen zu erklären. Nicht einmal mit Kapitän Fraser hatte Luise über die vergangenen Monate und das Leben in Australien sprechen können. Zu schwer war ihr Herz. Zu traurig waren ihre Erinnerungen daran, und deshalb machte ihr das Alleinsein nichts aus.
Sie genoss es, bei Dunkelheit allein an der Reling zu stehen, um ihren Gedanken nachzuhängen und den kühlen Abendwind zu spüren. Trotzdem freute sie sich, wenn sich Kapitän Fraser zu ihr gesellte und sie mit Geschichten von ihren Sorgen ablenkte.
Ihr Entschluss, Australien zu verlassen, erschien ihr nach wie vor richtig, auch wenn ihr jetzt Zweifel an den Gründen kamen. Aber der Verlust ihrer geliebten Freundin Colette schmerzte wie am ersten Tag. Auch, dass sie Friedensrichter Steel stets im Nacken gespürt und nie gewusst hatte, was er im Schilde führte. Durch Duncans Abwesenheit war sie ihm schutzlos ausgeliefert gewesen, und dies hatte ihre Furcht verstärkt.
Die Sorge um ihr Ungeborenes war ein weiterer Grund gewesen, alles hinter sich zu lassen. Doch heute, mit Abstand betrachtet, erschien ihre Entscheidung nicht mehr so klar und logisch. Vielleicht hatte sie überreagiert und Gefahr vermutet, wo gar keine war. Die Schwangerschaft hatte sie emotional reagieren und handeln lassen. Mit ihrer Freundin Elisabeth an der Seite hätte sie sich wahrscheinlich keine Sorgen machen müssen und die Zeit unbeschadet überstanden, bis ihr Mann zurückgekommen wäre. Luise überlegte, ob sie möglicherweise übereilt die Fahrkarte gekauft, das Nötigste zusammengepackt und Australien hinter sich gelassen hatte. Sie musste sich eingestehen, dass ihre Abreise nicht einmal sorgfältig geplant gewesen war. Aber dann tröstete sie sich mit dem Gedanken, dass Elisabeth sie in ihrer Entscheidung bestärkt hatte. Als sie sich zusätzlich das Gesicht eines Mannes vorstellte, verschwanden ihre Zweifel. Friedensrichter Steel.
Luise lief ein Schauer über den Rücken, wenn sie an ihn dachte. Die Erinnerung an den Empfang bei den Attkins in Australien ließ ihre Gedanken in die Vergangenheit schweifen.
Es war der Abend, der ihrem Leben eine neue Wende gegeben und sie an der Gerechtigkeit Gottes hatte zweifeln lassen.
Die Amtseinführung von Friedensrichter Steel war damals der Anlass zu dieser Dinereinladung gewesen. Friedensrichter Hopkins, Steels Vorgänger, war ermordet worden, und Steel, der durch seine Verhörmethoden in London in Ungnade gefallen war, war nach Australien versetzt worden. Niemals hätten Luise oder Duncan daran gedacht, ihn wieder zu sehen. Doch ihr Schicksal hatte anders entschieden.
Alle wichtigen Personen waren von Josefine und Edward Attkins eingeladen worden, um den neuen Friedensrichter kennen zu lernen und willkommen zu heißen.
Luise durchlebte noch einmal die Schreckminuten von damals. Ihre Übelkeit, die vielen Menschen, der Qualm und auch die Angst, dass Steel sich an sie erinnern könnte, waren Gründe gewesen, dass sie sich an diesem Abend unwohl gefühlt hatte. Sie war nach draußen gegangen, um frische Luft zu schnappen. Da Duncan ihr etwas zu trinken holen wollte, stand sie allein auf der Terrasse und genoss den warmen Abendwind, der leise mit den Blättern der Bäume spielte. Doch plötzlich war der Geruch von Schweiß und billigem Parfüm zu ihr herübergeweht. Bevor sie ihm in die Augen geblickt hatte, hatte sie bereits gewusst, dass der Friedensrichter ihr gefolgt war. Doch sie hatte nur einen kurzen Moment gebraucht, um sich wieder zu beruhigen. Gleichgültig hatte sie ihn bei der persönlichen Begrüßung angesehen. Jedoch hatte sie nicht erkennen können, ob er sich an sie erinnerte.
Das erste Mal waren sie sich bereits in London begegnet. Steel war für die Verfolgung der Organisation ›Weiße Feder‹ verantwortlich gewesen, in der auch Luises Halbbruder Bobby Mitglied war. Dieser war verhaftet worden, und Luise hatte sich von Steel nähere Auskünfte über Bobbys Aufenthaltsort erhofft. Schon damals fand sie sein aufgedunsenes, vernarbtes Gesicht unsympathisch. Seitdem war sein Leibesumfang noch mehr gewachsen. Auch an diesem Abend hatten Schweißperlen seine Stirn bedeckt, und sein Gesicht war ungesund gerötet gewesen. Das moosfarbene Jackett, das vorzüglich zu seinen froschgrünen Augen passte, hatte über dem Bauch gespannt und war am Revers mit dunklen, unappetitlichen Flecken verschmutzt gewesen. Nichtsdestotrotz hatte er ein Selbstbewusstsein versprüht, das schon beinahe bewundernswert gewesen war. Seine Augen hatten Luise aus zusammengekniffenen Sehschlitzen gemustert. Seine Hände hatte er unhöflich in den Taschen seines Sakkos vergraben, und er war selbstgefällig auf und ab gewippt.
»Ah, Mrs. Fairbanks, oder sollte ich lieber sagen, Fräulein von Wittenstein? Sie glauben doch hoffentlich nicht, dass ich Sie nicht wieder erkannt hätte …«
Diese Unterredung hatte Luise mehr Kraft gekostet, als sie jemals für möglich gehalten hätte. Unverblümt hatte er ihr seine Meinung gesagt und ihr ohne Mitleid, sondern mit unglaublicher Schadenfreude mitgeteilt, was Duncan und sie schon geahnt hatten. Ihr Freund Jack Horan war wegen nicht fundierter Anklagepunkte in London an den Pranger gestellt und trotz Wachposten erschlagen worden.
Als Steel sich über den toten Horan auslassen wollte, war Duncan hinzugekommen und hatte Luise den traurigen Rest erspart. Bei der Vorstellung, dass Jack hatte leiden müssen, weil er sie beide hatte schützen wollen, hätte Luise am liebsten laut geschrien und auf den Friedensrichter eingeschlagen. Aber Duncan und sie hatten Haltung bewahren müssen. Ihr eigenes Geheimnis, dass nicht Jack Horan, sondern Duncan Fairbanks Anführer der ›Weißen Feder‹ war, hatte gewahrt bleiben müssen. Aber für beide war offensichtlich gewesen, dass Steel bei Jacks Tod die Finger mit im Spiel gehabt hatte.
An diesem Tag, als sie Steel auf dem australischen Kontinent wieder getroffen hatten, war alles zusammengekommen. Sträflinge der übelsten Sorte waren aus dem berüchtigten Gefängnis Neverland ausgebrochen. Dieser Ausbruch und dessen Folgen hatte Luises Lebensweg verändert, der nun so ganz anders verlaufen würde, als sie es sich erträumt hatte.
Luise schüttelte den Kopf, um die Erinnerungen aus ihren Gedanken zu verbannen. Sie konnte die Vergangenheit nicht ungeschehen machen und durfte sich nicht länger damit beschäftigen. Sie musste nach vorne schauen. Schließlich hatte sie die Verantwortung für ihr Kind zu tragen und musste ihrer beider Zukunft planen.
Viele Fragen beschäftigten Luise, auf die sie eine Antwort finden musste. So zum Beispiel, wovon sie leben sollte, bis auch Duncan nach England kam. Zwar hatte er ihr vor seiner Abreise genügend Geld auf der Farm zurückgelassen, um die dortigen täglichen Ausgaben decken zu können. Davon jedoch hatte Luise ihre Fahrkarte bezahlt und etwas Bares genommen, um die ersten Wochen zu überbrücken. Den Rest hatte sie Joanna und Paul Mc Arthur anvertraut, die als Verwalter das Weingut ›Second Chance‹, das Duncan und Luise sich in Australien aufgebaut hatten, wie ihr eigenes leiten würden.
Aber was, wenn ihr Geld aufgebraucht war? Was, wenn Duncan nicht sofort nachkam und sie einige Zeit alleine zurechtkommen müsste? Bedenken, dass Duncan etwas zugestoßen sein könnte, ließ Luise gar nicht erst aufkommen, sondern begrub sie in der Tiefe ihrer Gedankenwelt. Trotzdem musste sie darüber nachsinnen, wovon sie und ihr Kind leben sollten. Auch, wohin sie gehen sollten, wenn sie England erreicht hatten. Sollte sie mit ihrem Kind nach Deutschland Weiterreisen? Sicher würden sich Tante Margret, Onkel Fritz und all die anderen freuen, sie nach so langer Zeit wieder in die Arme schließen zu können. Auch Luise sehnte ein Wiedersehen herbei. Aber ebenso hatte sie Angst, ihnen alles zu erzählen. Was würden sie sagen, wenn sie ohne Colette zurückkäme? Würde man ihr die Schuld an deren Verschwinden geben? Sie verurteilen? Denn schließlich war Colette nur ihr zuliebe im Januar 1791 mit nach England aufgebrochen, um Luises tot geglaubten Bruder zu suchen. Es war unglaublich, was seitdem alles passiert war …
Laut seufzte sie und atmete tief durch. Erst jetzt nahm sie den zarten Vanilleduft des Pfeifentabaks von Kapitän Fraser wahr. Sie drehte sich um. Da stand er. Die Pfeife zwischen den Zähnen, die Hände hinter seinem Rücken verschränkt, blickte er sie freundlich an. Trotz des schwindenden Sonnenlichtes konnte sie sein Gesicht klar erkennen und bemerkte wieder einmal seine vielen Lachfalten um die Augenwinkel. Wie tief eingegrabene Furchen zogen sie sich bis zu seinem Haaransatz. Seine Haut war dunkel gebräunt, wodurch seine Augen noch blauer und leuchtender erschienen. Er hatte seine silbergrauen Haare frisch gekürzt und mit Haarwasser zurückgekämmt. Sein Kinn war glatt rasiert. Fraser wirkte in der Resthitze des Tages sauber, entspannt und zufrieden. Beinahe beneidete sie ihn.
»So schwer ums Herz?«, fragte er lächelnd.
Luise blickte ihn traurig an und nickte. Schweigend sahen beide aufs offene Meer, bevor Luise leise erklärte: »Ich habe gerade daran gedacht, was mich zu Hause erwarten wird. Über zwei Jahre war ich fort. In der Zwischenzeit ist viel passiert.«
Fraser sah ebenfalls weiter aufs Meer, sagte und fragte nichts, denn er wollte sie nicht drängen und auch nicht neugierig erscheinen. Wie unbeteiligt paffte er an der Pfeife. Jedoch glaubte er zu spüren, dass sie heute etwas von dem erzählen würde, was sie schon seit ihrem Wiedersehen zu belasten schien.
Als er sie am Tag der Abreise vor sich hatte stehen sehen, hatte er sofort gewusst, dass sie etwas Schreckliches erlebt haben musste.
Sie hatte so anders gewirkt als während ihres letzten Treffens vor über einem Jahr. Es war damals im Hafen von Sydney gewesen, kurz vor dem Auslaufen der ›Miss Britannia‹. Damals hatte sie hoch zu Ross den Eindruck gemacht, als könnte sie nichts erschüttern. Luise, ihr Mann Duncan und ihre Freundin Colette hatten die nähere Umgebung erkunden wollen. Fraser war von Bord gegangen und hatte sie am Kai getroffen. Dieser kurze Moment hatte sich in sein Gedächtnis eingeprägt: das Bild einer jungen, lebenslustigen Frau, die voller Tatendrang ihr neues Leben erwartete.
Auf der langen Hinreise hatten sie viel Zeit für Gespräche gehabt. Luise wäre die Tochter gewesen, die er sich immer gewünscht hatte, die ihm aber verwehrt geblieben war.
Als Fraser ihren Namen vor der Abreise auf der Passagierliste gelesen hatte, hatte er sich sehr auf das Wiedersehen gefreut. In der Erinnerung hatte er sie vor sich gesehen wie damals: Luise auf der Fuchsstute mit diesem seltsamen Sattel, gekleidet in einer cremefarbene Bluse, die ihre Gesichtsbräune unterstrich, die langen Haare im Nacken zusammengebunden. Voller Energie und mit blitzenden Augen. Strahlend schön.
Er hatte sich so sehr gewünscht, sie froh und glücklich anzutreffen. Aber blass war ihr schmales Gesicht, mit dunklen Schatten ihre sonst so blinkenden, blauen Augen umrahmt. Augen, in denen sich scheinbar das ganze Elend dieser Welt widerspiegelte. Ohne Glanz ihre blonden Haare und fast schon erschreckend dünn ihre Gestalt, von einem schwarzen Kleid verhüllt.
Selten schenkte sie ihm ein Lächeln. Und wenn doch, dann verschleierte sich schnell wieder ihr Blick, und man sah Tränen schimmern.
Luise hatte einen unsichtbaren Schutzwall um sich gezogen, den Fraser bislang nicht zu durchstoßen vermocht hatte. Aber heute schien die Mauer zu bröckeln, und er wollte ihr helfen, sie gänzlich einzureißen. »Freuen Sie sich wenigstens ein kleines bisschen auf zu Hause?«
Ernst schaute sie ihn an, bevor sie ihn fragte: »Zu Hause? Wo wird das sein?«
Fraser zog ein paar Mal an seiner Pfeife und meinte dann: »Mit dem Zuhause ist es wie mit der Heimat. Beides kann man auf keiner Landkarte finden, nur in seinem eigenen Herz. Auch in den Herzen der Menschen, die einen heben und die man selbst hebt. Es ist nicht nur dort, wo man geboren wurde, wo die Wurzeln eines jeden sind. Ich glaube, dass man das Stück Heimat überall mit hinnehmen und ein Zuhause neu gründen kann. Ich finde, beides ist immer dort, wo man sich wohl fühlt. Wo hebe Menschen warten. Dort, wo ein vertrauter Geruch in die Nase steigt und ein Lächeln auf die Lippen gezaubert wird. Auch dort, wo man gewärmt wird, obwohl das Feuer im Ofen aus ist. Wo man eine Tür öffnet und weiß, dass man angekommen ist. Dort, wo die Sehnsucht einen hintreibt, egal, wie weit man entfernt war«, erklärte er sanft.
»Sie meinen, der Name des Ortes spielt keine Rolle, nur das Gefühl im Herzen ist wichtig?«
Er nickte zustimmend: »Ja, Mrs. Luise, so kann man es auch ausdrücken.«
»Und wenn man Angst hat, nach Hause zu kommen, weil man befürchtet, dass man seinen Liebsten Leid zugefügt hat? Dass man vielleicht nicht mehr geliebt wird? Ist es dann nicht das richtige Zuhause?«
»Ich denke, vor dem wahren Zuhause muss man keine Angst haben. Vielleicht erwartet einen mal ein Donnerwetter, so wie mir das ab und zu passiert. Manchmal kann ich den versprochenen Ankunftstermin aufgrund schlechten Wetters nicht einhalten. Dann habe auch ich Angst heimzukommen, weil ich weiß, was mich dort erwartet.« Er lachte verschmitzt, als er an seiner Pfeife zog.
»Was kann Sie schon Schlimmes erwarten? Schließlich haben Sie keine Schuld daran, wenn Naturgewalten Sie aufhalten.«
»Das machen Sie bitte meiner Frau klar. Sie ist nämlich über alle Maßen eifersüchtig und glaubt mir nicht, dass uns ein Unwetter oder sonst eine Misere aufgehalten hat.«
»Ich wusste nicht, dass Sie verheiratet sind. Warum haben Sie das verschwiegen? Lebt Ihre Frau auch in England?«, wollte Luise erstaunt wissen.
»Die meisten Menschen denken, dass das Schiff die einzige Liebe eines Seemannes ist. Doch auch wir brauchen ein festes Heim, zu dem wir immer wieder zurückkehren können. Ich habe meine Esmeralda nicht mit Absicht verschwiegen. Es gab keinen Anlass, sie zu erwähnen. Wir sind schon neunzehn Jahre verheiratet und wohnen auf Teneriffa. Meine Frau liebt die Sonne und das Wasser, aber auf einem Schiff will sie trotzdem nicht leben. Sie ist Spanierin und, wie Sie sich vorstellen können, so temperamentvoll, wie man es den Spaniern nachsagt. Das letzte Mal hatte ich Verspätung, weil die Fock gerissen war. Wir mussten außerplanmäßig einen Hafen anlaufen. Nach fast zwei Wochen über der Zeit war ich so froh, endlich zu Hause zu sein. Aber das Erste, was ich sah, war der Blumentopf, den Esmeralda vom Balkon vor meine Füße warf. Dann war die Tür verschlossen. Alles Flehen half nichts. Ich möchte die Worte nicht wiederholen, die meine Frau mir entgegenschleuderte. Obwohl sie auf Spanisch sehr charmant klingen. Also zog ich in eine Pension, bis sich die Wogen wieder geglättet hatten«, lachte er.
»Wenn Ihre Frau so reagiert, ist es ein Liebesbeweis. Nur was ist, wenn Sie Angst haben, weil Sie etwas Furchtbares getan haben? Etwas, wobei ein anderer zu Schaden gekommen ist?« Luise wandte den Kopf wieder zum Meer, denn sie spürte Tränen in den Augen aufsteigen.
Fraser sah zärtlich zu ihr und versuchte, sie sanft zu locken: »Mrs. Luise, ich möchte nicht indiskret sein, aber Sie müssen mir das ein wenig genauer erklären, wenn ich Ihnen darauf eine Antwort geben soll.«
Sie sah wieder zu ihm, und sein Herz krampfte sich bei ihrem Blick zusammen. Oh, Mädchen, was ist nur passiert?, dachte er.
Fraser wusste nicht, was er tun sollte. Am liebsten hätte er sie tröstend in den Arm genommen. Aber er befürchtete, dass sie sich wieder in ihr Schneckenhaus zurückziehen würde.
Doch dann fing Luise leise an zu erzählen. Sie wusste, dass sie ihm vertrauen konnte. »Meine Freundin Colette ist wahrscheinlich tot. Sie ist vor mehr als vier Monaten verschwunden«, berichtete sie ihm stockend.
Kapitän Fraser hatte bei dieser Nachricht für einen Augenblick die Augen geschlossen. Das hatte er nicht geahnt. Colettes Gesicht tauchte in seinen Gedanken auf. Ihre haselnussbraunen Augen, die meist ernst und schüchtern blickten. Ihre dunkelbraunen Haare, die sie selten offen trug, sondern zu einem weichen Knoten im Genick gebunden hatte. Colette war eine zarte, ruhige Person gewesen. Unauffällig, aber von eigenem Charme, wenn sich ihre französische Muttersprache einschlich. Sie hatte stets Angst, sich zu blamieren, und schimpfte mit Luise, wenn diese sich über ihre Scheu lustig machte. Als Luise und Colette an Bord gekommen waren, waren sie so unverdorben und ehrlich. Sie hatten nichts Hinterhältiges an sich gehabt und hätten nie gewagt, etwas Schlechtes über eine dritte Person zu sagen. Sie waren etwas Besonderes auf seinem Schiff gewesen.
Es tat ihm Leid, dass dieses Mädchen nicht mehr unter ihnen weilen sollte. »Möchten Sie mir erzählen, wie es dazu gekommen ist?«, fragte er vorsichtig.
»Ja, denn ich fühle mich schuldig, und ich bin froh, endlich jemandem davon erzählen zu können«, vertraute sich Luise ihm leise an.
Starr sah sie über die Reling in die Ferne. Die Hände lagen ineinander verkrampft auf dem glatten Holz. Sie berichtete Fraser von Colettes Sehnsucht nach Europa und ihrer spät erkannten Liebe zu dem Anwalt und Freund aus England, Jack Horan. Davon, dass Colette eines Abends allein zu Hause geblieben war, da Luise und Duncan zu der Amtseinführung von Friedensrichter Steel eingeladen waren. Dass in dieser Zeit Colette überfallen, auf bestialische Weise missbraucht und schwer verletzt worden war. Dass die Verbrecher auf die Insel Vandiemensland geflohen waren und Duncan schon seit Monaten die Polizisten begleitete, die die Straftäter dort verfolgten. Luise erklärte Fraser, dass ihre Freundin Wochen nach dem Überfall zwar körperlich genesen, ihre Seele aber krank geblieben war und sie aufgehört hatte zu sprechen. Dass Luise zu Colettes Herzen keinen Zugang mehr hatte finden können und das Zusammenleben schwierig geworden war. Erst recht, als Colette herausgefunden hatte, dass Luise ihr über Monate den gewaltsamen Tod von Jack Horan verheimlicht hatte, um ihrer Freundin den Schmerz zu ersparen. Flüsternd sprach Luise die letzten Worte: »Colette verließ eines Nachts das Haus und kam nicht wieder. Man fand ihren Schal bei den Klippen.« Bedrückende Stille war auf einmal um sie. »Erinnern Sie sich noch an die Geschichte von Colettes Traum vom Fliegen und dass sie schon als Kind ein Fluggerät gebaut hat? Wir haben sie Ihnen an einem unserer letzten Tage auf dem Schiff erzählt.«
»Natürlich erinnere ich mich an diese Geschichte. Ich erinnere mich an alle Geschichten, die Sie beide mir erzählt haben. Schließlich haben Sie mir meinen tristen Alltag an Bord versüßt«, meinte der Kapitän.
Luise lächelte kurz, dann wurde sie wieder ernst. »Ich denke, dass Colette frei sein wollte von allen Zwängen und Ängsten. Vielleicht wollte sie einmal ihren Traum leben. Einmal fliegen wie ein Vogel.«
Fraser schüttelte fassungslos den Kopf. »Glauben Sie, dass Miss Colette tatsächlich …?«, fragte er betrübt.
Luise zuckte bekümmert die Schultern.
»Ich kann nicht beschreiben, wie Leid mir das tut. Es ist tragisch, zumal Sie sich wie Schwestern nahe standen. Keine Worte können solch einen Verlust mindern oder trösten. Aber warum fühlen Sie sich schuldig? Für all dies tragen Sie keine Schuld, Mrs. Luise. Das, was ihre Freundin Colette tat, tat sie freiwillig.«
»Ich weiß, dass Sie das nicht verstehen können, Kapitän Fraser. Aber Sie dürfen nicht außer Acht lassen, dass Colette meinetwegen mit nach England und schließlich nach Australien gekommen ist. Jeder hat mir von meinem Vorhaben abgeraten. Aber ich hatte nichts davon hören wollen, deshalb hat Colette sich verpflichtet gefühlt, mit mir zu gehen. Man hatte mich vor den Gefahren gewarnt, aber es war mir egal gewesen. Ich habe nur an mich gedacht. An mich und meinen Plan, meinen Bruder zu finden. Ich ging sogar eine Ehe mit einem Unbekannten ein, weil ich nur ein Ziel verfolgt habe, nämlich meines. Ich glaubte, dass, wenn ich Duncan Fairbanks heirate, es einfacher wäre, weil wir dann als Eheleute reisen würden …«
Jetzt fügte sich alles zusammen, und Fraser verstand auf einmal. Auf der Hinreise konnte er sich keinen Reim auf das Ehepaar machen. Von der ersten Minute an hatte er sich seine Gedanken über Luise und Duncan Fairbanks gemacht. In Gesellschaft anderer schienen sie vertraut und einander zugetan. Doch kleine Gesten hatten verraten, dass dies nicht der Fall sein konnte. Allein war Luise stets fröhlich und guter Dinge. Sobald Fairbanks jedoch in ihre Nähe gekommen war, hatte sich Luises vorher lächelndes Antlitz verschlossen, und ihr Mund war eine dünne, harte Linie geworden.
»Wie geht es Ihrem Mann? Wird er in Australien bleiben?«, fragte Fraser ungezwungen und stopfte sich dabei seine Pfeife neu.
Endlich erhellte ein Lächeln Luises Gesicht, und sie geriet ins Schwärmen: »Sicher haben Sie damals bemerkt, dass unsere Beziehung auf sehr wackligen Beinen stand. Eigentlich auf gar keinen. Wie ich Ihnen bereits gestanden habe, hatten wir erst kurz vor der Abfahrt geheiratet und uns nur sehr vage gekannt. In Australien sind wir uns näher gekommen, und ich habe mich in meinen eigenen Mann verliebt. Ist das nicht komisch, Kapitän Fraser? Ich habe erkannt, dass Duncan ein wunderbarer Mensch ist. Er hat uns ein Heim geschaffen und Rebstöcke aus Deutschland von meinem elterlichen Weingut kommen lassen. Nur, damit ich etwas Vertrautes in der Fremde habe. Ja, wir haben ein schönes Leben geführt. Bis zu dem schrecklichen Überfall auf Colette. Danach ist Duncan mit den Soldaten nach Vandiemensland gereist, um die Verbrecher zu verhaften. Wir beide glaubten, dass er höchstens ein paar Wochen weg sein würde. Dann passierte das Unvorhersehbare. Ich glaubte, nach Colettes Verschwinden wahnsinnig zu werden. Ich konnte nichts mehr essen. An Schlaf war nicht zu denken, und Duncan war nicht zu erreichen. Was sollte ich tun? Zum Glück hatte ich Elisabeth, ich meine Mrs. Anderson, an meiner Seite. Sie stimmte mir zu, dass ich sofort nach England aufbrechen sollte, allein schon wegen des Kindes. Ich ließ meinem Mann einen Brief zurück, der alles erklärt. Ich hoffe, dass er mir bald folgen wird, denn ich vermisse ihn«, gestand sie ohne Scheu.
»So, so, Mrs. Anderson hat Ihnen zu dieser überstürzten Abreise geraten.« Wieder hing Fraser seinen eigenen Gedanken nach. Er konnte sich noch gut an Elisabeth Anderson erinnern.
Kupferrote Haare, die sich wie Glut über ihre elfenbeinfarbenen Schultern ergossen. Grüne, leicht schräg gestellte Augen gaben ihr etwas Katzenhaftes. Sie blieb für viele Männer der unerfüllte Traum, denn sie war verheiratet.
Trotzdem ließ sie keine Gelegenheit aus, um zu flirten, und Opfer gab es genug. Allerdings wusste sie genau, wie weit sie gehen durfte. Obwohl Fraser sich nicht sicher war, ob diese Grenze nicht wie flexibler Kautschuk war. So manch einer hätte dafür Verständnis gehabt, wenn sie diese Grenze überschritten hätte. Ihr Mann Thomas Anderson war ein Säufer, der lieber seine Zeit unter Deck mit einer Whiskyflasche anstatt mit seiner hübschen Frau verbrachte. Fraser erinnerte sich an ein Gespräch, das er zufällig auf der Hinreise mit angehört hatte. Es war kurz nach Mitternacht gewesen. Die ›Miss Britannia‹ war schon über eine Woche auf See gewesen. Luises Ehemann, Duncan Fairbanks, und Mrs. Anderson hatten versteckt hinter der Takelage auf Deck gestanden und sich zwar leise, aber voller Emotionen unterhalten. Unbemerkt hatte Fraser einige Wort verstehen und schlussfolgern können, dass Mrs. Anderson und Mr. Fairbanks sich nicht erst auf dem Schiff kennen gelernt hatten, sondern schon sehr viel früher. Vor allem, dass sie sich besonders gut gekannt hatten. Deshalb befürchtete Fraser, dass Elisabeths scheinbar gut gemeinter Ratschlag, Luise solle nach London reisen, nicht so selbstlos gewesen war.
»Wie meinen Sie das mit Mrs. Anderson?«, fragte Luise irritiert.
»Entschuldigen Sie, Mrs. Luise, wenn ich Sie ins Grübeln gebracht habe. Ich war nur etwas verwundert, da Sie anscheinend innigen Kontakt zu dem Ehepaar Anderson pflegen. Ich war der Ansicht, dass Sie die Dame nicht besonders mögen«, versuchte Fraser lapidar zu erklären, um so seine eigene Meinung nicht preisgeben zu müssen.
»Anfangs war es auch so«, gab Luise ehrlich zu, »schließlich war Mrs. Anderson eine enge Bekannte meines Mannes aus früheren Zeiten. Aber auf einem fremden Kontinent, wo es nicht viele Freunde gibt, rückt man eben etwas näher zusammen und lässt die Vergangenheit ruhen. Zumal mir mein Mann versichert hat, dass ich mir keine Gedanken machen muss. Sie verstehen, was ich meine?«
Kapitän Fräser nickte und war erleichtert, dass Duncan anscheinend offen zu Luise gesprochen hatte. Er hoffte nur, dass Elisabeth genauso ehrlich war. Allerdings ließen ihn der Tonfall ihrer Worte damals und das aufreizende, kehlige Lachen daran zweifeln. Beschwichtigend meinte er jedoch: »Aus einer Notsituation heraus haben Sie einen fremden Mann geheiratet. Später haben Sie beide Gefühle füreinander entwickelt. Das nenne ich Liebe.«
Luises Gesicht strahlte bei seinen Worten, was Frasers Seele erwärmte. Er paffte wieder ein paar Züge an seiner Pfeife und meinte dann: »Mrs. Luise, ich bin froh, dass Sie mir alles erzählt haben, und ich hoffe, dass Ihr Herz nun nicht mehr so schwer an dieser Last trägt. Doch glaube ich nicht daran, dass irgendjemand Ihnen die Schuld an dem Geschehenen geben wird. Miss Colette ist diesen Weg freiwillig und alleine gegangen. Was passiert wäre, wenn Sie in England geblieben wären, das weiß allein nur unser Herrgott. Gehen Sie mit ruhigem Gewissen zurück zu Ihrer Familie und warten Sie dort auf Mr. Fairbanks. Dann wird alles wieder gut.«
Luise sah Kapitän Fraser erleichtert an. Eine schwere Bürde schien von ihren Schultern genommen zu sein. Sie umarmte ihn und flüsterte: »Danke!« Dann ging sie in ihre Kajüte und schlief das erste Mal seit langem ohne Tränen ein.
Zwei Tage später, man konnte endlich die Hafeneinfahrt von Kapstadt sehen, wurden die Schmerzen bei Luise heftiger. Sie war kaum in der Lage, ihr Bett zu verlassen. Als sie der Schiffsjunge, der ihr täglich das Essen in der Koje servierte, wimmernd vorfand, waren schon mehrere Stunden voller Qualen vergangen. Er verständigte sofort den Kapitän, der sie in Begleitung des Schiffsarztes aufsuchte. Dieser erinnerte Luise jedoch mehr an einen Viehdoktor und schien von schwangeren Frauen genauso wenig Ahnung zu haben wie Luise vom Steuern eines Schiffes.
Er meinte lediglich, dass es für alle das Beste wäre, wenn Luise schnell an Land käme. Leise fragte Fraser ihn etwas, aber der Doktor zuckte hilflos mit den Schultern. Dann verabschiedete er sich hastig, da ihm die stöhnende Frau Angst machte. Auch der Kapitän verließ die Koje, aber nicht, ohne Luise aufmunternd zuzulächeln. Diese blickte ihm ängstlich hinterher. Keine halbe Stunde später klopfte es an Luises Tür, und Fraser kam mit einer jungen Frau zurück. Er stellte sie als Mrs. Peggy Reeves vor, die mit ihrem Mann nach England unterwegs war.
Luise hatte sie einige Male aus der Entfernung gesehen, aber nie mit ihr gesprochen. Zweifelnd sah sie zu Mrs. Reeves.
Die junge Frau bemerkte ihren abschätzenden Blick und meinte lächelnd: »Siebzehn, ich bin siebzehn Jahre alt.«
Luise lächelte zurück und entschuldigte sich für ihre Neugierde.
»Das ist schon in Ordnung. Sicher denken Sie, dass ich noch zu jung bin. Aber als Kapitän Fraser Ihre Lage erklärte, war keine der übrigen, reiferen Damen bereit, nach Ihnen zu sehen. Da ich das Älteste von neun Kindern bin, glaube ich, dass ich für Ihre Betreuung geeignet bin. Zumal meine jüngste Schwester erst ein Jahr alt ist. Mein Mann ist derselben Meinung, und hier bin ich.«
Luise tat die unkomplizierte Art des Mädchens gut. Allein die Gewissheit, nicht mehr allein zu sein, linderte ihre Furcht. Mrs. Reeves half Luise, sich zu waschen und anzukleiden. Als die Schmerzen erneut kamen, zeigte die junge Frau ihr zwei Übungen, die sie von ihrer Mutter her kannte, bei denen Luise sich entspannen konnte. Außerdem massierte sie ihr zart die Schultern. Das half zwar nicht wirklich, aber es beruhigte zumindest. Nach einer weiteren Stunde der Entspannung ebbten die Schmerzen ab.
»Das sind alles nur die Vorboten und ganz normal. Der Körper bereitet sich langsam auf die Geburt vor. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. So wie ich die Lage einschätze, dauert es noch, bis Ihr Kind kommt. Es sitzt noch viel zu hoch«, erklärte Peggy Reeves und nahm Luise somit die restliche Angst.
Es klopfte zaghaft, und herein kam der Schiffsjunge mit einem beladenen Tablett: »Mit Empfehlung des Kapitäns. Außerdem soll ich fragen, wie es Ihnen geht.«
»Richte Mr. Fraser meine Dankbarkeit aus für das Essen und für die gute Fee, die er mir geschickt hat. Dank ihr geht es mir bedeutend besser.«
Der Junge tippte mit dem Zeigefinger an seine Stirn und ging. Mit großem Appetit genossen die Frauen ihr Mahl.
»Belegte Brote, Äpfel und zwei dampfende Tassen Tee. Herz, was begehrst du mehr?«, fragte Mrs. Reeves zwischen zwei Bissen. Luise wusste die Antwort, doch sie schwieg. Als sie fast alles aufgegessen hatten, meinte Peggy mit einem schelmischen Lächeln auf den Lippen: »Sie wissen, Mrs. Fairbanks, dass Sie den übrigen Damen auf dem Schiff genügend Gesprächsstoff geliefert haben. Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass es mir egal ist, ob Ihr Kind einen Vater hat oder nicht.«
»Sollen Sie mich aushorchen, Mrs. Reeves?«
»Nennen Sie mich Peggy. Ich bin erst seit kurzem verheiratet und habe mich an meinen neuen Familiennamen noch nicht gewöhnt. Natürlich ist mir Mrs. Cartwigth hinterhergelaufen und hat mir ins Ohr geflüstert, dass ich Sie ausfragen soll. Aber so eine bin ich nicht. Ich möchte Ihnen wirklich nur helfen. Die beiden letzten Geburten meiner Mutter bereiteten ihr ebenfalls Probleme. Deshalb weiß ich, wie schlimm es werden kann. Sie haben mir Leid getan. Das war der Grund.«
Nun musste Luise laut lachen, denn Peggy sprach in einer so erfrischenden Art, dass Luise an der Ehrlichkeit ihrer Worte nicht zweifelte.
Diese stimmte in das Lachen ein, sodass die beiden nicht hörten, als mehrmals an die Tür geklopft wurde. Erst als Fraser im Zimmer stand, verstummte das Gelächter.
»Mein Gott, bin ich froh, dass es Ihnen besser geht. Als der Schiffsjunge mir Ihre Nachricht überbrachte, konnte ich es fast nicht glauben, deshalb musste ich mich selbst überzeugen.«
»Wir wollten gerade auf Deck gehen. Ich denke, dass Mrs. Fairbanks die frische Luft gut tun wird.«
»Dann möchte ich Sie nicht davon abhalten. Wir laufen in der nächsten Stunde in Kapstadt ein, und da gibt es für mich genug zu tun. Mrs. Reeves, ich möchte mich bedanken. Sie waren die Einzige, die mich ohne Wenn und Aber unterstützt hat.«
Diese winkte ab und meinte nur: »Nächstenliebe ist für viele ein Wort, das sie nicht verstehen. Aber meine Mutter hat uns alle nach diesem Motto erzogen, und ich bin stolz darauf. Verurteile und beurteile niemanden nach dem, was er hat oder ist. Nur der Mensch zählt. Das hat uns mein Vater gelehrt.«
»Ihre Eltern sind weise Menschen, Peggy, und sie können stolz auf ihre Tochter sein«, meinte Luise dankbar lächelnd.
»Danke schön«, sagte Peggy verlegen und geleitete Luise nach oben, wo ihr Mann Clark sie freudestrahlend in den Arm schloss.
Auch er war noch jung, aber genau wie seine Frau Peggy wirkte er reif und besonnen. Außerdem hatte er die gleiche erfrischende und offene Art.
Fasziniert standen alle Passagiere auf Deck, um das Spektakel des Einlaufens der ›Miss Britannia‹ in den Hafen von Kapstadt mitzuverfolgen. Neugierig schauten die Damen zu Peggy hin. Scheinbar hofften sie, dass diese zu ihnen eilen würde, um ihnen Neuigkeiten zu erzählen. Doch Peggy grinste spitzbübisch zu Luise und meinte nur: »Die können warten bis zum Nimmerleinstag. Von mir hören die kein Sterbenswörtchen.«
Luise nahm sich vor, Peggy wenigstens zu verraten, dass sie glücklich verheiratet war.
Je näher man dem Hafen kam, desto aufgeregter wurden die Menschen auf dem Segelschiff. Hellgrau leuchtete der Tafelberg in der Mittagssonne. Kapitän Fraser ließ die Segel einholen. Auf der letzten Bugwelle glitt die ›Miss Britannia‹ sanft in das Hafenbecken, wo sie von Lotsenbooten erwartet wurde. Bootsjungen warfen den Lotsen dicke Taue zu, mit deren Hilfe der Segler sicher zu seinem Ankerplatz gezogen wurde.
Immer wieder stellte Luise fest, dass es für die Bewohner einer Hafenstadt etwas Besonderes war, wenn ein solch majestätisches Schiff wie die ›Miss Britannia‹ einlief. Obwohl es in einem großen Hafen wie Kapstadt mehrmals die Woche passierte, versammelten sich über hundert Menschen am Pier und begrüßten die Schiffsmannschaft sowie die Passagiere mit lautem Gejohle. Einige waren gekommen, um ihre Arbeitskraft anzubieten, andere, um ihre Ware anzupreisen, und wieder andere, um zu betteln. Es war ein bunt gemischter Haufen Köpfe verschiedener Nationalitäten und Farben, auf den Luise und die Übrigen von der Reling hinuntersahen.
Man plante zwei Tage Aufenthalt in Südafrika, um Ware auszuliefern und neue an Bord zu nehmen. Außerdem wurden Post getauscht und frische Lebensmittel eingelagert. Luise freute sich wie ein kleines Kind auf den Landgang. Es ging ihr wieder gut, und an die vergangenen Schmerzen verschwendete sie keinen Gedanken mehr. Den Geruch der Stadt mit ihren Menschen und dem Treiben sog sie in sich ein, als ob sie den Rauch einer Tabakspfeife inhalieren würde.
Sie wollte wie auf ihrer Hinreise vor mehr als zwei Jahren durch die Geschäfte stöbern, sich die Stadt ansehen und vielleicht Giuseppe Zingale einen Besuch abstatten. Obwohl sie in ihrem Zustand diesmal kein elegantes Kleid bei dem Schneider kaufen konnte, freute sie sich doch auf den Mann mit dem italienischen Temperament. Luise hoffte, dass das Ehepaar Reeves sie begleiten würde, denn sie wollte diese in den kleinen Teesalon um die Ecke von Giuseppes Ladenlokal einladen und sich so bei Peggy für ihre Hilfe bedanken. Sie unterbreitete dem Ehepaar ihren Vorschlag, den dieses begeistert annahm.
Als das Schiff im Hafen verankert, durch stabile Taue am Pier gesichert war und nun ruhig im Wasser lag, wurde endlich die hölzerne Passagierrampe abgelassen. Jeder der Reisenden wollte zuerst wieder festen Boden unter den Füßen haben und versuchte, seinen Vordermann zur Eile anzutreiben. Deshalb hakten sich die beiden Frauen bei Clark Reeves unter. Dieser geleitete sie stolz und sicher durch die laute Menschenmenge bis zur nächsten freien Droschke. Da man mehrere Stunden Zeit hatte, bevor der Laufgang zur Sicherheit nachts eingezogen wurde, wollte man sich durch Kapstadt chauffieren lassen, um die Stadt ein wenig kennen zu lernen.
Als sie in den Stadtkern kamen, wurde die Atmosphäre um sie herum ruhiger und entspannter. Voller Entzückung bewunderten die Frauen die herrschaftlichen Häuser und großen Gebäude. Vor einem Wohnhaus gefielen Luise besonders die Blumenbeete, bei einem anderen bewunderte Peggy die eleganten Gardinen am Fenster. Freundliche Menschen erwiderten ihren Gruß. Kinder winkten ihnen ausgelassen zu. Natürlich zeigte ihnen der Kutscher nur die Zuckerseite der Stadt. Doch als Luise sich umdrehte, um in eine dunkle Seitengasse zu blicken, konnte sie wie in London die Unterschiede erkennen. Auch hier nahm am Ende der Gasse das farbenprächtige Bild ab und verlief sich in dunkle Grau- und Brauntöne. Ungepflegte Vorgärten und Müll am Straßenrand verdeutlichten Luise, dass Kapstadt allen anderen großen Städten glich. Auch hier gab es die Kluft zwischen Arm und Reich.
Clark, der von den Unterschieden scheinbar nichts bemerkt hatte und von den kulturellen Gebäuden begeistert war, riss Luise aus ihren Gedanken und meinte: »Man merkt, dass dieser Kontinent schon länger von Weißen besiedelt ist und man hier die Zivilisation den Einheimischen näher gebracht hat. Australien hat noch viel vor sich, um diesen Stand zu erreichen. Es ist noch sehr rückständig und unberührt. Wenn ich jedoch das hier alles sehe, muss ich nach Jahren des einfachen Lebens, dem ich zwar nicht abgeneigt bin, nun doch gestehen, dass ich es kaum erwarten kann, nach London zurückzukehren. Ich freue mich auf das kulturelle Leben und möchte endlich einmal wieder in einem richtigen Theater sitzen. Bei uns gab es zwar Aufführungen, doch war alles sehr primitiv und beengt«, seufzte er.
»Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass mir erst jetzt auffällt, dass ich noch nicht einmal weiß, wo Sie in Australien leben«, entschuldigte sich Luise.
»Wir wohnen am westlichen Stadtrand von Sydney. Mein Vater ist Kommandant der Marineinfanteristen. Peggys Vater ist der Pfarrer unserer Gemeinde. Wir sind erst seit vier Monaten verheiratet. Nun möchte ich meiner Großmutter meine wunderbare Frau vorstellen. Da Großmutter schon über siebzig Jahre alt ist, wollte sie nicht mit nach Australien übersiedeln.« Er lachte kurz auf und erzählte: »Als wir versucht haben, sie umzustimmen, hat sie mit ihrem Gehstock auf den Tisch geklopft und gemeint, einen alten Baum verpflanze man nicht. Daraufhin haben mein Bruder und ich ihr versprochen, dass wir sie in London besuchen werden, sobald wir verheiratet sind«, erzählte Reeves, als ob er Luise schon ewig kennen würde.
»Da wird sich Ihre Großmutter sicher freuen, Mr. Reeves. Wir wohnen entgegengesetzt, etwa vier Stunden entfernt von Sydney. Ich bin nur selten in der Stadt. Wie ist es dort? Ich habe gehört, dass es eine sehr unruhige Stadt geworden sein soll.«
»Ja, das kann man wirklich so ausdrücken. Ob man es glauben will oder nicht, zeitweise diente Rum als offizielle Währung. Das Monopol besitzen natürlich die britischen Armee-Leutnante. Als Sydney gegründet wurde, kamen fast ausschließlich Gefangene an diesen Ort. Ich kann Ihnen sogar die exakte Zahl nennen, denn mein Vater hat vor seiner Versetzung alles genau studiert und uns mit seinem Wissen jeden Tag aufs Neue erstaunt. Es waren fünfhundertachtundsechzig männliche und einhunderteinundneunzig weibliche Strafgefangene. Außerdem zweihundert Marineinfanteristen sowie siebenundzwanzig Ehefrauen und fünfundzwanzig Kinder«, gab er seine Kenntnis lachend preis.
»Du bist so schlau, mein Schatz«, himmelte Peggy ihren Mann an.
Luise spürte einen kleinen Stich im Herzen, als sie das junge Glück beobachtete. Sie war nicht eifersüchtig, aber wieder wurde ihr schmerzlich bewusst, wie sehr sie ihren Mann vermisste.
Clark sprach weiter, da er in Luise eine interessierte Zuhörerin vermutete: »Wissen Sie, Mrs. Fairbanks, ich bin überzeugt, dass wir weißen Siedler in Australien viel falsch gemacht haben. Zum Beispiel war es falsch von Großbritannien, diesen Kontinent mit Strafgefangenen zu bevölkern. Wie schlecht kann eine Regierung sein, die einen ganzen Kontinent als Gefängnis missbraucht? Zuerst haben wir unsere Verurteilten nach Amerika verfrachtet. Das muss man sich vorstellen. Unser Königreich hat so viele seiner Kinder dorthin deportiert, dass Amerika einen Riegel davor schob. Nun kommen die armen Menschen noch weiter weg. Was läuft in unserem Land falsch, dass unsere eigenen Gefängnisse nicht ausreichen? Dass wir so viele Kriminelle haben? Welch strenge Gesetze wurden von welchen ignoranten Menschen erlassen?«
Hilflos zuckte Luise mit den Schultern. Dann meinte sie zaghaft: »Wahrscheinlich ist die Armut in England zu groß. Ich habe gehört, dass viele nur wegen gestohlener Lebensmittel deportiert worden sind. Natürlich werden auch wirkliche Kriminelle unter den Gefangenen sein, aber die meisten sind sicher eher harmlos.« Mehr wollte sie nicht sagen, obwohl sie noch einiges dazu hätte beitragen können.
»Nur nicht so schüchtern, Mrs. Fairbanks. Jawohl, viele dieser armen Menschen sind wegen ihres Hungers verhaftet worden. Ich würde sogar morden, wenn meine Kinder hungern müssten«, erregte sich Clark.
»Bitte, Liebster, sprich leise«, bat seine Frau mit belegter Stimme.
»Hab keine Angst, mein Liebling. England ist weit weg.« Er wandte sich an Luise: »Ich habe Ihren Blick gesehen, als Sie das Elend in der Seitenstraße bemerkten. Sicherlich haben wir mehr gemeinsam, als wir vermuten.« Sie schaute ihn überrascht an. Clark dämpfte nun doch seine Stimme, als er weitersprach: »Wie schön wäre es gewesen, wenn wir nach Australien gekommen wären, um den Eingeborenen unsere Kultur und unseren Fortschritt näher zu bringen. Was natürlich nicht von heute auf morgen geschehen kann. Es muss ein schleichender Prozess sein. Beide Seiten müssen sich langsam annähern. Wir Weiße brauchen Zeit, um uns auf Land und Klima umzustellen. Genauso, wie die Einheimischen sich an uns gewöhnen müssten. Man müsste sie überzeugen, welche Vorteile sie durch unsere Zivilisation gewinnen würden. Doch was machen wir? Wir benutzen, wie in jeder Epoche, wie in allen Geschichtsbüchern nachzulesen ist, die Hauruckmethode. Die Kreuzritter fackelten auch nicht lange, sondern schlugen jedem den Schädel ein, der nicht schnell genug zum christlichen Glauben übertrat. So ähnlich ergeht es den Aborigines. Jeder, der sich nicht schnell genug in die Kleidung der Weißen zwängt, wird bestraft. Mit Auspeitschen oder sogar mit dem Tod. Es macht mich wütend. Wir sind erst seit kurzer Zeit auf diesem Kontinent, aber wir Weißen benehmen uns, als ob die Aborigines die Eindringlinge wären. Wir vergessen, dass wir nur Gäste sind und froh sein könnten, wenn wir geduldet werden. Haben wir aus der Geschichte nicht gelernt? Auch in unserer Vergangenheit gab es fremde Eroberer, unter denen wir Engländer gelitten haben. Ich kenne keinen Fall in der Historie, in dem Menschen ihre Unterdrückung widerstandslos hingenommen hätten. Es ist das Natürlichste von der Welt, zurückzuschlagen und sich nicht zu unterwerfen. Würden wir mit den Ureinwohnern kooperieren, anstatt sie umzubringen oder zu vertreiben, würden wir sie und ihre Gebräuche respektieren, dann wäre es sehr viel einfacher, auf diesem Kontinent zu leben und zu überleben. Wir könnten so viel von ihnen lernen. Allein schon die Erkenntnis, wie man sich im Busch versorgt, welche Pflanzen man ohne Bedenken essen kann, hätte vielen Neuankömmlingen das Leben retten können.« Clark schien ehrlich empört über seine weißen Mitmenschen zu sein. Seine Frau strich ihm besänftigend über den Arm.
»Wie kommen Sie zu solch einer Erkenntnis? Haben Sie Kontakte zu den Ureinwohnern?«, fragte Luise interessiert.
»Außer mit dem einheimischen Personal kommt man selten mit ihnen in Berührung. Das respektlose Verhalten der weißen Siedler den Einheimischen gegenüber ist jedoch bekannt. Manche schrecken nicht einmal vor Lynchjustiz zurück. Ich habe einen Bericht gelesen, der genau das beinhaltet, was ich Ihnen eben erklärt habe. Aber ich möchte Sie nicht langweilen.«