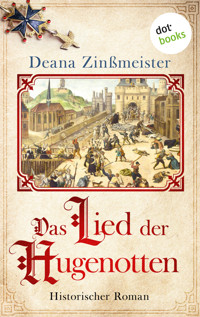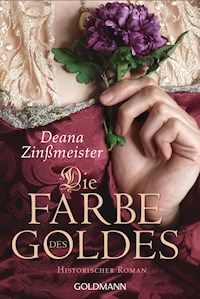Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau auf der schicksalhaften Suche nach ihrer Familie: der Australienroman »Fliegen wie ein Vogel« von Bestsellerautorin Deana Zinßmeister als eBook bei dotbooks. Kann sie im Land der roten Erde neue Hoffnung finden? Worms, 1791. Das Leben der jungen Luise liegt in Scherben, als ihr geliebter Vater stirbt. Sie droht, das Erbe der Familie zu verlieren – und hört zum ersten Mal, dass sie einen Halbbruder hat. Er allein könnte ihr Vermögen retten. Doch zu ihrem Schrecken erfährt sie, dass er als Straftäter in die australische Kolonie deportiert wurde! Trotz der Gefahren, die der fünfte Kontinent für eine junge Frau birgt, ist Luise fest entschlossen, nach Australien zu reisen und ihren letzten lebenden Verwandten zu finden. Um an Bord eines Schiffs zu kommen, muss Luise eine Scheinehe mit dem charismatischen Duncan Fairbanks eingehen. Aber ist der wirklich so zuvorkommend, wie er sich gibt – oder verfolgt er seine ganz eigenen, dunklen Zwecke? »Deana Zinßmeister schreibt historische Romane, wie man sie sich wünscht!« Iny Lorentz Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Fliegen wie ein Vogel«, Band 1 der großen Australiensaga von Deana Zinßmeister, wird Fans von Di Morrissey begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kann sie im Land der roten Erde neue Hoffnung finden? Worms, 1791. Das Leben der jungen Luise liegt in Scherben, als ihr geliebter Vater stirbt. Sie droht, das Erbe der Familie zu verlieren – und hört zum ersten Mal, dass sie einen Halbbruder hat. Er allein könnte ihr Vermögen retten. Doch zu ihrem Schrecken erfährt sie, dass er als Straftäter in die australische Kolonie deportiert wurde! Trotz der Gefahren, die der fünfte Kontinent für eine junge Frau birgt, ist Luise fest entschlossen, nach Australien zu reisen und ihren letzten lebenden Verwandten zu finden. Um an Bord eines Schiffs zu kommen, muss Luise eine Scheinehe mit dem charismatischen Duncan Fairbanks eingehen. Aber ist der wirklich so zuvorkommend, wie er sich gibt – oder verfolgt er seine ganz eigenen, dunklen Zwecke?
»Deana Zinßmeister schreibt historische Romane, wie man sie sich wünscht!« Iny Lorentz
Über die Autorin:
Deana Zinßmeister widmet sich seit einigen Jahren ganz dem Schreiben historischer Romane. Bei ihren Recherchen wird sie von führenden Fachleuten unterstützt, und für ihren Bestseller »Das Hexenmal« ist sie sogar den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Saarland.
Bei dotbooks veröffentlichte sie auch die Fortsetzung des Erfolgsromans »Fliegen wie ein Vogel«:
»Der Duft der Erinnerung«
Webseite der Autorin: www.deana-zinssmeister.de
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Juni 2019
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Moments in der area verlag gmbh, Erftstadt
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/KathySG, Dragon_Fly, Visual Collective, bmphotographer, Leah-Anne Thompson, Azhar_khan, Rachael Towne und STILLFX sowie Pixabay/MemoryCatcher
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-758-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Fliegen wie ein Vogel« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Deana Zinßmeister
Fliegen wie ein Vogel
Roman
dotbooks.
Für alle,
die an dieses Buch geglaubt haben.
»Ach, dem Blick entzieht sich Englands Küste,
Alle einst so hellen Ufer wirken düster,
Uns dräut ein hartes Leben in der Ferne.
O lebet wohl, der Heimat traute Sterne.
Weh’ mir, was harret meiner fern vom Vaterland?
O wollte Gott, ich wäre arm, doch frei, am Strand.«
Dies schrieb Simon Taylor an seinen Vater.
Er war einer der 162.000 Gefangenen,
die nach Australien deportiert wurden.
Kapitel 1
Worms, 18. Dezember 1790
»Asche zu Asche, Staub zu Staub …«
Luise hörte diese Worte wie aus weiter Ferne. Sie konnte es immer noch nicht glauben. Aber es war wahr und nicht wieder rückgängig zu machen. Wie in Trance nahm sie Abschied von dem liebsten Menschen, den sie gehabt hatte, Johann Robert von Wittenstein, ihrem Vater. Langsam senkte sich der Sarg in das tiefe, dunkle Loch. Wie sehr hatte ihr Vater die Sonne und die damit verbundene Wärme geliebt. Er hatte stundenlang auf der Terrasse sitzen und den Pflanzen und Tieren zusehen können. Nun lag er in einem kalten, nassen Loch. Ihr wurde übel. Sie wollte heim. Heim aufs Gut, sich wie früher in ihr Bett verkriechen und hoffen, dass sie alles nur geträumt hatte. Aber sie war kein kleines Kind mehr, sondern eine junge Frau, deren nüchterner Menschenverstand ihr immer wieder brutal sagte, dass dies alles stattfand. Nichts würde wieder so sein wie früher.
Es war knapp eine Woche vor dem Heiligen Abend. Der Himmel war grau. Ein leichter Schneefall durchnässte langsam die Kleider der Menschen, die sich auf dem Ahnenfriedhof der Familie von Wittenstein versammelt hatten. Luise zitterte vor Kälte und musste ihre Lippen aufeinander pressen, damit man das Zähneklappern nicht hörte. Die Lobeshymnen auf ihren Vater wollten kein Ende nehmen. Jeder der Trauergäste wusste Gutes über ihn zu berichten. Ja, er war beliebt, und alle schätzten seinen Gerechtigkeitssinn, seine Ehrlichkeit. Er war ein guter Arbeitgeber gewesen und hatte auch für die Probleme der einfachen Leute stets ein offenes Ohr gehabt. Deshalb war der kleine Privatfriedhof mit der Familiengruft, der etwas abgelegen am Waldesrand hinter dem Weingut lag, mit trauernden Menschen überfüllt. Alle waren gekommen.
Sämtliche Angestellte, vom Keltermeister bis hin zum Pflücker, die Dienstmädchen Martha und Klara, die Köchin Anni, ihr Patenonkel und gleichzeitig Anwalt ihrer Familie, Fritz von Sydow, mit seiner Frau Margret, der Hausarzt und langjährige Freund Dr. August Freund. Sogar ihr Onkel Maximilian von Wittenstein mit Frau Elfriede und Sohn Detlef waren aus Köln nach Worms gekommen. Er war der ältere Bruder ihres Vaters. Wegen Streitigkeiten hatten die beiden Brüder kaum Kontakt miteinander gehabt. Nun stand Maximilian am Grab seines Bruders – zu spät für eine Aussprache, zu spät, um zu verzeihen.
Und natürlich war ihre beste Freundin da, um ihr Trost zu spenden – Colette. Sie wusste genau, wie Luise sich fühlte, denn auch sie hatte ihren Vater vor nicht allzu langer Zeit verloren und war nun auf sich selbst gestellt. Luise konnte sich noch genau an den Tag erinnern, als Colette an der Hand ihres Vaters Pierre Lambert im Hof stand und dieser nach Arbeit fragte. Fünf Jahre war diese damals alt gewesen und aus der Großstadt Paris gekommen. Seit ihrem zweiten Lebensjahr waren sie auf Wanderschaft gewesen, da sich ihr Vater als Tagelöhner bei Weinernten den Lebensunterhalt verdient hatte. Auch Colette war ein zartes und kränkliches Geschöpf. Neben der zwei Jahre älteren Luise wirkte sie zerbrechlich, denn diese überragte sie um eineinhalb Haupteslängen und hatte eine stämmige Figur. Colettes große braune Kulleraugen blickten scheu und ängstlich aus dem von dunklem Haar umrahmten Gesichtchen. Sie litt an einer chronischen Lungenkrankheit, und bei jedem Hustenanfall schien ihr zarter Körper auseinander brechen zu wollen. Diese Krankheit war auch der Grund, warum sie aus der Großstadt fortgegangen waren. Die schlechte Luft in Paris war Gift für ihre kleinen Lungen gewesen, und so waren sie von einem Weingut zum anderen gewandert, immer von der Hoffnung begleitet, irgendwo bleiben zu können und ein neues Zuhause zu finden. Die schlechte Arbeitslage hatte sie weiter nach Osten bis zum Landsitz von Johann von Wittenstein geführt. Luises Vater hatte erkannt, dass Pierre eine goldene Hand für alle Pflanzen im und ums Haus hatte, und ihn als Gärtner eingestellt. Es war nur allzu deutlich gewesen, dass auf Gut Wittenstein eine Herrin fehlte, die sich um den Garten und die Blumenarrangements kümmerte. Frau von Wittenstein war bereits zwei Jahre zuvor gestorben, und seitdem hatte sich Anni um das Bepflanzen der Grünanlagen gekümmert. Aber sie hatte sich nicht gleichzeitig mit Küche und Blumenbeeten beschäftigen können. Deshalb hatte Luises Vater auch nicht lange gezögert, sondern Pierre und Colette ein neues Zuhause gegeben. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Gut von prächtigen Blumen geziert, und auch im Haus selbst grünte und blühte es an allen Ecken. Die Mädchen waren überglücklich gewesen, als Colette und ihr Vater ins Gärtnerhaus einzogen und somit am Ende ihrer Wanderschaft angekommen waren. Luise und Colette verband bald eine innige Freundschaft, obwohl sie grundverschieden waren. Colette, für ihr Alter schon sehr vernünftig und besonnen, war eher der ruhende Pol in diesem Zweiergespann. Luise war, wie man sich ein Mädchen vom Land vorstellt – pausbäckig und kerngesund. Sie hatte blonde Locken, stets rote Wangen und lachende, blaue Augen, die nur so vor Energie sprühten. Sie war ein richtiger Wildfang, der seine Nase in alles steckte, besonders in solche Sachen, die ihn nichts angingen. Ihr größtes Interesse galt den Tieren, egal, ob groß oder klein. Mit jedem hatte sie Mitleid und deshalb schleppte sie alle mit nach Hause. Jedes Mal gab es ein großes Geschrei und Gezeter, wenn die Köchin Anni mit hochrotem Gesicht, der Ohnmacht nahe, mitten auf dem Küchentisch stand, weil eine der Mäuse sich in die Küche verirrt hatte. Ihr Vater wollte stets mit ihr schimpfen, aber wenn er in ihre unschuldigen, blauen Kinderaugen blickte, huschte ein Lächeln über sein Gesicht, und er sagte zärtlich: »Was soll ich nur mit dir machen, mein kleiner Rebell?« Luise legte dann die Arme um den Vater, gab ihm einen Kuss und wusste, dass sie wieder gewonnen hatte.
Ein Lächeln umspielte Luises Lippen, als sie daran dachte. Ihre Gedanken schwebten zu dem Tag, als ihr Vater sie in die Bibliothek bestellte. Er bat sie, in dem großen Sessel neben seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Ihr Körper versank fast in dem braunen Leder. Die Sitzfläche war so breit, dass Colette bequem neben Luise hätte sitzen können. Während sich ihr Vater einen selbst gebrannten Kirschlikör ins Glas eingoss, schaute sich Luise in dem Raum um. Sie wippte mit ihren Fersen auf dem glänzenden Holzboden und betrachtete voller Interesse die vielen Bücher in den Regalen, die bis zur Decke reichten. Einige Dinge fielen ihr zum ersten Mal auf, so zum Beispiel die aufwändigen Stuckarbeiten an der Decke. In jeder Deckenecke waren die Kanten abgerundet und mit Blütenmotiven ausgeschmückt, die zu einer großen Blume angeordnet waren.
Ihr Vater räusperte sich und lenkte damit Luises Aufmerksamkeit wieder auf ihn. Erwartungsvoll sah sie zu ihm, ahnungslos, was nun kommen mochte. Sie hatte nichts angestellt, also konnte es auch keine Standpauke sein. Sie blickte in seine Augen. Stolz konnte sie erkennen, aber auch einen Hauch von Melancholie. »Was ist, Vater? Warum willst du mit mir sprechen?«
Er schaute in die dunkelrote Flüssigkeit in dem geschliffenen Kristallglas, das er zwischen Daumen und Zeigefinger leicht hin- und herdrehte. Dann atmete er tief ein und ließ die Luft wieder schnaufend entweichen. »Luise, du bist fast vierzehn Jahre alt, und im kommenden Sommer wirst du die Dorfschule abgeschlossen haben. Es wird nun Zeit, dass wir uns über dein späteres Leben Gedanken machen …«
»Och, darüber musst du nicht grübeln. Colette und ich haben schon nachgedacht. Wir wollen Pferde züchten. Liesel bekommt doch ihr erstes Fohlen. Das werden wir behalten, natürlich nur, wenn es ein Stutfohlen ist. Ein Hengstfohlen wird verkauft. Von dem Geld kaufen wir uns eine weitere Stute dazu. Liesel und die Stute lassen wir decken, und dann haben wir schon vier Pferde …«
Lächelnd wurde sie von ihrem Vater unterbrochen: »Mein Kind, das ist ein hervorragender Einfall, aber für die zukünftige Besitzerin von Gut Wittenstein reicht das leider nicht. Es gibt eine Menge, was du noch nicht weißt. Zum Beispiel musst du dein Wissen in Mathematik vertiefen. Außerdem ist es wichtig, eine weitere Sprache zu lernen. Chemie wäre ebenfalls unentbehrlich, wenn du im Weinanbau tätig bist …« Er hielt kurz inne, um an seinem Likör zu nippen.
Luise wusste nicht so richtig, worauf er hinauswollte. Solch eine Schule gab es in der näheren Umgebung nicht. Wollte er einen Privatlehrer engagieren? Gab es jemanden, der von allem Ahnung hatte und es ihr beibringen konnte? Fragend blickten ihre blauen Augen.
Wieder holte ihr Vater laut Luft. »Luise, ich habe mit einem der besten Internate in der Schweiz Kontakt aufgenommen und dich dort angemeldet. Nach den Sommerferien wirst du dort erwartet.«
Langsam erhob sich Luise aus dem mächtigen Sessel und ging auf ihren Vater zu. Er sah sie nicht an, sondern blickte in das nun leere Glas, das er noch immer zwischen den Fingern drehte. Deshalb ging sie in die Hocke, um ihm in die Augen sehen zu können. »Du schickst mich fort? Habe ich etwas getan, das dich verärgert hat? Bist du böse auf mich, dass ich nicht mehr bleiben darf?«
»Herrgott, Luise, ich schicke dich doch nicht fort, weil ich böse auf dich bin. Ich will nur das Beste für dich.«
Tränen rannen ihr lautlos über das Gesicht, denn sie begriff langsam, was er meinte.
»Vater, das Beste für mich ist mein Zuhause.«
»Das wird es auch bleiben, egal, wo du bist und von wo du zurückkehrst. Aber dein zweites Zuhause wird das Internat ›Sacre Soeur‹ in Bern sein.«
»Was wird aus meinen Tieren? Aus Struppi und Liesel und den Hasen?«
»Du hast genügend Zeit, Peter, den Sohn von Keltermeister Schuster, und Colette in alles einzuweisen.«
»Bitte, bitte, Vater, schicke mich nicht fort. Ich werde artig sein und alles lernen, was du von mit verlangst, aber bitte schicke mich nicht fort von hier.« Eine unsichtbare Hand hatte sich um Luises Kehle gelegt und ihre Stimme heiser klingen lassen. Nun wurden die Worte lauter, einem Schreien gleich.
»Luise, beherrsche dich. Mein Entschluss steht fest. Nach den Ferien wirst du dort erwartet. Es ist alles Nötige veranlasst.« Er stellte das Glas auf den Schreibtisch hinter sich und verließ ohne ein weiteres Wort das Zimmer.
Luise warf sich auf den Boden und schlug immer wieder mit der Faust auf die glänzenden Holzdielen. Sie wollte Trost, aber niemand war da, der ihn ihr geben konnte. Ihre Mutter war tot, und ihr Vater war derjenige, der ihr das antat. Sie fühlte sich allein und verloren, als plötzlich jemand ihren Rücken streichelte.
»Egal, wo du bist und wie lange wir uns nicht sehen, du bist immer meine beste Freundin, mon amie«, schluchzte Colette.
Luise sah sie erstaunt an.
»Ich habe an der Tür gelauscht«, flüsterte Colette. Die Mädchen fielen sich weinend in die Arme und schworen ewige Freundschaft.
Jetzt, Jahre später, stand Colette wieder neben ihrer Freundin, ergriff deren Hand und drückte sie tröstend. Aber nichts konnte Luise trösten. Sicher, der Tod ist immer grausam und kommt viel zu früh. Wenn ihr Vater schwer krank gewesen wäre, so wie Pierre damals, für den der Tod eher eine Erlösung gewesen war, dann hätte man sich innerlich auf sein Ableben vorbereiten können. Doch niemand hatte mit seinem Tod gerechnet. Es war ein Unfall gewesen. Die Straßen waren vereist gewesen. Er hatte die Kontrolle über den Pferdeschlitten verloren, die Deichsel war gebrochen. Ihr Vater war aus dem Schlitten heraus gegen einen Baum geschleudert geworden. Sein Genick war gebrochen. Er war sofort tot gewesen. Es wäre das vorletzte Mal gewesen, dass er sie vom Bahnhof abgeholt hätte. Nächsten Sommer würde die Schulzeit zu Ende sein, und Luise würde dann für immer heimkehren. Sie hatten geplant, dass die Tochter mit dem Vater das Weingut zusammen führen würde. Jedes Mal in den Ferien hatte er ihr etwas Neues über den Weinanbau beigebracht. Sie wusste, welche Rebe an welchem Hang besonders gedieh, wie man die Rebstöcke beschnitt oder wie lange der Wein in den Holzfässern lagern musste, damit er sich richtig entfalten konnte. Luises Wissen war in den letzten Jahren vervollständigt worden. Doch was nützte das? Ihr Vater war tot, und sie fühlte sich mitschuldig.
Sie sah zum Himmel. Ein leichter Sonnenstrahl durchbrach die dunkle Wolkendecke und erleuchtete für einen Moment den kleinen Friedhof. »Oh Vater, warum hast du nicht Anton zum Bahnhof geschickt?« Aber sie wusste, warum. Er hätte es nicht geduldet, dass jemand anderes sein kleines Mädchen nach Hause holt. Nein – niemals!
Drei Tage nach der Beerdigung wurde Luise wegen der Testamentseröffnung zu ihrem Anwalt Fritz von Sydow gebeten. Es wunderte sie, dass er sie förmlich und unpersönlich in sein Haus bestellte. Schließlich war er auch ihr Patenonkel. Sie hatten ein liebevolles und familiäres Verhältnis. Dieses Benehmen war ihr fremd. Außerdem konnte sie sich nicht erklären, warum es ein Testament gab. Durch den frühen Tod der Mutter hatte sie keine Geschwister, und da ihr Vater nicht mehr geheiratet hatte, war sie Alleinerbin des Weingutes Wittenstein. Das alles ging ihr durch den Kopf, als sie auf dem Weg zu ihrem Patenonkel war. In der Eingangshalle des stattlichen Hauses nahm das Dienstmädchen ihr den vom Schnee durchnässten Umhang ab und führte Luise ins Arbeitszimmer ihres Onkels. Dieser stand am Fenster und blickte nach draußen. Er schien vertieft in den Tanz der Schneeflocken zu sein. Für Luise hatte es den Anschein, als ob er ihr Eintreten nicht bemerkte. »Guten Abend, Onkel Fritz. Wie geht es dir? Wo ist Tante Margret?«
Jetzt erst drehte er sich um. Sie wollte ihn wie sonst umarmen, aber irgendetwas hielt sie davon ab. Obwohl das Kaminfeuer im Zimmer wohlige Wärme verbreitete, fröstelte sie. Schweigend sah Fritz von Sydow seine Patentochter an. Luise bemerkte tiefe Ränder unter seinen Augen. Sein Haar schien über Nacht grauer geworden zu sein, und irgendwie wirkte er kleiner, als ob er geschrumpft wäre. Er sah uralt aus mit seinen einundfünfzig Jahren. Armer Onkel Fritz!, dachte sie. Der Tod seines besten Freundes schien ihm mehr auszumachen, als sie gedacht hatte.
Als ob er eine räumliche Distanz zwischen ihnen aufbauen wollte, deutete er zu dem Ledersessel vor seinem Schreibtisch. Er selbst nahm hinter diesem Platz. Warum hatte sie auf einmal Angst? Sie war bei einem vertrauten Menschen, in dessen Haus und in einem Raum, der ihr schon seit Kindertagen bekannt war. Warum beschlich Luise dieses Unbehagen? Sie hatte sich hier immer wohl gefühlt. Sie sah sich im Zimmer um und prüfte, ob es eine Veränderung gab, die der Grund für ihre Angst sein könnte. Aber alles schien wie immer. In diesem Raum, seinem Reich, waren die Wände mit Nussbaumholz verkleidet. Rechts an der Wand stand eine Glasvitrine mit Andenken und Erbstücken. Luise liebte die kleine Spieluhr mit dem Karussellpferdchen, das sich, wenn man die Uhr mit einem kleinen goldenen Schlüssel aufzog, zum Klang der Musik auf und nieder bewegte. Schon als Kind hatte sie diese Sonate von Händel nachsummen können. Links an der Wand waren viele Regale, voll gepackt mit langweiligen, juristischen Fachbüchern. Allerdings wusste sie, dass in der dritten Reihe hinter den fünf letzten Büchern ein kleines Tablett mit zwei Gläsern und einer Flasche erlesenen Weinbrands verborgen war. Sie schmunzelte. Ihr Onkel hatte ihr schon mit fünf Jahren das Versprechen abgenommen, niemals Tante Margret dieses Geheimnis zu verraten. Die achtete nämlich peinlichst darauf, dass ihr Mann gesund lebte, und dazu gehörte auch, dass es Weinbrand nur an Festtagen gab, und diese waren für ihren Fritz zu selten.
Wo war Tante Margret überhaupt? Onkel Fritz hatte auf ihre Frage nicht geantwortet. Hoffentlich war sie nicht krank. Nein, bestimmt nicht. Diese liebenswerte Frau mit den rosa gefärbten Wangen sprühte vor Temperament und Gesundheit. Wenn sie lächelte, kamen zwei kleine Grübchen zum Vorschein. Nein, Luise brauchte sich deswegen keine Sorgen zu machen. Ihre Tante war noch nie krank gewesen. Aber was dann ängstigte Luise heute? Ihre Nerven waren höchst angespannt, und sie fühlte, wie sich auch ihre Muskeln strafften – wie bei einem Tier, das zur Flucht bereit war. Instinktiv presste Luise ihren Rücken schutzsuchend noch fester in das weiche, anschmiegsame Leder des mächtigen Sessels. Eine innere Stimme sagte ihr, dass sie nicht mehr dieselbe Luise sein würde, wenn sie diesen Raum wieder verlassen haben würde.
»Luise, ich muss dir etwas mitteilen! Glaube mir …«
Fritz von Sydow sprach zu ihr wie zu einem fremden Klienten. Was er ihr zu sagen hatte, war wie ein Schlag ins Gesicht. Sie wusste nicht, ob sie schreien oder lachen sollte, nicht, ob es wahr oder gelogen war, ob es Tag oder Nacht war. Sie wollte nur weg – fort aus diesem Haus. Aber vor allem fort von diesem Menschen, der ihr wehtat. Weg von dem Mann, der alle diese Sachen sagte, die sie nicht hören wollte, und vor allem, die sie nicht glauben wollte und konnte.
»Hör auf! Du lügst! Das kann niemals wahr sein!« Sie hielt sich die Ohren zu, und doch drangen aus der Ferne die Worte zu ihr durch. »Er hätte mir das nicht angetan! Ich werde jetzt gehen und ich will dich niemals wiedersehen!« Sie wollte sich aus dem Sessel erheben und mit erhobenem Haupt den Raum verlassen, aber ihre Knie zitterten und widersetzten sich ihrem Befehl.
Aber ein Blick in die Augen ihres Onkels, in denen Tränen standen, sagte mehr als tausend Worte. Sie konnte an ihnen ablesen, dass er die Wahrheit sagte. Welchen Grund sollte er auch haben, sie zu quälen? Ihr Körper wurde von Weinkrämpfen geschüttelt. Fritz wollte sie tröstend umarmen, doch sie stieß ihn weg. Wie ein Häufchen Elend sank sie auf ihre Knie und weinte, bis sie keine Kraft mehr hatte und ihr Bewusstsein verlor.
Fritz von Sydow, der ihr hilflos gegenübergestanden hatte, rief aufgeregt nach seiner Frau: »Margret, komm schnell!«
Als Margret das Arbeitszimmer betrat, kniete ihr Mann neben dem Mädchen. Er war kreidebleich und zitterte. »Oh Gott, oh Gott, das arme Geschöpf. Oh Gott, oh Gott«, klagte sie. »Bring’ sie hoch ins Zimmer. Ich hole kaltes Wasser, um ihr Gesicht zu kühlen. Sie glüht regelrecht. Mein Gott, wie viel Leid muss dieses arme Kind ertragen?«
Mit Grauen dachte Fritz an den nächsten Tag, denn dann würde er sein Versprechen einlösen müssen. Ein Versprechen, das er vor vierzehn Jahren gegeben hatte. »Oh Johann, wie konntest du mich da nur hineinziehen?«
Als Luise am nächsten Tag erwachte, wusste sie im ersten Moment nicht, wo sie sich befand. Aber sie erkannte bald, dass sie in ihrem Schlafzimmer im Haus ihres Patenonkels war. Tante Margret und er hatten leider keine eigenen Kinder, und so hatte Margret nach dem Tod von Luises Mutter versucht, ihr ein bisschen mütterliche Wärme zu geben. Natürlich konnte sie die leibliche Mutter nicht ersetzen, jedoch war sie immer für Luise da und hatte auch für deren kleine Probleme ein offenes Ohr. Zu ihren selbst auferlegten Pflichten gehörte es, Luise ein eigenes Zimmer im Haus einzurichten. Luise sollte hier nicht nur Gast sein, nein, sie sollte dazugehören und wissen, dass sie jederzeit willkommen war. So manche Wochenenden durfte sie hier verbringen.
Gute Tante Margret!, dachte Luise. Sie hätte niemanden lieber haben können, außer natürlich ihren Vater. Vater!
Die Ereignisse des letzten Tages kamen ihr ins Gedächtnis zurück, und sofort schossen die Tränen in ihre blauen Augen. Nein, sie wollte nicht an den gestrigen Abend denken. Sie stand auf und schaute aus dem Fenster. Ein neuer Tag war angebrochen. Nachdem sie das Bewusstsein verloren hatte, musste sie fest eingeschlafen sein, denn sie konnte sich an nichts erinnern. Sie wollte darüber auch nicht grübeln. Es hatte aufgehört zu schneien, und die Landschaft sah aus wie mit einer dicken Puderschicht überzogen. Sie hörte Kinderlachen. Fast alle Nachbarskinder hatten sich an dem kleinen Hang auf der anderen Straßenseite getroffen und veranstalteten eine Schneeballschlacht. Wie friedvoll es draußen aussah. Durch die weiße Winterpracht erschien alles rein und unschuldig.
Luise fröstelte und floh schutzsuchend in ihr Bett zurück. Ihr Kopf dröhnte, und wie Hammerschläge drangen wieder Onkel Fritz’ Worte zu ihr durch. Sie konnte sich nicht dagegen wehren, und so ließ sie es zu, dass sie den gestrigen Abend noch einmal durchlebte: »Luise, es tut mir leid, aber du bist nicht mehr lange Herrin auf Gut Wittenstein. Das Weingut ist hoch verschuldet und fällt am Neujahrstag deinem Onkel Max zu. Dies alles ist hier in diesem Vertrag festgehalten worden. Ich habe ihn sehr gründlich studiert. Da er von deinem Onkel selbst aufgesetzt wurde, kannst du dir denken, dass er hieb- und stichfest ist. Er hat ihn bis ins kleinste Detail ausgeklügelt, und dein Vater hat ihn so akzeptiert und unterschrieben. Mir sind die Hände gebunden.« Er teilte ihr diese Hiobsbotschaft mit, beinahe ohne Luft zu holen. Seine Stimme überschlug sich fast dabei. Sicher wollte er es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Dabei hielt er den Vertrag in seinen Händen und blätterte ihn Seite für Seite in der Hoffnung durch, vielleicht doch etwas Wichtiges übersehen zu haben. Außerdem brauchte er sie dadurch nicht anzuschauen.
Luise wurde wieder von heftigem Weinen geschüttelt, als es an der Tür klopfte. »Herein«, rief sie schniefend.
Tante Margret trat ein mit einer dampfenden Tasse in der Hand, gefolgt von ihrem Mann und Dr. Freund. »Guten Morgen, mein Schatz. Hier, mein Kind, iss die Hühnerbrühe, damit du wieder zu Kräften kommst.« Sie stellte die Tasse auf den kleinen Nachttisch und klopfte Luises Kissen zurecht, damit ihr Schützling sich besser im Bett aufsetzen konnte.
»Danke, Tante Margret, aber ich habe keinen Hunger. Außerdem mag ich keine Brühe zum Frühstück!«
»Tu lieber, was deine Tante dir sagt. Oder willst du krank werden?«, vernahm sie eine Stimme aus dem Hintergrund.
»Guten Morgen, Dr. Freund. Was machen Sie hier?«
»Nun, ich habe ihn gerufen. Nach deinem Zusammenbruch gestern hielt ich es für nötig.«
»Onkel Fritz, ich bin nicht krank. Ich werde nicht wieder ohnmächtig, denn ich habe viel zu viele Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Erkläre mir bitte, wie das alles passieren konnte. Was hat überhaupt Onkel Max mit dem Ganzen zu tun? Und warum …«
»Halt, mein Fräulein! Immer langsam mit den jungen Pferden«, rief Fritz und hob abwehrend die Hände in die Höhe. »Alles zu seiner Zeit. Erst isst du ein paar Löffel von dieser köstlichen Hühnerbrühe, die Tante Margret speziell für dich gekocht hat. Ich weiß, dass du einen Magen wie ein Ochse hast und morgens früh schon eingelegte Heringe verspeisen kannst. Also wirst du auch mit dem Süppchen zurechtkommen. Außerdem ist dies das beste Essen, um wieder zu Kräften zu kommen. Anschließend wird dich August untersuchen, und dann sehen wir weiter.«
»Tante Margret …« Nach Hilfe suchend, sah Luise zu der kleinen, rundlichen Frau. Doch auch die duldete keine Widerrede, und so hatte Luise keine andere Wahl. Schweigend aß sie die Suppe. Sie merkte, wie die warme Brühe ihren Körper belebte und ihre Kräfte zurückkamen. Als Dr. Freund sie abhören und ihren Puls messen durfte und zustimmend in Richtung der Pateneltern nickte, waren diese beruhigt. Der Arzt und Margret verließen das Zimmer, damit ihr Onkel endlich Rede und Antwort stehen konnte. Als die Tür ins Schloss fiel, wollte Luise ihn gleich mit Fragen überschütten, doch mit einer energischen Handbewegung brachte Fritz von Sydow seine Patentochter zum Schweigen.
Gespannt saß Luise in ihrem Bett und wartete ungeduldig, bis ihr Onkel sich den Stuhl vom Fenster an ihr Bett gestellt hatte, um Platz zu nehmen.
Er ergriff ihre Hand, die auf der Decke ruhte, und drückte sie zärtlich. »Du erinnerst dich sicher noch daran, als vor fünf Jahren die gesamte Ernte durch den Befall von Rebläusen vernichtet wurde. Die Ausgaben waren dadurch höher als die Einnahmen. Dein Vater brauchte somit eine größere Summe Geld, um den Hof halten zu können, und wandte sich deshalb an deinen Onkel Max. Dieser war sofort bereit, deinem Vater einen höheren Betrag zu leihen, aber nicht, ohne einen Vertrag mit ihm abzuschließen. Dieser Vertrag besagt, dass Johann sich verpflichtete, innerhalb von fünf Jahren die gesamte Summe einschließlich Zinsen zurückzuzahlen, da sonst das gesamte Gut an Max fallen würde. Diese Frist läuft am 31. Dezember aus.«
»Wie konnte Vater sich auf so etwas einlassen? Ich verstehe das nicht.«
»Johann war fest davon überzeugt, das Geld vor Fristende zurückgezahlt zu haben. Zumal er kurz vor Vollendung seiner neuen Rebenzüchtung stand. Er hoffte, nein, er wusste, dass er damit den Weinmarkt erobern könnte. Aber dann, vor zwei Jahren, wurde durch die fehlerhafte Reinigung der Flaschen ein Großteil der Weine verdorben. Sie korkten, und somit wurde auch dieses Geschäftsjahr mit einem dicken Minus abgeschlossen. Zwar musste er sich kein weiteres Geld leihen, aber die gesparte Summe, die für Max bestimmt war, musste zum Teil das Defizit ausgleichen. Die Ausgaben waren einfach zu hoch. Beinahe die Hälfte der Einnahmen wurde zur Abdeckung irgendwelcher Kosten ausgegeben.«
»Welche Ausgaben waren das?«
»Mein liebes Kind, du vergisst, dass euer Gut viele Angestellte hat, die bezahlt werden müssen. Allein die Unterhaltungskosten des Wohnhauses sind sehr hoch. Dann dein Internat in der Schweiz. Zwar das beste, aber auch eines der teuersten seiner Art.«
»Aber warum hat Vater nie ein Wort gesagt? An dieser blöden Schule hat mir nichts gelegen. Ich hätte sie verlassen und ihm helfen können. Warum hat er nicht ein paar Leute entlassen?«, fragte sie, doch dann gab sie sich die Antwort selbst: »Nein, du brauchst nichts zu sagen. Vater hätte mich nie damit belastet, solange er noch gehofft hat. Und jemanden entlassen? Was für eine dumme Frage! Lieber hätte er Wasser getrunken und Brot gegessen, als irgendeinen Angestellten wegen seines eigenen Verschuldens auf die Straße zu setzen.« Nach einem Moment der Stille fügte sie hinzu: »Aber was soll ich jetzt tun? Was kannst du mir raten, deiner Patentochter ohne Dach über dem Kopf?«, erkundigte sie sich.
»Nun, bis nächste Woche bist du noch Herrin und Eigentümerin von Gut Wittenstein, und ich glaube nicht, dass dich Max auf die Straße setzt.« Er lachte zärtlich. »… und falls doch, dann bist du jederzeit bei uns willkommen. Dieses Zimmer ist schon immer deines gewesen, und Margret und ich werden für dich sorgen.«
Luise war aus ihrem Bett aufgestanden und umarmte ihn. »Danke, ich weiß das zu schätzen, und ich weiß auch, dass es dir nicht leicht gefallen ist, mir dies alles zu sagen.«
Tränen traten in seine Augen, und er erwiderte ihre Umarmung. Er hätte sein eigenes Kind nicht lieber haben können. Deshalb krampfte sich sein Herz bei dem Gedanken zusammen, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, den er so fürchtete.
Jetzt war es an der Zeit, sein Versprechen einzulösen. Ein Versprechen, das er vor gut vierzehn Jahren gegeben hatte. »Luise, setz dich bitte. Ich muss dir noch etwas sagen.« Der Ausdruck in seinen Augen, der unendlich traurig schien, verhieß wieder nichts Gutes.
»Oh nein, Onkel Fritz, bitte nicht noch eine Hiobsbotschaft. Das vertrage ich nicht.«
»August, komm jetzt bitte rein«, rief er zur Tür. »Der Doktor war nämlich damals ebenfalls dabei und kann behilflich sein, deine Fragen zu beantworten«, erklärte er Luise.
Dr. Freund, der die ganze Zeit draußen gewartet hatte, betrat das Zimmer nur sehr zögerlich. Denn während er draußen gewartet hatte, waren die Erinnerungen an damals zurückgekommen.
»Also, ihr zwei, was ist los?«, brachte Luise ihn aus seinen Gedankengängen zurück. Dr. Freund seufzte schwer. Dann ließ er die Türklinke los, stellte seinen Arztkoffer vor Luises Bett und zog den zweiten Stuhl im Zimmer vom Kleiderschrank an Fritz’ Seite. Dieser sah ihn dankbar an.
»Jetzt sagt endlich, was los ist! Was gibt es Geheimnisvolles in meinem Leben, von dem ich anscheinend keine Ahnung habe? Keine Angst, ich fühle mich wieder gut und falle auch nicht in Ohnmacht. Außerdem, was könnte es Schlimmeres geben, als seinen Vater und sein Zuhause kurz nacheinander zu verlieren. Außer …« Die beiden Männer sahen sie gleichzeitig an. »… außer, es gibt vielleicht eine Leiche auf Wittenstein, die noch beseitigt werden muss, bevor ich ausziehe.«
Sie musste laut lachen, als sie die entsetzten Gesichter der beiden Männer sah. Doch im gleichen Moment wurde sie wieder ernst. »Es stimmt doch hoffentlich nicht, oder?«, fragte sie leise.
»Wo denkst du hin, natürlich nicht!«, antwortete von Sydow entsetzt. »Hier geht eindeutig deine Fantasie mit dir durch.«
»Na, dann kann es doch gar nicht so schlimm sein.«
Fritz fasste in die Innenseite seiner Jacke und zog einen vergilbten Briefumschlag heraus. »Hier, mein Kind. Hier steht alles drin.«
Luise nahm voller Erstaunen den Briefumschlag entgegen, denn damit hatte sie nicht gerechnet. Auf dem Kuvert stand ihr Name, und sie erkannte sofort die Handschrift ihres Vaters. Ihre Finger umfassten zittrig den Brief. »Er ist von Vater!«, flüsterte sie kaum hörbar. Sie sah ihren Onkel fragend an. Der nickte nur. »Warum hat er mir einen Brief geschrieben? Er wusste nicht, dass er einen tödlichen Unfall haben würde. Ich verstehe das nicht!« Sie hatte das Gefühl, gleich wahnsinnig zu werden. Immer noch starrte sie auf den Briefumschlag. Tränen verschleierten ihren Blick.
»Nein, Luise, er konnte nicht wissen, dass er von uns gehen würde. Diesen Brief an dich hat er schon vor vierzehn Jahren geschrieben. Seit dieser Zeit bewahre ich ihn für dich auf. Dein Vater nahm mir damals das Versprechen ab, ihn dir erst nach seinem Tod zu übergeben. Das heißt, erst dann, wenn du auch reif genug bist, den Inhalt zu verstehen. Ich denke, du bist es. Er hatte anscheinend nicht den Mut, es dir zu Lebzeiten mitzuteilen. Aber da er meinte, dass du ein Recht hast, dies zu erfahren, hat er alles über die Ereignisse von damals in diesem Brief niedergeschrieben. August und ich lassen dich jetzt allein, damit du in Ruhe diese Zeilen lesen kannst. Wenn du uns brauchst, ruf nach uns.«
Luise konnte nur nicken, denn die Tränen ließen sich nicht länger zurückhalten. Schmerzliche Erinnerungen kamen zurück in ihr Bewusstsein. Vor allem die Tatsache, dass ihr Vater wirklich tot war. Sie blickte ihrem Onkel und Dr. Freund hinterher, bis die Tür ins Schloss fiel, dann erst öffnete sie vorsichtig den Umschlag und faltete den Brief auf ihrer Bettdecke auseinander. Ganz unverkennbar – es war die Handschrift von Johann Robert von Wittenstein. Die Worte, die ihr Vater an sie gerichtet hatte, verschwammen vor ihren Augen. Sie rieb die Tränen energisch fort, schniefte kräftig in ihr Taschentuch und fing an, den Brief zu lesen. Seinen Brief – und jetzt – ihren!
Wittenstein, den 12. Juli 1776
Mein liebes Kind, meine über alles geliebte Luise!
Jetzt ist also der Tag gekommen, an dem ich nicht mehr bei dir sein kann. An dem ich dich nicht mehr beschützen und dir hilfreich zur Seite stehen darf. Wie alt magst du in diesem Augenblick sein? Auf jeden Fall mindestens fünfzehn Jahre, denn so lautete meine Vereinbarung mit Fritz. Durfte ich dich vielleicht sogar zum Altar begleiten oder mein erstes Enkelkind in den Armen halten?
Luise warf den Brief auf die Bettdecke. Sie konnte nicht mehr weiterlesen. Unaufhaltsam rannen ihr die Tränen die Wangen hinunter. Es tat so weh, so unendlich weh, und doch musste sie weiterlesen, denn ihre Neugierde ließ sich genauso wenig unterdrücken wie ihre Tränen. Beinahe wären sie auf die beschriebenen Seiten getropft. Sie trocknete sich die Augen. Dann überflog sie die schon gelesenen Zeilen bis zu der Stelle, an der sie unterbrochen hatte.
Wie viel Zeit haben wir miteinander verbracht? Ich hoffe, ich war dir ein guter Vater. Ich brauche auf diese Fragen keine Antwort zu suchen, denn es gibt keine zu diesem Zeitpunkt. Was mir bleibt, ist nur die Hoffnung, dich lange bei mir gehabt zu haben. Doch genug damit, gewiss kannst du, ungeduldiges Mädchen, es nicht erwarten, den eigentlichen Grund dieses Briefes zu erfahren. Sicher wirst du dich auch fragen, warum ich dir das alles nicht schon zu meinen Lebzeiten erzählt habe, aber ich habe nicht den Mut gefunden, dir davon zu berichten. Ich gebe es zu, ich bin den einfachen Weg gegangen und habe mich dadurch feige verhalten. Aber trotzdem wollte ich, dass du es erfährst und vor allem auch verstehst. Da ich nicht weiß, wann mich der liebe Herrgott zu sich ruft, kam mir der Gedanke, dir alles niederzuschreiben. Lies die folgenden Seiten sorgsam durch und bitte, Luise, urteile nicht vorschnell.
Mein liebes Kind, du hast mich oft nach deiner Mutter gefragt, und du weißt sicher noch, dass ich dir erzählte, dass sie eine sanfte, gütige Frau war. Aber sie war auch eine kränkliche, schwache Frau …
Es fiel Luise ohnedies schon schwer genug, ihrem Vater zu folgen, aber nun verstand sie nichts mehr. Was hatte das alles mit ihrer Mutter zu tun? Sie starb, als Luise knapp drei Jahre alt war, und sie konnte sich kaum an sie erinnern. Nur durch die Erzählungen ihres Vaters und der Angestellten und durch die Bilder im Haus hatte sie sich ihre Mutter vorstellen können. Sie schüttelte ratlos den Kopf. Gespannt las sie weiter.
… Sie hat sich nach deiner Geburt gesundheitlich nicht wieder erholt. Sie war nur noch ein Schatten ihrer selbst und sehr schwächlich. Dr. Freund sagte uns, dass sie nie wieder ein Kind zur Welt bringen dürfte, da sie sonst das Leben des Kindes und auch ihr eigenes gefährden würde. Es wäre einem Todesurteil gleichgekommen. So lebten wir wie Bruder und Schwester zusammen. Wir waren nicht unglücklich in dieser Zeit, denn wir hatten diesen Zustand zu akzeptieren. Trotzdem war mein Leben unausgefüllt, was in diesem Moment zweitrangig war, denn meine ganze Liebe und Sorge galt dir. Der kleinste Windhauch fesselte deine Mutter ans Bett, sodass sie dich nicht ausreichend versorgen konnte. Anni hatte mit der Führung des Haushaltes genug zu tun, und ich war nicht geübt in Kinderpflege. Ich musste mich um den Weinanbau kümmern und verbrachte mehr Zeit in den Weinbergen als im Haus. Diese Gründe veranlassten uns schließlich 1774, ein Kindermädchen für dich zu suchen. Mit der Zustimmung deiner Mutter schrieb ich die Stelle einer Betreuerin aus. Ich bekam eine große Anzahl an Zusendungen und ich ging mit deiner Mutter die Bewerbungen durch. Wir entschieden uns für ein Mädchen aus England, das schon bei einer anderen Familie in Diensten gewesen war und Erfahrungen im Umgang mit kleinen Kindern hatte. Sie erschien deiner Mutter und mir qualifiziert, dich zu betreuen. Damit du Tag und Nacht versorgt wurdest, wohnte das Kindermädchen mit uns unter einem Dach. Ihr Name war Heather Timonth. Ich glaube kaum, dass du dich an sie erinnern kannst. Sie war zweiundzwanzig Jahre alt und stammte aus London. Sie versuchte, dich die Abwesenheit deiner Mutter, die immer schwächer wurde und ihr Bett kaum noch verlassen konnte, so gut es ging, nicht spüren zu lassen. Als ich sah, wie liebevoll sie dich mit ihren braunen Augen ansah und wie rührend sie mit dir spielte, wuchsen meine Sympathien für Heather. Für das, was dann passierte, übernehme ich allein die Verantwortung. Ich konnte es nicht mehr beeinflussen, und wenn ich ehrlich bin, wollte ich es auch nicht. Ich verliebte mich in sie und mit der Zeit auch sie sich in mich. Wir kamen uns näher, und wir wurden ein Paar. Gott stehe mir bei, ich habe diese Frau geliebt. Ich will es auch nicht leugnen, denn ich musste dafür bezahlen. Bitte, Luise, verurteile mich nicht für meine Schwächen. Du musst denken, ich hätte die Krankheit deiner Mutter schamlos ausgenutzt, aber dem ist nicht so. Deine Mutter und ich haben nicht aus Liebe geheiratet. Unsere Eltern hatten es für uns geplant, weil die Ländereien unserer beider Familien aneinander grenzten und dadurch zu einem großen Besitz vereinigt werden konnten. Ich habe deine Mutter immer geachtet und verehrt. Sicher war es später auch eine besondere Art der Zuneigung, denn sonst hätten wir dich, mein Liebling, nicht bekommen. Aber erst, als ich Heather kennen und lieben gelernt hatte, wusste ich, was ich all diese Jahre vermisst hatte. Durch sie durfte ich diese tiefe Liebe und Leidenschaft empfinden, die schon die alten Griechen in ihren Sagen und Mythen beschrieben haben. Je nachdem, wie alt du jetzt bist, kannst du jetzt noch nicht verstehen, was ich meine. Vielleicht aber ist dir bereits ein Mann begegnet, für den du dasselbe empfindest wie ich für Heather. Dann wirst du mich verstehen können. Wir waren diskret und versuchten, unsere Liebe so lange wie möglich geheim zu halten. Bis zu dem Tag, an dem man es nicht mehr übersehen konnte, denn Heather wurde schwanger.
Ja, Luise, am 23. September 1775 wurde dein Brüderchen geboren …
Luises Zorn, der durch die letzten Zeilen des Briefes immer mehr gewachsen war, wich für einen Moment der Ungläubigkeit. Sie las diesen Satz noch einmal. Doch er ergab immer den gleichen Sinn. Sie hatte ein Brüderchen. Sie schmunzelte. Brüderchen war wohl nicht ganz richtig, er musste, nach dem Geburtsdatum zu urteilen, schon fast ein Mann sein. Er war mittlerweile fünfzehn Jahre alt. Einen Bruder! Oh Gott! Wie sehr hatte sie sich als Kind einen Bruder gewünscht. Sie wollte nie eine Schwester, denn sie hatte ja Colette. Nein, ihr Wunsch war es, einen Bruder zu haben, der sie beschützte, einen, mit dem man Pferde stehlen konnte. Einen, dem man alles erzählen konnte und der einen verstand – der einen liebte. Ja, das war immer ihr innigster Wunsch gewesen. Sie hatte stets gehofft, dass ihr Vater eines Tages wieder heiraten und damit ihre Sehnsucht erfüllt würde. Aber er blieb allein, und so ging ihr Herzenswunsch nicht in Erfüllung. Doch nun hatte sich alles gewandelt. Aber wo war dieser Bruder? Warum hörte sie erst jetzt etwas von ihm? Warum hatte sie nie etwas von ihm gesehen? Noch nicht einmal ein Bild schien von ihm zu existieren. Sie musste den Brief zu Ende lesen, um eine Antwort auf diese Fragen zu erhalten.
… und bekam die Vornamen seines Vaters, Johann Robert, und den Nachnamen seiner Mutter, Timonth. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war. Dr. Freund war bei der Entbindung zugegen und versicherte mir, dass Mutter und Kind wohlauf wären. Johann gedieh vom Tage seiner Geburt an prächtig. Er war ein kleiner Blondschopf mit dicken Backen und genauso blauen Augen, wie deine es sind. Und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, man konnte sehen, dass ihr Geschwister wart. Er hatte sogar den kleinen Leberfleck in Form eines Sterns oberhalb des linken Fußknöchels. Das Wittensteinmal. Nun war für mich der Augenblick gekommen, deiner Mutter die Wahrheit zu sagen. Doch es ging ihr zusehends schlechter. Ich verschob den Tag, sie über die Dinge aufzuklären, bis aufs Unbestimmte, denn ich wollte ihr jede Aufregung ersparen. Fritz, August und das Personal wussten Bescheid, und ich konnte mich auf ihre Verschwiegenheit verlassen. Da Johann bis zu seiner Taufe in der Kammer unter dem Dach bleiben musste, war ich sicher, dass deine Mutter nichts vom Kindergeschrei oder der Unruhe mitbekommen würde. Ich hoffte, dass es ihr in diesen Wochen, bis das Kind den Raum verlassen durfte, besser gehen würde. Doch vier Wochen nach Johanns Geburt verstarb Sophie an den Folgen einer Lungenentzündung. August hatte mir zwar schon vor längerer Zeit gesagt, dass deine Mutter bald von uns gehen würde. Aber als dieser Tag gekommen war, wollte ich es nicht glauben. Ich vermisste sie sehr. Jedoch stand es für mich außer Frage, dass ich, nach Verstreichen einer angemessenen Trauerzeit, Heather heiraten und unser Kind, vor allen als meinen Sohn anerkennen würde. Dann jedoch geschah etwas Unfassbares. In der Nacht nach der Beerdigung verschwanden Heather und das Kind spurlos. Ich versuchte alles, um die beiden zu finden. In meiner Verzweiflung wandte ich mich sogar an meinen Bruder Max. Du kannst dir sicher vorstellen, wie schwer es mir fiel, Max um Hilfe zu bitten. Einerseits, weil wir schon jahrelang keinen innigen Kontakt mehr hatten, und zum anderen, weil ich ihm von meinem Ehebruch berichten musste. Aber er hatte die Verbindungen nach London, die ich benötigte. Ich nahm an, dass Heather mit dem Kind zu ihrer Familie zurückgekehrt sei. Kein Abschiedsbrief ließ auf das Warum oder Wohin schließen. Ich war sehr verzweifelt. Innerhalb kürzester Zeit verlor ich Ehefrau, Geliebte und Sohn. War das der Preis, den ich für mein ehebrecherisches Verhalten zahlen musste? Für meinen Egoismus? Ich weiß es bis zum heutigen Tage nicht. Drei Wochen nach Heathers Verschwinden überbrachte mir Max die Nachricht, dass sie tatsächlich mit dem Jungen nach England abgereist war. Er hatte es anhand der Passagierliste der Fähre Sealine recherchieren können. Im selben Moment, als ich meinen Bruder für diese wundervolle Nachricht umarmen wollte, teilte er mir allerdings mit, dass dieses Schiff in einem schweren Sturm gekentert und alle Mitreisenden ertrunken waren. Sie sind tot, Luise, alle beide.
Meine Welt ist zusammengebrochen, und wenn es dich, mein Goldengel, nicht geben würde, dann gäbe es für mich nur einen Ausweg. Du alleine gibst mir die Kraft zum Weiterleben. Erst jetzt, mehr als ein halbes Jahr danach, habe ich den Mut und die Kraft aufgebracht, dir alles niederzuschreiben.
Bitte, Luise, verurteile mich nicht für meine Schwäche. Glaube mir, ich habe hoch, zu hoch dafür bezahlen müssen und werde es bis an mein Lebensende tun. Du bist das Liebste, was ich auf dieser grausamen Welt habe. Ich hoffe, dass du mich verstehen kannst. Wer weiß, vielleicht kannst du mir sogar vergeben.
Dein dich über alles liebender Vater
Johann Robert von Wittenstein.
P.S. Grüße Fritz und August von mir. Sage ihnen meinen Dank dafür, dass sie ihr Versprechen eingehalten haben. Ich weiß, was ich von ihnen verlangt habe und welch schwere Bürde ich auf sie geladen haben muss.
Luise saß wie versteinert in ihrem Bett. Ihre Augen waren durch das ständige Weinen gerötet. Doch nun hatte sie keine Tränen mehr. Sie fühlte nichts mehr. Kein Mitleid für ihren Vater, keine Trauer und keine Freude über ihren Bruder, den sie doch niemals gehabt hatte. Sie nahm den Brief, legte ihn sorgfältig in den Knickfalten zusammen und steckte ihn zurück in den Briefumschlag. Er war früher bestimmt einmal weiß, fuhr es ihr durch den Kopf, doch nun ist er vergilbt. Offenbar verliert alles im Laufe der Zeit an Glanz – nicht nur Briefumschläge. Fast eine Stunde saß sie regungslos da und spürte die Kälte nicht. Nichts spürte Luise mehr.
Nach kurzem Klopfen betraten Fritz von Sydow und Dr. Freund ihr Zimmer. Sie waren überrascht, eine ruhige und gefasste Luise vorzufinden.
»Wie geht es dir, mein Kind?«, erkundigte sich Fritz.
Für einige Sekunden sah sie die beiden Männer still an, dann löste sich ihre Erstarrung. »Wie soll es mir gehen? Alle meine Wertvorstellungen über einen Menschen haben sich in nichts aufgelöst. Alles das, was ich an meinem Vater so geschätzt, bewundert und geliebt habe, war nur geheuchelt. Sein schlechtes Gewissen hat ihn dazu getrieben. Er war ein Ehebrecher!«, stieß sie zornig hervor. »Nicht nur das, er hat sogar einen unehelichen Sohn gezeugt. Während meine Mutter ein paar Stockwerke tiefer um ihr Leben gekämpft hat, wurde unter demselben Dach ein Kind geboren. Sein Kind! Was bin ich doch für eine dumme und verwöhnte Gans gewesen. Ich habe nur das gesehen, was ich sehen wollte. Den hilfsbereiten, edlen, Menschen, der niemals an sich selbst gedacht hat. Immer für alle und jeden da gewesen ist. Wie naiv ich war. Nichts hat er getan, weil es sein Naturell war, nein, mein Vater hat geholfen, weil er glaubte, dadurch diese Sünde wieder gutmachen zu können. Er hoffte, dass sie ihm vielleicht vergeben würde, wenn er vor unseren Herrn tritt. Nur gut, dass meine Mutter von all dem keine Ahnung hatte.«
»Luise, jetzt mach es dir doch nicht so schwer. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Schock für dich sein muss. Du hast deinen Vater doch geliebt, weil er dein Vater war, und nicht, weil er diese Eigenschaften hatte. Und sei ehrlich, glaubst du nicht, dass er genug dafür bezahlt hat? Behalte ihn so in Erinnerung, wie du ihn gekannt hast. Zerstöre dir das nicht und rede dir bitte nicht ein, dass er dich nur aus Berechnung geliebt hat. Du weißt, auch wenn du es jetzt nicht wahrhaben willst, dass ich die Wahrheit sage.«
Als ob sie es nicht gehört hätte, sagte sie: »Seine letzten Zeilen galten euch. Er bedankt sich dafür, dass ihr das Versprechen eingelöst habt. Er wusste zu schätzen, dass ihr dieses schwere Erbe auf euch genommen habt. Auch ich sage danke für eure Loyalität mir gegenüber. Ich hätte es nie erfahren, wenn ihr den Brief einfach vernichtet hättet.«
Fritz schien besorgt und wollte, dass sie sich schont.
»Nein, Onkel Fritz, mir geht es gut. Die Wahrheit zu erfahren, ist nun mal schockierend«, stieß sie gereizt hervor. Dann besann sie sich aber, ging versöhnlich zu ihrem Onkel und gab ihm einen Kuss. Auch Dr. Freund blieb nicht verschont.
»Ich werde mich jetzt anziehen und nach Hause gehen.« Mit diesen Worten schwang sie sich aus dem Bett, nahm ihre Kleider aus dem Schrank, und ohne sich umzudrehen, fragte sie den Arzt: »Mein Bruder und ich, haben wir uns wirklich geglichen, Dr. Freund? Sie müssen das doch beurteilen können, denn Sie waren bei meiner Geburt auch zugegen.«
»Ja, Luise, das ist wirklich so. Er hatte blonde Haare und blaue Augen wie du. Außerdem hatte er das unverkennbare Wittensteintemperament. Kaum war er auf der Welt, brüllte er los und forderte etwas zu essen. Er war ein hübscher kleiner Kerl.« Der Arzt lächelte still vor sich hin.
»Danke, Dr. Freund. Noch etwas möchte ich wissen. Warum musste das Kind bis zur Taufe unter dem Dach bleiben? Es hat doch jeder im Haus von ihm gewusst?«
»Mein liebes Kind, das hat etwas mit Sitten und Gebräuchen zu tun und auch mit Religion. Ungetaufte Kinder dürfen nicht unter die Menschen, da man Angst hat, dass sie dadurch eine Erkältung oder Schlimmeres bekommen und sterben, bevor sie den Segen Gottes empfangen haben. Deshalb werden sie in einer Art Isolation gehalten, damit dies nicht passiert. Am Tag der Taufe dürfen sie das erste Mal das Haus verlassen.« Der Arzt zögerte einen Augenblick. Es fiel ihm schwer abzuwägen, was das Richtige war. Dann sagte er: »Noch etwas, Luise. Vielleicht erleichtert es dir diese Sache, und du kannst es besser verkraften.« Er machte eine kurze Pause. Luise drehte sich zu ihm um. Er fuhr sich mit der Hand durch sein dichtes braunes, an den Schläfen schon leicht ergrautes Haar. Nachdem er tief Luft geholt hatte, räusperte er sich und sagte: »Deine Mutter wusste von dem Verhältnis zwischen deinem Vater und Heather. Sogar von deinem Bruder wusste sie.«
»Wie bitte?«, fragten Luise und ihr Onkel zeitgleich.
»Davon weiß ich nichts, August. Du hast mir nie etwas davon gesagt«, fügte sein Freund vorwurfsvoll hinzu.
»Ich weiß, Fritz, aber das durfte ich auch nicht. Ja, Luise, deine Mutter war zwar sehr krank, aber weder taub noch blind. Sie bemerkte das veränderte Verhalten deines Vater und die Heimlichkeiten des Personals. Jedes Mal bekam sie irgendwelche Ausflüchte zu hören, wenn sie direkt danach fragte. So spionierte sie selbst mit letzter Kraft, um hinter das Geheimnis zu kommen, und sie kam dahinter.«
Vor Entsetzen presste Luise die Hand auf den Mund. Sie versuchte, sich die Qualen vorzustellen, die ihre Mutter erleiden musste, als sie die Wahrheit herausbekam. »Arme Mutter. Das hat ihr das Herz gebrochen.«
»Es war nicht leicht für sie, denn sie konnte nichts dagegen tun. Außerdem spürte sie, dass sie bald sterben würde. Sie war sich vollkommen im Klaren darüber, dass dein Vater mehr brauchte als das, was sie ihm geben konnte. Niemals hätte sie verlangt, dass dein Vater alleine bleiben sollte, denn dafür liebte sie ihn zu sehr. Du kannst mir glauben, denn sie hat es mir gesagt. Ich habe oft bei ihr am Bett gesessen, und so hat sie mir vieles erzählt, was sie sonst keinem anvertraut hat. Für sie war es keine Ehe, die ihre Eltern für sie arrangiert hatten. Für sie war dein Vater der Mann, den sie aus Liebe geheiratet hatte. Schon länger quälte sie die Frage, was aus dir und Johann werden würde, wenn sie nicht mehr da sein würde. Als sie Heather kennen lernte und sah, wie wunderbar ihr drei harmoniertet, wusste sie, dass sie dir eine liebe Stiefmutter und deinem Vater eine gute Frau sein würde. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es stimmt.« Er nahm seine Brille ab, zog sein Taschentuch aus der Hosentasche und begann sie zu putzen, während er fortfuhr zu erzählen: »Nach der Geburt muss sie unbemerkt von den anderen die Stiege aufs Dach erklommen haben. Du kennst sicher die beiden Kammern dort. In dem rechten Raum kam Johann zur Welt. Niemand hat deine Mutter gesehen, auch dein Vater nicht. Ich sah sie im Spiegel, der über dem Waschtisch hängt, als ich mir die Hände nach der Geburt wusch. Sie hatte die Verbindungstür zwischen den beiden Stuben einen kleinen Spalt geöffnet und stand an den Türrahmen gelehnt. Als sich unsere Augen im Spiegel trafen, zuckte sie zusammen. Sie hatte kaum noch die Kraft, sich auf den Beinen zu halten. Trotzdem deutete sie mir, ihr nicht zu helfen, denn sie wollte unbemerkt bleiben. Kurze Augenblicke später schliefen Heather und ihr Kind erschöpft ein, und ich konnte deinen Vater dazu bewegen, das Zimmer zu verlassen. Ich weiß nicht, wie deine Mutter diese Anstrengung bewältigte, aber sie schaffte es, ins Zimmer zu gelangen. Lautlos rannen Tränen über ihr bleiches Gesicht. Ich glaubte, es seien Tränen der Wut, der Enttäuschung und der Eifersucht, denn das war die Reaktion, die ich von einer betrogenen Ehefrau erwartet hätte. Aber es waren Tränen des Glücks.« Tief ausatmend setzte er die penibel geputzte Brille auf die Nase zurück und steckte das Taschentuch wieder an seinen Platz. Dann sah er Luise an, damit sie erkennen konnte, dass er die Wahrheit sagte. »Ich glaube, ich werde mein ganzes Leben keinen verständnisvolleren Menschen mehr kennen lernen als deine Mutter, Luise. Ich gebe ehrlich zu, dass ich bis zu diesem Augenblick nicht geahnt hatte, dass es so einen Menschen überhaupt gibt. Sophie ging zu diesem kleinen neuen Erdenbürger und streichelte ihm zärtlich über das Köpfchen. Mit leiser Stimme sagte sie: ›Genauso hat meine kleine Luise ausgesehen. Nun kann ich in Frieden von ihnen gehen. Sie haben jemanden gefunden, der meine Stelle einnehmen wird. Ich danke dem Herrgott dafür, dass er mich das noch erleben ließ und mich nicht mit dieser Ungewissheit sterben lässt.‹ Niemals werde ich die Traurigkeit in ihren Augen vergessen, als sie das Kind ansah und flüsterte: »Wie gerne hätte ich Johann einen Sohn geschenkt, doch es war mir nicht vergönnte Sie küsste den Jungen zärtlich auf die Stirn und fiel dann erschöpft in Ohnmacht. Ich trug sie, ohne dass jemand Notiz von uns nahm, in ihr Zimmer zurück. Als ich sie auf ihr Bett legte und zudeckte, wachte sie auf und nahm mir das Versprechen ab, weder deinem Vater noch sonst irgendjemandem etwas über das Geschehene zu erzählen. Ich glaube, dass dieses Versprechen hiermit erloschen ist.«
Für einen Moment herrschte Schweigen in dem Zimmer.
»Unglaublich! Welche Bürde meine Eltern euch abverlangt haben. Wie sehr müsst ihr sie gemocht und geschätzt haben, dass ihr das über diese lange Zeit durchgestanden habt. Ich weiß nicht, wie ich euch jemals für eure Loyalität danken kann.«
»Verurteile deine Eltern nicht, Luise – sie waren Opfer ihrer Zeit!«
Kapitel 2
Weihnachtsabend 1790
»Das Essen war wie immer vorzüglich, Colette.«
»Danke, Luise. Anni und ich hatten zuerst ein anderes Mahl geplant, wegen der Erinnerung an all die vergangenen Weihnachtsfeste, aber dann …«
Luise legte zur Beruhigung die Hand auf Colettes Arm, denn sie merkte, dass ihre Freundin sich nur mühsam beherrschen konnte. »Schon gut, Colette, ihr habt richtig entschieden. Vater hätte es so gewollt, da bin ich mir sicher. Bring’ den Kaffee bitte in die Bibliothek.«
Als Luise damals ins Internat musste, bekam Colette die bestmögliche Ausbildung. Sie wurde von Anni und den anderen Angestellten in die Haushaltsführung eingewiesen. Seitdem war sie im Haushalt der Wittensteins tätig.
»Onkel Max, bitte folge mir in die Bibliothek! Ich glaube, es ist an der Zeit, über die Zukunft des Gutes und vor allem über meine Zukunft zu reden.«
Ihr Onkel, seine Frau Elfriede und sein Sohn Detlef wohnten seit der Beerdigung auf dem Gut. Sie wollten Luise über die Feiertage nicht allein lassen, war das Argument ihres Onkels, doch Luise wusste den wirklichen Grund. Er schnüffelte unauffällig in Haus, Hof, den Stallungen und sogar im Schreibtisch ihres Vaters herum, um sich ein Bild über den Zustand und die finanzielle Lage des Gutes zu machen. Luise ließ ihn gewähren und tat, als ob sie es nicht bemerkte. Sie nahm sich jedoch vor, dies bei gegebenem Anlass zur Sprache zu bringen.
»Ja, ja, ich habe mich schon gefragt, wann du davon anfängst.«
Seine Frau Elfriede und sein Sohn Detlef wollten sich entfernen und die zwei allein lassen, doch sie wurden mit barschem Ton zurückkommandiert: »Halt, meine Lieben, diese Sache geht auch euch etwas an!«, befahl er im Offizierston. So marschierten sie wie Gänse hinter ihrem Familienoberhaupt in die Bibliothek.
Wie Luise diesen Mann verabscheute. Sein Wesen, seine Art, mit Menschen umzugehen, sein Aussehen, einfach alles setzte Aggressionen in ihr frei, die sich nur schwerlich unterdrücken ließen. Sie konnte nicht verstehen, wie zwei Brüder so unterschiedlich sein konnten. Der eine gütig, verständnis- und liebevoll und der andere selbstgefällig, egoistisch, zynisch, machtbesessen und ohne Manieren. Sie seufzte leise, da ihr das Testament wieder einfiel. Wer weiß, wie ihr Vater geworden wäre, wenn nicht alle diese Schicksalsschläge passiert wären. Aber nein, sagte sie zu sich selbst, so wie Onkel Max wäre er bestimmt nicht geworden. Äußerlich glichen sie sich in keiner Weise. Max war genau das Gegenteil von ihrem Vater. Ihr Onkel war klein und korpulent. Voll gefressen dick wäre die richtige Beschreibung. Luise musste bei diesem Gedanken laut glucksen, verstummte aber sofort, als sie den strafenden Blick von Max sah. Sie betrachtete ihn genauer. Er hatte hellblondes, sich lichtendes Haar. Sein dickes Gesicht war stets ungesund gerötet. Wenn er sich aufregte, lief es dunkelrot an, und sein Hals bekam hässliche Flecke. Durch sein Übergewicht hatte er erhöhten Blutdruck und Probleme mit dem Herzen. Jede kleinste Anstrengung brachte ihn zum Schwitzen. Ständig war er damit beschäftigt, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Sein Mondgesicht zierte ein Monokel, das ihm seiner Meinung nach ein intelligentes Aussehen verlieh. Sicherlich, dumm war er gewiss nicht. Schließlich war er ein bekannter und mittlerweile auch berühmter Anwalt in Köln. Trotzdem, sie mochte ihn nicht.
»Also, meine liebe Nichte Luise«, begann er seinem Charakter entsprechend mit zynischem Unterton, »dein Patenonkel Fritz hat dich sicher über den Sachverhalt der Dinge aufgeklärt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Vater imstande war, das Geld zusammenzubekommen …« Er lächelte süffisant und sah Luise dabei unverblümt an. »… und du wirst es sicher auch nicht haben, oder?«
Peinlich berührt und wütend stieß Luise hervor: »Wie, bitte, soll ich so viel Geld aufbringen?«
»Ehrlich gesagt, ist mir das ziemlich egal. Von mir aus stiehl es. Gleichgültig, was du tust, die Frist ist jedenfalls bald abgelaufen, und dann will ich mein Geld, oder …«
»Wie kannst du es wagen, so mit deines Bruders Kind zu sprechen«, unterbrach ihn seine Frau erregt.
»Meine liebe Elfriede, wer hat dich nach deiner Meinung gefragt?«, antwortete Max leise. Wieder umspielte dieses zynische Lächeln seine Mundwinkel. Man konnte an seinem Gesichtsausdruck klar erkennen, dass er keinerlei Achtung vor seiner Frau hatte.
Luise versuchte mit einem zaghaften Kopfschütteln, ihrer Tante zu signalisieren, dass sie sich nicht einmischen sollte. Sie hatte Angst vor dem dann folgenden unvermeidlichen Wutausbruch ihres Onkels. »Mein lieber Onkel Max, ich schreibe dein flegelhaftes Benehmen dem übermäßigen Genuss unseres delikaten Weines zu und entschuldige es daher. Aber du hast recht, ich habe das Geld nicht, und sosehr ich auch an meinem Zuhause hänge, stehlen werde ich deshalb bestimmt nicht. Also ist dein Vorschlag unbrauchbar. Sage mir jetzt bitte ernsthaft, was du mit dem Gut vorhast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du deine gut gehende Kanzlei in Köln aufgeben und aufs Land ziehen willst. Außerdem hast du von Weinanbau keine Ahnung.«
Sie hatte kaum zu Ende gesprochen, als Max’ Stimme durch den Raum dröhnte. Die Erde schien zu beben. Jeder im Zimmer zuckte zusammen. »Was erlaubst du dir, du Grünschnabel? Was weißt du von mir? Du scheinst vergessen zu haben, dass auch ich in diesem Haus geboren wurde und somit hier aufgewachsen bin. Meine gesamte Jugend hat sich um den Wein und alles, was mit Wein zu tun hat, gedreht.«
»Entschuldige bitte, Onkel Max, ich habe kein Recht, so etwas zu sagen und an deinen Fähigkeiten zu zweifeln«, bat Luise eingeschüchtert um Verzeihung.
Er schien nun milder gestimmt zu sein, goss sich wieder Wein nach und leerte das Glas, wie schon die unzähligen zuvor, in einem Zug. Durch den hohen Alkoholgenuss hatten sich seine Wangen noch stärker gerötet. Die Augen hatten sich verkleinert, und in seinem aufgedunsenen Gesicht waren sie nur noch als Schlitze zu erkennen. Er glich immer mehr einem dicken rosa Schweinchen.
»Aber du hast nicht ganz Unrecht, liebe Nichte. Im Laufe der Jahre hat sich einiges geändert, auch in einem traditionellen Weinanbaubetrieb wie diesem hier. Deshalb mache ich dir dieses großzügige Angebot.« Es folgte eine Pause, um dem, was jetzt kam, noch mehr Bedeutung beizumessen. »Du kannst Herrin auf Gut Wittenstein bleiben, wenn …« Nun machte Max erneut eine Pause. Er sah dabei in die gespannten Gesichter seiner Familie und fing an zu grinsen. Zwar nur ganz zaghaft, aber doch so, dass es die anderen bemerken konnten. Man hörte kein Atmen, nicht das kleinste Geräusch war zu vernehmen. »… wenn du Detlef heiratest!«
Als die Schrecksekunde vorbei war, schrien Luise, Detlef und Elfriede wie aus einem Munde: »Was?«