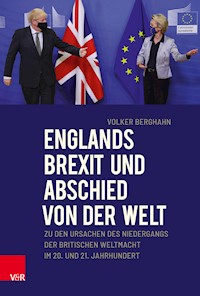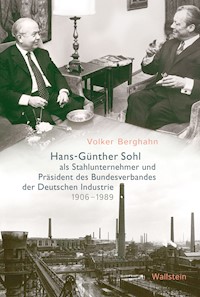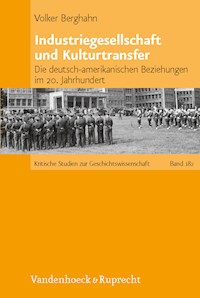8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Knapp und anschaulich stellt dieser Band die Geschichte des Ersten Weltkriegs dar. Volker Berghahn erläutert darin nicht nur die Militär- und Politikgeschichte des Krieges, sondern auch die Sozial- und Alltagsgeschichte an Front und Heimatfront. Ein Vorwort zur Neuauflage behandelt zunächst die neuesten Forschungen. Nach einer Erläuterung der Ursprünge des Krieges und der Julikrise von 1914 folgt dann eine Analyse des Krieges aus der Perspektive der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Eliten, bevor in einem weiteren Kapitel von «unten» die Erfahrungen von Millionen von Soldaten an allen Fronten sowie der in der Heimat zurückgebliebenen Frauen und Kinder geschildert werden. Das Buch endet mit einer Darstellung des Zusammenbruchs erst des russischen Zarenreichs 1917 und der beiden mitteleuropäischen Monarchien ein Jahr später.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Volker Berghahn
DER ERSTE WELTKRIEG
C.H.Beck
Zum Buch
Knapp und anschaulich stellt dieser Band die Geschichte des Ersten Weltkriegs dar. Volker Berghahn erläutert darin nicht nur die Militär- und Politikgeschichte des Krieges, sondern auch die Sozial- und Alltagsgeschichte an Front und Heimatfront. Ein Vorwort zur Neuauflage behandelt zunächst die neuesten Forschungen. Nach einer Erläuterung der Ursprünge des Krieges und der Julikrise von 1914 folgt dann eine Analyse des Krieges aus der Perspektive der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Eliten, bevor in einem weiteren Kapitel von «unten» die Erfahrungen von Millionen von Soldaten an allen Fronten sowie der in der Heimat zurückgebliebenen Frauen und Kinder geschildert werden. Das Buch endet mit einer Darstellung des Zusammenbruchs erst des russischen Zarenreichs 1917 und der beiden mitteleuropäischen Monarchien ein Jahr später.
Über den Autor
Volker Berghahn, geb.1938, lehrte moderne deutsche und transatlantische Geschichte an der Columbia University in New York. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören die deutsche und europäische Geschichte im 19. und 20.Jahrhundert. Er hat u.a. veröffentlicht: «Der Stahlhelm» (1966), «Der Tirpitz-Plan» (1971), «Imperial Germany» (1994) und «America and the Intellectual Cold Wars in Europe» (2001).
Inhalt
Prolog Kriegsursachen und Kriegsausbruch 1914: Ein Blick auf aktuelle Debatten
I. Der Erste Weltkrieg und seine Kosten
1. Der Erste Weltkrieg und das 20.Jahrhundert
2. Eine Verlustrechnung
3. Der Erste Weltkrieg und die Geschichtswissenschaft
II. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs
1. Die tieferen Ursachen
2. Die Verantwortung der Entscheidungsträger
3. Missmanagement und Fehlkalkulationen in der Julikrise 1914
III. Der Erste Weltkrieg ‹von oben›: Strategie, Diplomatie und ihre Ziele
1. Die Generäle
2. Neutralität und Bündnispolitik
3. Wirtschaftseliten, Kriegsziele und Innenpolitik
IV. Der Erste Weltkrieg ‹von unten›: Front und Heimatfront
1. Bevölkerung und Kriegsausbruch
2. Die Totalisierung des Krieges an der Front
3. Die Totalisierung des Krieges an der Heimatfront
V. Besiegte und «Sieger»
1. Revolution in Russland
2. Revolution in Zentraleuropa
3. Friedensschluss
Ausgewählte Bibliografie
Personenregister
Fußnoten
Für Mac
Prolog Kriegsursachen und Kriegsausbruch 1914: Ein Blick auf aktuelle Debatten
Der Erste Weltkrieg wird schon seit Langem in der Geschichtswissenschaft als die «Urkatastrophe» des zwanzigsten Jahrhunderts angesehen, die den Verlauf der Jahrzehnte nach 1918 bis zum Zusammenbruch des Ostblocks 1989/90 und darüber hinaus bis in unsere Tage fundamental beeinflusst hat.[1] Schon das an sich unhistorische Gedankenspiel mit der Frage macht dies deutlich: Wie hätte sich die neueste Zeit entfaltet, wenn die Großmächte im August 1914 nicht in den Abgrund eines totalen Krieges gestürzt wären, an dessen Ende mindestens zwanzig Millionen Tote zu beklagen waren? Keine Doppelrevolution in Russland 1917? Kein Zusammenbruch von drei Monarchien in Zentral- und Osteuropa sowie des Osmanischen Reiches? Kein Faschismus? Kein Stalinismus? Kein Zweiter Weltkrieg? Kein Holocaust? Kein Kalter Krieg? Kein Ende des Kolonialismus mit seinen menschenverschlingenden Befreiungskriegen? Die Kette der nach 1918 entstandenen Probleme ließe sich fortsetzen.
Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass die hundertjährige Wiederkehr des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs bereits zahlreiche Bücher und wissenschaftliche Aufsätze gezeitigt hat.[2] Für 2014 werden in der ganzen Welt Konferenzen und Seminare veranstaltet, die zu weiteren Veröffentlichungen führen. Es ist angesichts der Fülle von allein 2013/14 erschienenen Publikationen bereits schwer, sich ein klares Bild zu machen, wo wir heute in der Weltkriegsforschung stehen. Darüber hinaus wäre eine Reihe wichtiger Studien einzubeziehen, die anlässlich früherer Jahrestage 1994 und 2004 veröffentlicht wurden.[3] Letztere lassen sich historiografisch generell in solche aufteilen, die die Ereignisse «von oben» oder «von unten» betrachten. In diesem Band ist über diese beiden Perspektiven auf den Seiten 11–15 zu lesen. Allerdings haben diese Studien keine Grundsatzdebatten ausgelöst, ob man die Jahre 1914–1918 vorzugsweise in ihren politisch-militärischen oder in ihren sozioökonomisch-kulturellen Dimensionen analysieren soll.
Die Lage ist anders, soweit es die Ursachen und den Verlauf der Julikrise 1914 im engeren Sinne betrifft. Hier hat sich erneut eine lebhafte Debatte über Verantwortung und Schuld entwickelt, die im Folgenden vorgestellt werden soll, um Lesern und Leserinnen den Einstieg in die späteren Kapitel zu erleichtern. Zuvor müssen allerdings zwei wichtige Erkenntnisse erwähnt werden, über die sich die Forschung zum Kriegsausbruch nicht mehr heiß streitet. Hier ist als Erstes die Kriegsbegeisterung zu nennen, die im August 1914 wie ein Tsunami durch ganz Europa geschwappt sein soll. Wer Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues gelesen oder die amerikanische Verfilmung mit dem Titel All Quiet on the Western Front gesehen hat, wird sich an den Anfang erinnern. Dort ziehen Soldaten vor jubelnden Menschen an den Fenstern eines Gymnasiums vorbei, während drinnen im Klassenzimmer ein nationalistischer Lehrer seine Schüler antreibt, sich blutjung zum Frontdienst zu melden.
Die Kriegsbegeisterung, die in vielen Schulbüchern wiederholt wird, hat die neuere Forschung gründlich als Mythos entlarvt. Wohl gab es eine Begeisterung vor allem in den Städten, doch – wie wir jetzt wissen – reagierte die Mehrheit der Menschen gedrückt auf den Mobilisierungstrubel. Jean-Jacques Becker hat dies schon vor Jahren für Frankreich nachgewiesen.[4] Für Italien, Russland und andere Länder sind heute ähnliche Stimmungen dokumentiert.[5] Sehr deutlich formulierte ein älterer Sozialdemokrat die zwiespältige Stimmung in Hamburg: «Vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof fanden sich Tag für Tag viele Genossen ein. Wir standen dem Treiben ziemlich verständnislos gegenüber. Viele fragten sich: ‹Bin ich verrückt oder sind es die anderen.›»[6] Es ist auch seit Langem bekannt, dass in vielen deutschen Städten Friedensdemonstrationen stattfanden, die die Regierung in Wien und Budapest warnen sollten, die Krise auf dem Balkan nach dem Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger und seine Frau am 28. Juni 1914 nicht zu einem Krieg gegen Serbien zu eskalieren.[7] Was Millionen von Männern am Ende als Freiwillige oder Wehrpflichtige an die Front ziehen ließ, waren nicht Aggressionsgefühle, sondern die feste Überzeugung, dass man sich für eine Verteidigung des Vaterlandes gegen einen Angreifer einsetzte. Es ist auch bezeichnend für die eher pessimistische Grundstimmung der Bevölkerungen Europas, dass viele aus Angst vor einer Katastrophe ihre Ersparnisse von den Banken abhoben.[8]
Dieses Verhalten weist, zweitens, auf die Sphäre der Banken- und Geschäftswelt. Noch vor vierzig Jahren waren Teile der historischen Forschung der Meinung, dass die eigentlichen Kriegstreiber und Kriegsauslöser vor 1914 in der Industrie und den Finanzhäusern saßen. Auch hier wissen wir heute mehr. Zwar gab es einzelne Unternehmer in der Schwerindustrie, die an dem Rüstungswettlauf vor 1914 gut verdient hatten und sich für weitere staatliche Waffenbestellungen stark machten; doch gab es in allen Ländern auch unter den Wirtschaftseliten eine Mehrheit, die einen großen Krieg fürchtete wie die Pest. Sie wiesen auf die damaligen internationalen Handelsverflechtungen hin, die bei einem Weltbrand zusammenbrechen würden. Auch hatten sie ein besseres Verständnis dafür, welche enormen Opfer an Menschenleben und materiellen Ressourcen ein totaler Krieg zwischen Industrienationen kosten würde.
Dementsprechend versuchten diverse Bankiers und Unternehmer im Juli 1914, den Politikern und Militärs ihre Kriegsgedanken auszureden.[9] Den Argumenten von Norman Angell und Herbert Spencer folgend, waren viele überzeugt, dass es in einem solchen Krieg keine Sieger, sondern nur Verlierer geben würde und dass friedlicher Handel militärischen Konflikten auf jeden Fall vorzuziehen sei.[10] Wie das Wall Street Journal noch am 28. Juli dazu schrieb: «The whole world is engaged in business as never before. Industrial Germany in thirty years has far outrun military Germany. Throughout the civilized world, villages have become mill centers; towns have become cities; empires have succeeded states, and the Empire of the modern world is commercial and not martial.»[11] Diese Einstellung bedeutete freilich nicht, dass man in den Kolonien auch weiterhin begrenzte «Strafexpeditionen» gegen rebellische «Eingeborene» nicht befürwortete, die dort für «Ruhe und Ordnung» sorgten.
Indes, nach allem, was über die Geschäftswelt bekannt geworden ist, konnte sie die Politiker und Militärs nicht vom Abgrund zurückhalten, die nach der Verfassung die alleinige Entscheidungsgewalt über Krieg und Frieden innehatten. Sie alle – die Groß- und Privatbankiers wie die Rothschilds in England und Frankreich oder wie der Generaldirektor der HAPAG in Hamburg – mochten Einfluss in den Machtzentren besitzen, aber die Macht, einen Stopp und eine Wende zum Kompromiss einzuleiten, hatten jeweils nur die Monarchen und ihre politische und militärische Entourage. Nur Wilhelm II., Franz Joseph I. und Zar Nikolaus II. konnten die Mobilisierungsbefehle geben oder zurücknehmen. In England und Frankreich bedurften die Entscheidungsberechtigten noch der Zustimmung ihrer Kabinettskollegen und der Parlamentsmehrheit. Erst als der Kaiser unter Bruch der belgischen Neutralität in das kleine Nachbarland einfiel, um nach dessen Kapitulation von Norden her auf die Eroberung von Paris einzuschwenken, fand Außenminister Sir Edward Grey im Kabinett und Parlament die erforderliche Unterstützung für die Kriegserklärung gegen Deutschland. Jenseits dieser verfassungsbedingten Gegebenheiten beginnt nun die neueste Debatte zur Julikrise 1914.[12]
Einen guten Einstieg hierzu bietet Christopher Clark mit seinem Buch Die Schlafwandler, eine Studie, die Ende 2013 in Deutschland auf der Bestsellerliste für Sachbücher des Nachrichtenmagazins Der Spiegel stand und in Amerika von der New York Times im Dezember 2013 zu den zehn besten Büchern des Jahres gekürt wurde.[13]Dieses 900-seitige Werk zeichnet sich dadurch aus, dass es den Blick nicht sogleich auf Berlin und Wien richtet, sondern auf den Balkan und Russland. Ausführlicher als ältere Gesamtdarstellungen der Julikrise 1914 gelingt es Clark, ein facettenreiches Bild der Zustände und Entwicklungen in Südosteuropa zu zeichnen, wo 1912 und 1913 Regionalkriege zuerst gegen das Osmanische Reich und danach zwischen Bulgarien, Rumänien, Serbien und Griechenland stattfanden.
Anschließend konzentriert sich der Autor mehr und mehr auf Serbien und dessen gegen das Habsburger Reich gerichtete Ziele. Belgrad sieht sich als das Zentrum einer nationalistischen und expansiv gegen Wien und Budapest organisierten Bewegung, durch die alle Slawen der Region in einem groß-serbischen Reich zusammengeführt werden sollen. Mit Unterstützung des serbischen Geheimdienstes, aber wohl nicht der Regierung in Belgrad, finden sich in Geheimzirkeln junge Nationalisten zusammen, um Anschläge zu verüben. Nach dem Attentat von Sarajewo setzen sie eine Kettenreaktion in Gang, die vier Wochen später im Weltkrieg endete. Es scheint, dass Clarks Perspektive durch unsere heutigen Erfahrungen beeinflusst ist. Auf jeden Fall zeigt er, wie Attentäter eine massive Lawine lostraten, die im Weltkrieg resultierte. Clark zufolge war vor 1914 auch das Zarenreich in den Sog der Balkankonflikte geraten.
Doch bevor dessen Argumentation zu diesem Thema näher zu beleuchten sein wird, muss auf das Buch von Sean McMeekin eingegangen werden, und dies nicht nur weil es vor Clark erschien und diesen in seiner Sicht der Rolle Russlands inspiriert zu haben scheint, sondern auch weil er das Zarenreich für den Ersten Weltkrieg verantwortlich macht, eine These, die vor langer Zeit von L.C.F. Turner und danach erneut von Edward McCullough vorgetragen wurde.[14]
Soweit es die Julikrise 1914 betrifft, konzentriert sich McMeekin auf die Petersburger Schachzüge und vor allem auf das Zusammenspiel von Außenminister Sergei Sasonow und der militärischen Führung. Zwar habe man nach der Veröffentlichung des österreichisch-ungarischen Ultimatums in Belgrad lediglich eine Teilmobilisierung der Armee beschlossen, die von Sasonow bloß als Warnung gegen etwaige kriegerische Absichten Wiens auf dem Balkan heruntergespielt wurde; die tatsächlichen Vorbereitungen seien McMeekin zufolge von Anfang an jedoch sehr viel weiter gegangen und hätten die Auslösung eines großen Krieges gegen den Zweibund angesteuert, den man gewinnen zu können glaubte.
Für den Autor sind also die vier Tage vom 25. bis zum 29. Juli entscheidend, für die er als Beweismittel für seine Interpretation eine ganze Reihe von Dokumenten und späteren Aussagen heranzieht. Anhand dieser weist er scharfsinnig und durchaus überzeugend nach, dass im Westen des Landes sehr viel umfangreichere militärische Maßnahmen ergriffen wurden, die einer Vollmobilisierung gleichkamen. Nicht weniger wichtig ist, dass diese Entwicklungen der deutschen Seite bekannt wurden, sodass diese den Versicherungen Sasonows und anderer Diplomaten, es handele sich lediglich um eine Teilmobilisierung, nicht mehr glaubten.
Mit anderen Worten, McMeekin zufolge wussten Generalstabschef Helmuth von Moltke und Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg schon vor der offiziellen Verkündung der russischen Vollmobilisierung am 31. Juli, dass St. Petersburg das Ziel eines großen Krieges verfolgte. Daraufhin drängte jetzt Moltke mehr denn je den Kaiser, die eigene Vollmobilisierung zu befehlen, bevor es zu spät sei. Dies bildete den Hintergrund des deutschen Ultimatums an Nikolaus II., seinen Befehl bis zum 1. August zurückzuziehen. Als dies nicht geschah, weil es infolge der schon längst angelaufenen Vorbereitungen gar nicht mehr möglich war, unterschrieb der Kaiser am Nachmittag des 1. August den entsprechenden deutschen Befehl. Der große Vorteil dieser Abfolge war, dass Berlin sich nun rechtfertigen konnte, sich in einem Verteidigungskrieg gegen Russland zu befinden. So erklärt sich auch der Satz aus dem Tagebuch des Marinekabinettschefs Georg Alexander von Müller, die Reichsleitung habe «eine glückliche Hand gehabt, uns als die Angegriffenen hinzustellen».[15]
Doch warum zielte das Zarenreich auf einen großen Krieg gegen die Mittelmächte? Hier sind für McMeekin die seit Langem formulierten und nun zu verwirklichenden Kriegsziele zentral. Seit Jahren schon habe das russische Außenministerium die territoriale Expansion nach Süden und Südwesten und den Zugang zum Mittelmeer durch eine Eroberung der Dardanellen anvisiert. Zum Teil auf russischen Quellen basierend, entwickelt der Autor das Bild einer bewusst verfolgten und langfristig gut koordinierten imperialistischen Politik St. Petersburgs, die auf eine Beerbung des zerfallenden Osmanischen Reiches abzielte.