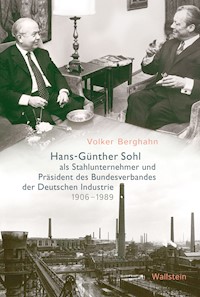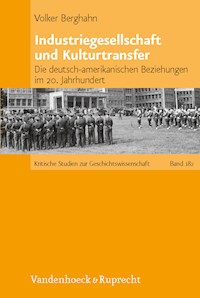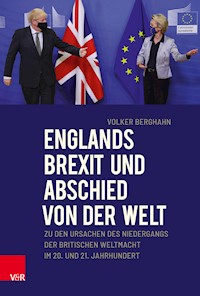
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als sich 2016 die knappe Mehrheit der Briten in einem Volksentscheid für den Austritt aus der EU entschied, schüttelten nicht nur die Bürger der europäischen Nachbarländer den Kopf. Warum glaubte eine Nation im Zeitalter der internationalen Verflechtungen ihrer Wirtschaft und Politik, im Alleingang durch Erlangung nationaler Souveränität einen erneuten Aufstieg in den Kreis der Großmächte erreichen zu können? Volker Berghahn stellt den Brexit in eine langfristige historische Entwicklung, ohne die die Traditionen und Emotionen, die in der heftig geführten Debatte der letzten vier Jahren an die Oberfläche kamen, nicht zu verstehen sind. Er zeigt, dass die Wurzeln des Brexit in den beiden von Deutschland ausgelösten Weltkriegen und des dadurch verursachten wirtschaftlichen und politischen Niedergangs Großbritanniens im 20. Jahrhundert liegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Berghahn
Englands Brexit und Abschied von der Welt
Zu den Ursachen des Niedergangs der britischen Weltmacht im 20. und 21. Jahrhundert
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2021 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich) Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Boris Johnson und Ursula von der Leyen, Brüssel 9.12.2020.
© picture alliance/ASSOCIATED PRESS | Aaron Chown
Korrektorat: Ulrike Weingärtner, Gründau
Satz: textformart, Göttingen | www.text-form-art.de
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, KölnEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99441-3
Inhalt
Einleitung
1.Großbritannien vor und nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs
1.1Großbritannien als erste Weltmacht des 19. Jahrhunderts
1.2Die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland als Herausforderer des britischen Empire
1.3Monarchische Verfassung und maritime Machtpolitik im Deutschen Kaiserreich
1.4Armeerüstungen und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs
1.5Der nicht gewollte Krieg und die Schwächung der britischen Weltstellung
1.6Englands und Amerikas Suche nach Restabilisierung
2.Britische und deutsche Wirtschafts- und Außenpolitik bis zur Suez-Krise 1956
2.1Amerikas Rückzug aus Europa und der britische Konsortiumsplan
2.2Wirtschaftsaufschwung und amerikanische Industrie, 1924–1929
2.3Die Bekämpfung der Großen Depression und die mit Hitlers Aufstieg verbundene Gefahr für den Frieden
2.4Deutschlands von England nicht gewünschter Eroberungskrieg und die Rolle der USA
2.5Alliierte Friedensplanungen nach dem Eintritt der USA in den Weltkrieg, 1941–1945
2.6Großbritannien und Westdeutschland nach dem Ende des Weltkriegs, 1945–1962
3.England und die Europäische Gemeinschaft, 1962–1979
3.1Britische Wirtschaft, das zerfallende Empire und Westeuropa, 1962–1969
3.2Großbritanniens Politik und Wirtschaft während der Krise der siebziger Jahre
3.3Thatchers Aufstieg und die Finanzialisierung der britischen Wirtschaft, 1979–1987
3.4Das Ringen um eine Lösung der »Deutschen Frage«, 1988–1992
3.5Von Premierminister Tony Blair zu David Cameron
3.6Das Referendum und seine Folgen, 2016–2017
4.Britisch-europäische Brexit-Verhandlungen 2018–2020
4.1Die Ergebnisse des Volksentscheids von 2016 im Detail
4.2Theresa May und die Brüsseler Austrittsverhandlungen mit der EU
4.3Die Suche nach einer Parlamentsmehrheit für Mays Vereinbarungen mit der EU
4.4Der Aufstieg von Boris Johnson
4.5Der verzweifelte Kampf um einen weichen Brexit
4.6Johnsons Brexit zum 31. Oktober und dessen weiteres Hinausschieben
4.7Die Wahlen vom Dezember 2019, Johnsons Sieg und die Folgen
5.2020: Das lange Jahr der Verhandlungen mit der EU
5.1Großbritannien am 31. Januar 2020
5.2Machtkämpfe in der Johnson-Regierung und die Wiederaufnahme von EU-Verhandlungen
5.3Die Irische Frage
5.4Zur Lage der britischen Wirtschaft nach dem 31. Januar 2020
5.5Mangelnde Vorbereitungen auf den herannahenden Brexit
5.6Wachsende politische Kritik an Johnson und das Drängen der EU auf einen Vertrag
5.7Die harten Brexiteers in der Downing Street und deren Entlassung
5.8Rettungsversuche vor Toresschluss und britischamerikanische Beziehungen
6.Die Einigung vom 24. Dezember 2020 und deren öffentliche Rezeption
6.1Die Finten des Boris Johnson
6.2Stockende Verhandlungen und die wachsende Ungeduld der EU
6.3Johnsons innenpolitische Machtstellung und die Expertise der EU-Bürokratie
6.4Die Einigung vom 24. Dezember 2020
6.5Britische und europäische Reaktionen auf das Vertragswerk
6.6Die Strategien der EU im System der Großmächte nach dem britischen Austritt
Schlussbetrachtung
Dank
Anmerkungen
Namen- und Sachregister
Einleitung
Im November 2016, wenige Monate nach dem britischen Volksentscheid, in dem sich eine knappe Mehrheit der Wähler entschied, der Europäischen Union (EU) den Rücken zu kehren, schrieb der bekannte schottische Journalist Neal Ascherson, England bereite sich darauf vor, von der Welt Abschied zu nehmen.1
Inzwischen ist der britische »Brexit« aus der EU unter dramatischen Umständen vollzogen worden, nachdem man sich im Innern heftigst über ein Verbleiben oder ein Ausscheiden aus der Europäischen Gemeinschaft gestritten hatte. Es kam zu einer Polarisierung der öffentlichen Meinung und einer verfassungspolitischen Paralyse, wie sie das Land bis dahin noch nicht erlebt hatte. Zwar war Großbritannien nach langem Zögern und einer Volksabstimmung 1975 endlich in diese Gemeinschaft aufgenommen worden, wobei es ebenfalls zu emotionalen Auseinandersetzungen zwischen Eintrittsbefürwortern und ihren Gegnern gekommen war.
Aber was zwischen 2016 und dem Durchbruch der »Brexiteers« zum 31. Januar 2020 und schließlich zum 31. Dezember 2020 an Argumenten und Gegenargumenten im (noch) »Vereinigten Königreich« vorgebracht wurde, hatte niemand vorhergesehen.
Am Ende waren alle Wähler im Dezember 2019 so erschöpft, dass sie bei einer erneut abgehaltenen Abstimmung nicht mehr auf die Alternativprogramme der Labour-Partei, der Liberaldemokraten und anderer Warner hörten. Vielmehr folgten sie in ihrer großen Mehrheit in England der einzigen von den Konservativen unter Premierminister Boris Johnson ausgegebenen Wahlparole: »Let’s get Brexit done« (»Lasst uns den Brexit hinter uns bringen.«). Während die Schotten, Nordiren und auch Teile von Wales mehrheitlich erneut gegen diesen Bruch stimmten, schwenkten viele englische Wahlbezirke mit ihrem Mehrheitswahlsystem entschieden auf die Konservativen ein. Labour wurde aus traditionellen Arbeitervierteln verdrängt, und die Liberaldemokraten verloren fast alle Sitze. Für die nächsten fünf Jahre verfügte Johnson damit über eine Parlamentsmehrheit, mit der er im Prinzip nicht nur den Austritt organisieren, sondern auch radikale innen- und außenpolitische Veränderungen durchführen kann.
Vor dem Hintergrund der Suche nach Erklärungen für diese dramatischen Entwicklungen, die auch die verbleibenden 27 Mitglieder der Europäischen Union sehr direkt tangieren, ist als Erstes interessant, dass sich 2016 eine Gruppe von Fachhistorikern, die sich »Historians for Britain« nannte, bemühte, in die schwankenden Emotionen etwas Ordnung hineinzubringen. Sie meinten, dass Großbritannien im Vergleich zu den Gesellschaften des europäischen Kontinents seit langem einen anderen Weg gegangen sei. Sie wiesen dabei auf die Insellage, die Entwicklung des britischen Parlamentarismus, die unterschiedlichen Rechtstraditionen sowie das Weltreich hin, auch um zu erklären, warum sich das Land nach 1945 von der europäischen Integrationsbewegung fernhielt, 1975 dann aber in einem Volksentscheid mehrheitlich zu 57 Prozent für einen verspäteten Eintritt in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft stimmte. Allerdings verstummten die Euroskeptiker und -kritiker auch hiernach nie und waren daher auch nicht an einer vertieften Integration interessiert, auf die viele überzeugte Europäer gerade auch in der Bundesrepublik hinarbeiteten.
Der Regensburger Historiker Mathias Häußler hat im April 2019 in einem Aufsatz in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte nicht nur Studien vorgestellt, die postulierten, dass Großbritannien einen Sonderweg beschritten habe, sondern diese Arbeiten zugleich der wissenschaftlichen Literatur gegenübergestellt, die die Argumente der »Historians for Britain« einschränkte, wenn nicht gar ganz zurückwies.2 In der Sicht dieser Autoren war das Land mit dem Kontinent von jeher eng verflochten. Allerdings sei das Verhältnis, so Häußler, mit unterschiedlichen Gewichtungen immer sehr komplex gewesen. Seien doch bei der Analyse der britischen Einstellungen zur europäischen Integration immer auch sich verschiebende, innergesellschaftliche Machtbalancen in Rechnung zu stellen. Indessen geht es in den folgenden Kapiteln nicht nur um die britische Innenpolitik, sondern gerade auch um äußere Einflüsse und die Rolle Amerikas und Deutschlands, die in die britische Geschichte seit dem späten 19. Jahrhundert ebenfalls stark hineinwirkten.
Dieses Buch verfolgt somit zwei Ziele. Das erste Ziel ist, auf knappem Raum die tieferen historischen Wurzeln des »Brexit« zu untersuchen. Im Folgenden geht es also nicht lediglich um eine Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Jahre. Auf der Suche nach Antworten auf den nun vollzogenen »Brexit« soll vielmehr nach der Vorgeschichte des britischen Entschlusses von 2016 gefragt werden. Denn ohne einen Rückgriff auf diese Vorgeschichte sind die Traditionen und Emotionen, die in der Debatte in den letzten vier Jahren an die Oberfläche kamen, nicht zu verstehen. Allerdings ist es nicht nötig, gleich mehrere Jahrhunderte weit in die Entwicklung Großbritanniens zurückzugehen. Vielmehr beginnt die folgende Analyse in den Jahrzehnten ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als das Land mit seinem weit verzweigten Empire in der Weltpolitik und Weltwirtschaft eindeutig die Spitzenposition einnahm. Doch dann begann bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bereits der langsame Niedergang des britischen Weltreichs.
Dieser Niedergang hing zum einen mit dem Aufstieg der Vereinigten Staaten von Amerika zusammen, die sich in diesen Jahrzehnten von einem Land einwandernder Siedler und Landwirte zu einer der stärksten Industriemächte der Welt entwickelten und Großbritannien sodann im 20. Jahrhundert den Rang abliefen. Indessen fiel das Land nicht nur gegenüber Amerika zurück, sondern sah sich auch mit dem Deutschen Kaiserreich konfrontiert, das noch explizierter als die USA den Ehrgeiz entwickelte, das britische Weltreich zu überholen. Im August 1914 verwickelten Kaiser Wilhelm II. und seine Berater England gar in einen Weltkrieg, den das Reich siegreich bestehen zu können glaubte, sofern es ein nur wenige Monate andauernder Blitzkrieg war. Doch es kam anders: Der schnelle deutsche Durchbruch im Westen wollte nicht gelingen. An der Westfront begann ein Stellungskrieg, während sich der Konflikt zu einem globalen Kampf erweiterte, in den im April 1917 schließlich die USA auf Seiten der Alliierten eingriffen. Fünf Jahre später, im Herbst 1918, brachten die Briten, Franzosen und Amerikaner den Deutschen nicht nur eine vernichtende Niederlage bei. Vielmehr hatte der Kampf auch den Inselstaat und dessen Kolonialreich stark geschwächt.
Obwohl die USA aufgrund des Ausgangs des Weltkriegs objektiv gesehen das britische Empire bereits in seiner wirtschaftlichen Vormachtstellung überrundet hatten, nahmen sie die daraus entstandenen Vorteile in den zwanziger Jahren in der internationalen Politik noch nicht wahr, sondern zogen sich auf den amerikanischen Kontinent zurück. Die Industrie und die Banken investierten in den Mittzwanzigern zwar privat in europäische und gerade auch in deutsche Unternehmen, ohne eine ausdrückliche Absicherung der Anleihen seitens der amerikanischen Steuerzahler zu besitzen. Es gab eine Boomperiode der amerikanischen Wirtschaft, aus der sich die Politiker in Washington heraushielten und die sie allenfalls mit guten Worten unterstützten. Doch dann brach 1929 die Große Depression über die Welt herein. Angesichts hoher Verluste und zahlloser Firmenbankrotte zogen sich die USA daraufhin weitgehend aus der Weltpolitik und Weltwirtschaft zurück, bis das Land 1941 erneut in einen Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, gegen Deutschland sowie Japan und Italien hineingezogen wurde.
In diesem Konflikt wiederholte sich das Drama des Ersten Weltkriegs. Wiederum ausgelöst durch die imperialistischen Ambitionen des Deutschen Reiches standen Großbritannien und die Vereinigten Staaten zum zweiten Mal innerhalb einer Generation in einem gemeinsamen Kampf gegen einen von der nationalsozialistischen Hitler-Diktatur ausgelösten Eroberungs- und Ausbeutungskrieg, diesmal noch unterstützt durch die Expansionspolitik des italienischen Faschismus in Afrika und des militaristischen Japan in China und Südostasien. Als diese drei Diktaturen 1945 endlich besiegt worden waren, ging England noch geschwächter aus diesem Weltkonflikt hervor als nach 1918, während die USA nicht nur eindeutig die erste westliche Wirtschaftsmacht waren, sondern ihre Vorstellungen von Weltmacht diesmal nicht nur gegenüber den Deutschen und Japanern politisch durchsetzen wollten, sondern auch gegenüber dem jetzt noch mehr geschwächten Alliierten, dem Vereinigten Königreich.
In den folgenden Kapiteln geht es daher zunächst darum, diese Entwicklung der einstigen britischen Vormachtstellung und deren langsame Auflösung bis zum ersten entscheidenden Punkt im Jahre 1956 nachzuzeichnen. Hernach wird sodann in einem Kapitel die Wirtschaft und Politik des Inselstaates bis zur großen Wende zum Neoliberalismus unter Premierministerin Margaret Thatcher in den achtziger Jahren zu untersuchen sein. Stand hinter dieser Wende doch der Versuch, den Abstieg der vorherigen Jahrzehnte mit Hilfe des Thatcherismus umzukehren. Wie sie es damals formulierte: England sollte nicht als eine »Museumsgesellschaft« weiterleben, sondern durch eine entschlossene Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft erneut zu den ersten Mächten der Welt zählen, auch wenn man nicht daran dachte, die erste Stelle einzunehmen wie im 19. Jahrhundert. Englands Großmachtstellung sollte diesmal durch eine »special relationship« mit den USA abgestützt werden. In diesen Kapiteln geht es somit um die Frage nach dem Erfolg des Thatcherismus in den neunziger Jahren bis hin zu den erneuten Problemen der Wirtschaft nach der Großen Depression von 2007/08 und dem Volksentscheid von 2016, die EU zu verlassen.
Die letzten beiden Kapitel analysieren sodann die mit der damaligen Wirtschaftskrise zusammenhängenden politischen Auseinandersetzungen unter Theresa May und Boris Johnson. Dabei geht es auch um eine kritische Prüfung der Verheißungen, die die Befürworter des Austritts aus der EU ihren Anhängern versprochen hatten. Denn was damals in der britischen Gesellschaft an die Oberfläche kam, waren nicht nur materielle Interessen und die Überzeugung, dass man mit dem Brexit wieder die Souveränität über das Land zurückgewinnen werde,3 sondern auch tiefer liegende Traditionen, Selbstverständnisse von nationaler Identität, die Steven Erlanger, den Leiter des Londoner Büros der New York Times, schon im Juni 2014 veranlassten, die »merkwürdige Identitätskrise« der Briten zu analysieren.4
Gute Beobachtungen enthielt auch im März 2019 ein Artikel von Sam Byers in der New York Times, in dem er ausführlicher beschrieb, wie Großbritannien in »Nostalgie ertrinke«.5 James Meek, Autor einer Essaysammlung mit dem Titel Dreams of Leaving and Remaining, definierte zur gleichen Zeit den britischen Seelenzustand als ein Sammelsurium von »unkritischem Patriotismus, Nativismus, Glauben an eine weiße, britische Vormacht, Furcht vor den Muslims, den Wunsch, Althergebrachtes zurückzuholen, die Suche nach Verrätern, eine Glaubensfestigkeit, die konkrete Nachweise übertrumpft, eine imperiale Ersatznostalgie, übertriebene Annahmen einer Begünstigung von Familien weißer Herrscher aus den früheren Kolonien, Skepsis gegenüber dem Klimawandel, ein Hoffen auf eine Rückkehr zu rassistischen und Geschlechterstereotypen von vor vierzig Jahren, die Überzeugung, dass ›Beamte‹ und ›korrupte, sich einmischende Bürokraten‹ ein und dasselbe seien [sowie schließlich] die Glorifizierung des britischen Militärs«.6 Winston Churchill, schon vor 1914 bis in die Zeit nach 1945 eine der Schlüsselfiguren in diesem Drama, meinte 1943 einmal mit Bezug auf die Langlebigkeit von Weltreichen: Selbst wenn sie in Wirklichkeit gar nicht mehr bestünden, dass diese in den Köpfen weiterlebten. Was er damit meinte, ist in Deutschland vielleicht am besten durch einen Hinweis auf 1989 und das Ende der DDR und des Sowjetblocks verständlich zu machen. Damals fiel zwar die Mauer in Berlin, aber in den Köpfen der Ostdeutschen lebte sie noch lange weiter, stellenweise gar bis auf den heutigen Tag.
Kurzum, im Großbritannien des »Brexit« mischten sich greifbare Erfahrungen der eigenen materiellen Lage nach den beiden von Deutschland begonnenen Weltkriegen, die sich infolge der neoliberalen Politik Thatchers objektiv weiter verschlechtert hatte, mit Emotionen und Selbsttäuschungen, die durch verantwortungslose Politiker und die sozialen Medien fortlaufend verstärkt wurden. Insgesamt geht es in diesem Buch daher nicht nur um die unmittelbaren Ursprünge und den Verlauf des »Brexit«, sondern gerade auch um dessen historische Wurzeln und schließlich um die Frage, ob Boris Johnson mit seiner Konservativen Parlamentsmehrheit in den nächsten Jahren eine wirtschaftliche und soziale Modernisierung erreichen kann, wie Margaret Thatcher sie in den achtziger Jahren versprochen hatte und Johnson sie 2019 erneut verkündete. Dabei wird es gerade auch um eine Analyse der Verhandlungen mit der EU gehen, die im März 2020 begannen und nach dem erfolgten Brexit eine Unzahl von Fragen im Verhältnis zu den europäischen Nachbarn neu regeln müssen. Nicht weniger schwierig werden sich für Johnson die Beziehungen zur nichteuropäischen Welt gestalten. Das Drama des Brexits ist also noch keineswegs zu Ende, gerade auch weil von einer Realisierung der von Johnson geweckten Erwartungen und Hoffnungen die Zukunft Großbritanniens als einer prosperierenden modernen Wirtschaft und Gesellschaft, sondern vielleicht sogar als einem »Vereinigten Königreich« abhängt.
1. Großbritannien vor und nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs
Betrachtet man die Weltpolitik und Weltwirtschaft nach der Niederlage Frankreichs in den Napoleonischen Kriegen und nach dem Wiener Friedensschluss von 1814/15, so kann kein Zweifel bestehen, dass Großbritannien damals im Konzert der Großmächte die Vormachtstellung errungen hatte. Als Queen Victoria 1837 den Thron bestieg und bis zu ihrem Tode 1901 als konstitutionelle Monarchin regierte, stand – wie der amerikanische Historiker William Burns es 2010 formulierte – das britische Weltreich mit seinen Kolonien und seinen Commonwealth-Ländern im Zenit seiner »Macht und seines Prestige«.1 Der britische Historiker Jeremy Black fügte diesem Urteil zwei Jahre später hinzu, das Land sei nicht nur zur »größten imperialen Macht in der Geschichte« aufgestiegen, sondern Zeitgenossen seien sich zugleich eines deutlichen Unterschieds zwischen dem Inselreich und seinen kontinentaleuropäischen Nachbarn bewusst gewesen.2 Wirtschaftliche Entwicklungen und der Aufstieg des Nationalismus hätten sodann diesen »Prozess der Divergenz« noch verschärft.
1.1 Großbritannien als erste Weltmacht des 19. Jahrhunderts
Bevor ich mich dieser Divergenz zuwende, die – wie in der Einleitung erwähnt – auch Widerspruch wachrief,3 soll es zuerst darum gehen, die britische Entwicklung zur Vormacht des 19. Jahrhunderts genauer zu untersuchen, gründete sich diese Stellung doch sowohl auf wirtschaftliche als auch auf machtpolitisch-militärstrategische Entwicklungen. Des Weiteren muss aber auch der aufkommende hegemoniale Druck Englands infolge technologischer und kultureller Faktoren betrachtet werden. Für die Ökonomie ist hervorzuheben, dass Großbritannien schon am Ende des 18. Jahrhundert zur ersten Industrienation aufgestiegen war. Diese Entwicklung fing zwar nicht sofort mit dem Wachstum von Fabriken und Fließbändern an. Strikt gesehen, gab es keine Industrielle Revolution, sondernschon im 18. Jahrhundert begann ein längerer Industrialisierungsprozess, der zunächst als eine außerhalb der Städte einsetzende »Protoindustrialisierung« in der Textilbranche begann.4 Es waren Dorfbewohner, die keine Höfe und kein Land geerbt hatten oder in England ihren Landbesitz im Zuge der Enclosure-Politik der Aristokratie zwangsweise verloren hatten und die sich nun in ihren Hütten der Heimarbeit und dem Weben und Spinnen von Wolle, Leinen und später auch von Baumwolle zuwandten. Die Rohstoffe für diese Tätigkeit wurden ihnen von sogenannten Verlegern in den Städten geliefert, die die fertigen Stoffe später gegen Bezahlung wieder annahmen und über ihre eigenen Handelsnetze regional, aber auch international verkauften.
Indessen erwies sich dieses Produktionssystem bald als allzu fragmentiert, unkontrollierbar und ineffizient. Es kam langsam zu einer Konzentration der verstreuten Heimarbeiter, die von den Verlegern und anderen Unternehmern unter einem größeren Dach in einer Fabrikhalle zusammengelegt wurden. Es setzte eine Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz ein, wodurch sich der Tageslauf der Arbeiter nicht nur zeitlich veränderte, sondern auch die Frauen- und Kinderarbeit neue, sehr viel hierarchischere und nach Geschlecht getrennte Formen annahm. Doch die markanteste Trennung, die sich mit dem Aufstieg dieser Fabrikproduktion verband, war die zwischen Unternehmern, die über Investitionskapital, Maschinen und Rohmaterialien verfügten, und denen, die für einen meist sehr geringen Lohn Textilien und andere Gebrauchsgüter und bald auch Metall- und Schmiedewaren herstellten. Vor allem die Lebensumstände der Arbeiter veränderten sich mit dem Durchbruch einer rationalisierten und auf Gewinn hin orientierten kapitalistischen Produktionsweise seitens der Eigentümer der Maschinen so drastisch, dass der britische Historiker Edward P. Thompson von einer Traumatisierung der Arbeiterschaften gesprochen hat.5 Diese unter der Armutsgrenze liegende Lebenslage der Arbeiter führte zu Solidarisierungsbewegungen und zur Konstituierung einer Arbeiterklasse, wie sie Mitte des 19. Jahrhunderts von Karl Marx und anderen Beobachtern sozialer Entwicklungen und Differenzierungen beschrieben wurden.6
Während sich diese Prozesse der Industrialisierung allmählich im Innern des Landes entfalteten, war Großbritannien inzwischen international zu einer Großmacht aufgestiegen. Diese bestand lange Zeit nicht in Form von überseeischem Territorialbesitz. Die Verleger und Handelshäuser zur Zeit der Protoindustrialisierung verließen sich auf einen »informellen Imperialismus«, dessen Befürwortern noch nicht an einer militärischen Besetzung außereuropäischer Gebiete gelegen war. Sofern London den Händlern den Schutz der Küstenstützpunkte in Afrika, Asien und Lateinamerika garantierte, konnten diese sodann ihre Geschäfte mit dem Hinterland entwickeln.7 Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Wettlauf zwischen den europäischen Großmächten um den Besitz von größeren Kolonien und der Dauerbesetzung weiter Landstriche in Übersee, als sich ein Handelskapitalismus und Fabrikproduktion langsam auch in West- und Zentraleuropa entwickelten. In diesem Wettbewerb unter den Nationen Europas entstand ein »formeller Imperialismus«, bei dem Großbritannien wie bei der vorherigen Industrialisierung schließlich am Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls den ersten Platz errang. Es entstand ein globales »British Empire«, in dem – wie es damals hieß – die Sonne nie unterging. Das »Juwel« dieses Kolonialreichs war der riesige indische Subkontinent, der schon früh zum offiziellen Herzstück des Empire gemacht wurde. Als London 1875 die Kontrolle über den Suez-Kanal übernahm, ging es nicht so sehr um den Einfluss über ein weiteres Kolonialgebiet im Niltal, sondern um die Sicherung des Kanals zum Schutze des nunmehr erheblich verkürzten Seeweges von Großbritannien nach Indien.
Indessen war auch von vornherein klar, dass solche militärischen Absicherungen nicht allein durch Landstreitkräfte erfolgen konnten. Es bedurfte einer Kriegsmarine, die stark genug war, nicht nur der Herausforderung einer anderen Großmacht auf hoher See begegnen zu können. Vielmehr führte England den berühmt-berüchtigten Two-Power-Standard ein. Das heißt, die Royal Navy musste stark genug sein, um den zwei nächststärksten Kriegsmarinen überlegen zu sein. Da das Empire eine weltweite Ausdehnung hatte, bedeutete dies zugleich, dass die Royal Navy auf allen Meeren einsatzfähig sein musste. Der zusätzliche Bonus des Two-Power-Standards war, dass man in London glaubte, nicht auf Bündnisse angewiesen zu sein, die die eigene Entscheidungsfreiheit begrenzten. Vielmehr konnte man Macht- und Wirtschaftspolitik aus der Position einer »Splendid Isolation« heraus betreiben.
Solche Vorstellungen von der Rolle Großbritanniens in der Weltwirtschaft und Weltpolitik hatten schließlich zur Folge, dass das Land auch auf dem Gebiet der Technologie und der Kultur zum Vorbild wurde. Soweit es die technischen Erfindungen betraf, ist gerade angesichts der heutigen Klagen der Amerikaner, China »stehle« den USA ihre Spitzentechnologien, festzuhalten, dass die Amerikaner Anfang des 19. Jahrhunderts die »Diebe« waren. Damals begann im Blackstone Valley nördlich von Providence in Rhode Island und in Massachusetts die protoindustrielle Produktion mit Webstuhltechnologien, die von amerikanischen Besuchern in Manchester und anderen britischen Textilzentren memoriert und dann in Neuengland nachgebaut wurden. Mit der Entwicklung der Dampfmaschine und dem Eisenbahnbau errang Großbritannien eine weitere Vorbildrolle beim Bau dieses modernen Transportmittels sowohl auf dem europäischen Kontinent als auch in den Vereinigten Staaten, bei der Besiedlung und landwirtschaftlichen Entwicklung des Mittelwestens und schließlich der Pazifikküste. Und von der Verbreitung der Eisenbahn lässt sich eine erste Brücke zwischen Technik und deren Einfluss auf das Schrumpfen von Entfernungen und auf das Erlebnis der Eisenbahnreise schlagen.
Der Berliner Kulturhistoriker Wolfgang Schivelbusch hat in einem immer noch lesenswerten Buch zur »Industrialisierung von Raum und Zeit« die Erlebnisse der Reisenden geschildert.8 Anstatt tagelanger Fahrten über holprige, ungepflasterte Wege kam jetzt die immer schnellere und viel bequemere Fahrt auf der Schiene. Wer wohlhabend genug war, konnte sich die gepolsterte Reise im ruhigen Erste-Klasse-Abteil leisten. In der dritten und vierten Klasse saß man dann viel billiger in offenen Wagen auf harten Holzbänken, umgeben von Marktfrauen, die ihre Hühner und Ferkel zusammen mit ihrem Obst und Gemüse in die nächste Stadt transportierten. Das Reisen und auch die Perzeption von Entfernungen veränderten sich fundamental.
Die nächste Revolution kam bald darauf, als die Erfindung und Verbreitung der elektrischen Glühbirne die Wachskerze verdrängten, während der Telegraph und Seekabel sowie schließlich das Telefon im Vergleich zur Briefpost sekundenschnelle Kommunikation ermöglichten.9 Auch auf diesen und vielen anderen Gebieten moderner Technik und der dahinterstehenden wissenschaftlichen Forschung war Großbritannien bis auf Weiteres der Schrittmacher für die übrige Welt. Das erforderte oft große und riskante Investitionen, bei deren Erfolg erhebliche finanzielle Gewinne winkten. Doch ist jenseits des wirtschaftlichen und machtpolitisch-militärischen Einflusses des Empire sowie der technischen Erfindungen fürs tägliche Leben auch der oft subtile Druck in Rechnung zu stellen, den die Anglophilie oder – wie der in Holland und Japan aufgewachsene amerikanische Historiker Ian Buruma es genannt hat – die Anglomanie auf die europäischen Nachbarn ausübte.10 Hamburg wurde im späten 19. Jahrhundert die »englischste Stadt« Deutschlands, wo man nicht nur englische Geselligkeit kopierte, sondern auch die neuen Sportarten wie Tennis, Feldhockey, Polo und Golf für die gehobenen Schichten importierte; die Unterschichten begeisterten sich für Fußball. Wer es sich leisten konnte, übernahm auch die Moden, bei den gutsituierten Hanseaten allem voran der bis auf den heutigen Tag getragene dunkelblaue Blazer mit grauen Hosen aus feinstem Kammgarn.
Allerdings wäre es irrführend zu meinen, dass diese kulturelle Anglisierung in allen Regionen der europäischen Nachbarländer einsetzte. Ob in Bayern oder in Holland, im Süden von Frankreich, Spanien oder Italien, die Ausstrahlungskraft englischer Kultur schwächte sich mit zunehmender Entfernung ab, auch weil die geschäftlichen Beziehungen und finanziellen Verflechtungen nicht so eng waren wie die mit den Hamburgern. Gleichwohl ist das Bestehen mancher Wahlverwandtschaften festzuhalten, die nicht nur infolge der Vorbildfunktion der damaligen ersten Industrie- und Seemacht Großbritannien entstanden, sondern auch aufgrund der Attraktivität des kulturellen Hegemonen, ohne dass einheimische Traditionen und Praktiken dadurch plattgewalzt wurden. Vielmehr entstanden jeweils unterschiedliche Mischungen aus einheimischen und importierten Elementen, die ohne die damalige Hegemonialstellung des Inselstaates nicht zu verstehen sind.
Mochten die Hamburger auch von England als Wirtschafts- und maritimer Macht sowie von dessen kulturellen Traditionen sowie dem Ideal des »gentleman« angezogen sein, man darf gleichwohl nicht vergessen, dass diese Beziehungen zugleich im Zeichen eines Zeitalters des Nationalismus und Imperialismus standen. Gerade weil sich Großbritannien als einer der ersten Nationalstaaten konstituiert hatte, die seit dem 17. Jahrhundert allmählich in Europa entstanden waren, ist es nicht verwunderlich, dass die Bewohner des Inselstaats einen patriotischen Stolz auf ihr Land entwickelten, der regionale Bewusstseinslagen etwa der Schotten oder Waliser zwar nicht ersetzte, aber doch ergänzte. Die Betonung lag auf »Englishness« und »Britishness«, die durch die Berührung mit und die wachsende Kenntnis über die europäischen Nachbarn und anderen Erdteilen Gestalt gewann. Im 19. Jahrhundert gab es außer vielen kleineren militärischen »Expeditionen« nur einen größeren militärischen Konflikt, den Krim-Krieg von 1854–1856, der Nationalgefühle verstärkte. Nachhaltiger war in dieser Beziehung die Expansion des britischen Kolonialreichs, die gerade auch mit dem Hinweis auf die Gewinne für das Mutterland gerechtfertigt wurde. Von diesen Besitzungen, so die Propaganda, profitierten nicht nur die Handelshäuser und Banken, sondern auch die Arbeiterklasse in den Städten, Industriegebieten und Häfen. Diese Argumentation erwies sich als so verführerisch, dass es sogar eine wachsende Anzahl von konservativen »Tories« gab, die der Arbeiterklasse angehörten und bei Wahlen anstelle der linken Arbeiterparteien die politische Rechte unterstützten.
Allerdings entstanden nationalistische Emotionen und Bewegungen ebenso in anderen Teilen Europas und der nichtwestlichen Welt. War dieser Nationalismus anfangs noch gegenüber anderen Gruppen und Ländern, die ihr Franzosentum oder Deutschtum über ihre gemeinsame Sprache und Geschichte definierten, relativ tolerant und pluralistisch, so entwickelte sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr ein Nationalismus, der sich exklusiv definierte, zunehmend intoleranter wurde und andere Nationen schließlich als Gegner betrachtete. Dieser Wandel führte fast unvermeidlich zu Rivalitäten und Hochwertigkeitskomplexen, die wiederum die politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen der inzwischen angewachsenen Zahl der Nationen verstärkten. Im Zuge des schon erwähnten Wettlaufs um Kolonien, der im späten 19. Jahrhundert voll einsetzte, kam es zunehmend auch dort zu Konflikten, bei denen eine kriegerische Auseinandersetzung gelegentlich erst in letzte Minute vermieden werden konnte. Dies war zum Beispiel während der Faschoda-Krise von 1898 der Fall, als ein gefährlicher Zusammenstoß zwischen britischen und französischen Truppen im Sudan gerade noch verhindert wurde.11
1.2 Die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland als Herausforderer des britischen Empire
Indessen ging es bei den kolonialen Rivalitäten am Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur um die militärische Beherrschung dieser oder jener Region in Afrika oder Asien. Die britische Hegemonialstellung und ihr Anspruch, den ersten Platz unter den Großmächten einzunehmen, kamen infolge von tiefer liegenden Veränderungen unter Druck. Die Wurzeln lagen vor allem in dem sich damals vollziehenden Aufstieg von Neulingen, die eigene Industrien aufbauten sich ebenfalls auf die Suche nach Märkten zum Absatz ihrer Erzeugnisse und den Erwerb von Rohstoffen begaben, die sie zur Verarbeitung benötigten. Die Vereinigten Staaten und das 1871 gegründete Deutsche Reich traten jetzt als Konkurrenten Großbritanniens auf. Mehr noch als die anderen europäischen Großmächte waren es diese beiden Nationalstaaten, die London den ersten Platz in der Welt streitig zu machen begannen.
Betrachtet man als erstes die USA unter diesem Blickwinkel, so lässt sich auf der anderen Seite des Atlantiks ein erstaunlicher Wandel feststellen. Aus einer einstigen Einwanderer- und Siedlergesellschaft war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein Land geworden, in dem zwar viele Amerikaner weiterhin in der Landwirtschaft tätig waren, inzwischen aber auch größere Bevölkerungsteile in den Städten und Großstädten in Industrie- und Handelsunternehmen arbeiteten. Während in den USA viele Männer und Frauen wie schon zu Beginn des Jahrhunderts ihr Brot weiterhin in der protoindustriellen Textil- und Rohstoffindustrie verdienten, hatten mehr und mehr Menschen – und gerade auch die Einwanderer – in damals ganz neuen Industriezweigen Beschäftigung gefunden. Dazu gehörten zum einen die metallverarbeitenden Unternehmen, in denen Eisen und Stahl zu Blechen verwalzt oder zu Maschinenteilen gegossen und gefräst wurden. Bis zum Ende des Jahrhunderts hatten auch die Elektro- und Chemieunternehmen Amerikas an Bedeutung gewonnen, deren Erzeugnisse zunehmend mit den britischen in den Midlands und weiter nördlich mit den Manufakturzentren von Sheffield und Manchester konkurrierten.
Ein weiterer Vorteil der USA ergab sich aus der Größe des einheimischen Marktes, der den Zusammenschluss zu großen Firmeneinheiten förderte. Allerdings hatte die Konzentrationsbewegung schon zuvor in der Landwirtschaft begonnen, wo große Unternehmen entstanden, die den Landwirten Getreide und andere Produkte abkauften, sie lagerten und sie dann in die schnell wachsenden urbanen Zentren der Ostküste, aber auch an europäische Nationen, voran Großbritannien, lieferten, die auf Importe zur Ernährung ihrer ebenfalls expandierenden Bevölkerungen angewiesen waren. Mochten die Preise, die Großlager- und Handelsunternehmen wie Arthur, Daniels, Midland für Getreidelieferungen aus ihren Lagern verlangten, auch an der Nachfrage orientiert sein, sie benutzten ihre wirtschaftliche Macht gegenüber den kleinen Produzenten, um die Abnahmepreise zu drücken. Das schuf Ressentiments und Widerstand, die sich durch die langsame Expansion des Wahlrechts zu artikulieren und zu mobilisieren begannen. Wie W. A. Peffer, der Redakteur des Kansas Farmer, es damals formulierte, waren die Großhändler »alles Bösewichte, allesamt«, die es verdienten, nach den Gesetzen des Volkes bestraft zu werden, die sie einfach ignorierten.12 Er verlangte Fairness und Gerechtigkeit, denn beides mache die »Grundlage einer modernen Zivilisation« aus.
Bald schon konnten die Lokalpolitiker in den agrarischen Regionen die Proteste nicht mehr ignorieren, wenn sie wiedergewählt werden wollten. Bis zu den 1880ern entstand gar eine »Anti-Monopol-Partei«, auf die die etablierten Republikaner und Demokraten in den Wahlen von 1884 reagierten, indem sie ebenfalls Maßnahmen gegen Monopolisten versprachen. Dainzwischen auch in der Industrie ähnliche Konzentrationsbewegungen wie in der Landwirtschaft eingesetzt hatten und große Konzerne entstanden waren, fand sich im US-Kongress in Washington 1890 schließlich eine große Mehrheit von Abgeordneten und Senatoren, die den sogenannten Sherman Act verabschiedete. Durch dieses Gesetz wurden nicht nur Monopole in allen Wirtschaftszweigen verboten, sondern auch Kartelle, d. h. vertraglich abgesicherte Absprachen über Produktionsquoten oder Preise unter an sich selbständigen Firmen. Dieses Gesetz sollte den Wettbewerb am Markt sichern und das Entstehen von markbeherrschenden Unternehmen verhindern. Dies hieß jedoch nicht, dass der amerikanische Kapitalismus hinfort aus einer Vielzahl von kleinen und mittleren Industrie-, Handels- und Bankunternehmen bestand. Obwohl auch solche Firmen weiterhin im Markt tätig waren, insgesamt wurde die amerikanische Wirtschaft durch den Sherman Act in eine Richtung gedrängt, in der die Großunternehmen als Oligopole miteinander konkurrierten und auf diese Weise eine monopolistisch-einseitige Benachteiligung des Verbrauchers zumindest verboten und gedämpft wurde. Als Beispiel sei hier der Automobilmarkt genannt, in dem es um die Jahrhundertwende zahlreiche weniger bekannte Marken und Modelle gab, aber zunehmend auch Großunternehmen wie Ford und General Motors, die untereinander konkurrierten, ohne die kleineren Werke sofort zu verdrängen. Ähnlich war es beim Aufstieg der Kaufhäuser, die nicht nur unter sich konkurrierten, sondern kleineren Geschäften weiterhin genügend Atemluft zur Weiterexistenz ließen.
Auf die langfristigen Folgen des amerikanischen Oligopolismus für die europäischen Volkswirtschaften und gerade auch auf die britische wird in Kapitel 2 ausführlicher einzugehen sein. Hier sind für die Zeit vor 1914 zuerst Großbritanniens Beziehungen zu den USA zu untersuchen, bevor ich auf die Beziehungen zu der anderen neuen Großmacht, zum Deutschen Reich, eingehe, das sich Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls zu einem dynamischen Industrieland entwickelt hatte. Es ist nicht verwunderlich, dass das angloamerikanische Verhältnis nach der Rebellion der Siedlerkolonien und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung am Ende des 18. Jahrhunderts jahrzehntelang sehr gespannt blieb und sich in London gelegentlich gar Stimmen erhoben, den Lauf der Geschichte wieder zurückzudrehen und die USA zu annektieren. Es folgten Jahrzehnte, in denen die Amerikaner zu sehr mit der Konsolidierung ihres politischen Systems und dem Wachstum ihrer Wirtschaft im Innern beschäftigt waren, als in Europa zu investieren.
Doch dann erschienen Washington und seine aufblühende Industrie gegen Ende des 19. Jahrhunderts doch auf der internationalen Bühne und machten wie die europäischen Nationen territoriale Ansprüche geltend. Dies geschah im Verfolg der 1823 von US-Präsident James Monroe formulierten und nach ihm benannten Doktrin, die nicht nur in Lateinamerika, sondern in Ostasien galt, wo man die Philippinen annektierte. Besonders US-Präsident Theodore Roosevelt war es, der imperialistische Ambitionen ganz offen verkündete und verwirklichte, unterstützt von Machtpolitikern im Kongress und von kommerziellen und industriellen Interessen, die ihre Positionen auf dem Binnenmarkt durch den Ausgriff nach Übersee zu verbessern hofften. Das führte zu Spannungen, die um die Jahrhundertwende in einem Konflikt darüber an die Oberfläche kamen, wer unter den Großmächten in Venezuela in der Vorderhand saß.13 Nicht weniger bezeichnend ist es allerdings, dass sich London in diesem Falle zurückzog. Dies hatte zur Folge, dass sich in den USA das Selbstbewusstsein ausbreitete, jetzt definitiv zu den Großmächten zu gehören. Mehr noch: Man glaubte fest daran, zu den aufsteigenden Nationen zu gehören, die Großbritannien früher oder später überholen und im Zuge einer »Amerikanisierung der Welt« die bisherige Hegemonialmacht England von ihrem ersten Platz verdrängen würden.
Im Jahre 1902 hatte der britische Journalist William Stead unter diesen Titel ein Buch mit dieser Zukunftsprognose für die USA veröffentlicht,14 das seither immer wieder als eine der ersten Stellungnahmen zu einem Prozess der Amerikanisierung angeführt worden ist, der schon vor 1914 zuerst West- und Zentraleuropa erfasste und nach 1945 um die ganze Welt lief. Doch wenn man sich jenseits des Buchtitels in Steads Text vertieft, wird deutlich, dass es ihm nicht so sehr um eine bevorstehende »Amerikanisierung der Welt« ging, sondern um den Abschluss eines angloamerikanischen Bündnisses. Seiner Meinung nach stand Großbritannien damals vor zwei Alternativen. Entweder das Land akzeptierte, dass die USA zum Gravitationszentrum der englischsprechenden Welt geworden waren und Großbritannien nunmehr auf den Status eines englischsprechenden Belgiens reduziert sei; oder England konnte sein Empire mit den Vereinigten Staaten verschmelzen. In diesem Falle würde das Land auf immer ein integraler Teil der größten aller Weltmächte sein – vorrangig auf den Meeren, aber auch unangreifbar zu Land. Man wäre, so Stead, der Furcht vor einem feindlichen Angriff enthoben und besitze die Fähigkeit, gemeinsam in allen Regionen der Erde Einfluss auszuüben.
In Erkenntnis der graduellen Schwächung der britischen Position empfahl Stead also eine Anlehnung an die USA. Zwar zeigte sich auch in den nächsten Jahren, dass Washington zumindest bis in den Weltkrieg hinein nicht bereit war, ein solches Bündnis einzugehen. Doch gab es jenseits des Atlantiks vor allem in Industriekreisen auch andere Stimmen, die Großbritannien als eine niedergehende Macht in der Weltpolitik und Weltwirtschaft ansahen. Steads pessimistische Urteile über die Zukunft des britischen Empire werden durch die Ansichten von Frank Vanderlip bestätigt, der 1901 in die National City Bank of New York (NCB) einstieg und an der Wall Street und in der internationalen Bankenwelt großes Ansehen errang.15 Bald nach seinem Eintritt in die NCB unternahm er eine ausgedehnte Europareise, um sich umfassend über die dortige wirtschaftliche Lage und das Geschäftsklima zu informieren. Während seine Eindrücke vor allem über Deutschland sogleich noch zu behandeln sein werden, sind an dieser Stelle die Notizen interessant, die er und sein Assistent über seinen Besuch in England anfertigten und in denen wiederholt auf den relativen Niedergang des Landes Bezug genommen wird. Besonders der Konservatismus seiner britischen Kollegen fiel Vanderlip ins Auge. So erwähnte er die Ablehnung eines modernen amerikanischen Aufzugssystems, obwohl es viel schneller arbeitete. Der Bankier fügte hinzu, dass man hieran ein britisches Vorurteil erkennen könne, das sich nun als Boomerang erweise und für die Zukunft Probleme schaffe. Er wies auch auf die rückständigen technischen Fachschulen hin, nahm allerdings die Ausbildungsstätten der Textilindustrie davon aus. Sie gehörten zwar zu den ältesten Unternehmen aus der Zeit der Ersten Industriellen Revolution; dennoch stünden sie immer noch auf dem gleichen Niveau wie die anderen in der Welt.
Auf die schlecht ausgebildeten britischen Arbeiter sowie ihre ärmlichen Lebensumstände zu sprechen kommend, wies Vanderlip auf ihren Alkoholismus sowie die gesamtgesellschaftlichen Klassenunterschiede hin. Er könne nicht sich nicht zurückhalten zu sagen, dass England eine Lektion von den USA oder Deutschland erhalten müsse. Bei der Suche nach Mitteln gegen die Arbeitskonflikte des Landes müsse man mehr in die technische Ausbildung investieren. Vanderlip glaubte, dass sich die Arbeitgeber vor den Gewerkschaften fürchteten, und kam am Ende zu dem Schluss, dass Großbritannien nicht mit Deutschland und den Vereinigten Staaten konkurrieren könne, wenn die Gewerkschaften ihre Politik nicht änderten und sich nicht zum Ziel setzten, englische Ungelernte sowie Facharbeiter zu den besten in der Welt zu machen. Suche man jedoch nach der eigentlichen Ursache für den Niedergang des Landes, so liege die Schuld nicht so sehr bei den Arbeitern als bei den Oberklassen. Vanderlip war schlicht der Meinung, dass die wirkliche Verantwortung für die mangelnde Ausbildung der Arbeiter bei denen liege, die darauf bestanden, dass die ärmeren Klassen keine Ausbildung brauchten. Britische Arbeiter lebten somit in einer Umwelt, in der sie kein Vertrauen in die Arbeitgeber hätten. Letztere seien bei der Einführung von Verbesserungen allzu phlegmatisch, auch wenn im Land insgesamt ein Wandel festzustellen sei. So wenig Vanderlip daher ein gänzlich negatives Urteil fällen wollte, seine positiven Vergleiche mit den USA waren ebenfalls etwas zu rosig ausgefallen. Denn in den USA war die Ausbeutung der Arbeiter ebenfalls groß, auch wenn die Unternehmer dynamischer und innovationsfreudiger waren. Hier wird man sagen können, dass Vanderlip unter »kognitiver Dissonanz« litt, soweit es das eigene Land betraf, indem er Mängel, die er nicht sehen wollte, einfach ignorierte.16
Stellen wir die Frage nach Vanderlips Eindrücken über das Deutsche Reich vor 1914, das er ebenfalls bereist hatte, so hatte er über dessen industrielle Entwicklung viel Positives zu berichten. Auch dort hatte nämlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ein bemerkenswerter Wandel stattgefunden. Vor allem die späten 1860er und die frühen 1870er brachten vor dem Hintergrund des Zusammenschlusses der zentraleuropäischen Regionen zuerst unter Preußens Führung im Norddeutschen Bund und 1871 mit der Gründung des Kaiserreichs ein rasches Wachstum von Industrie und Handel.17 Es gab dann zwar einige Jahre der Stockungen, die von den Unternehmern zum Teil als eine Depression perzipiert wurden. Doch bis zur Jahrhundertwende standen die Zeichen in der deutschen Wirtschaft insgesamt auf Wachstum. Im Rheinland und Ruhrgebiet entstand im Westen mit seiner Schwerindustrie das industrielle Herz des Landes. Aber auch im Süden und Südwesten dehnten sich sowohl die mittelständischen als auch die Großunternehmen der Zweiten Industriellen Revolution mit den Bereichen Chemie, Elektrotechnik und Maschinenbau aus. Berlin wuchs zu einem Industriezentrum heran, und auch Sachsen nahm an der wachsenden industriellen Prosperität teil. Hamburg und Bremen wurden zu Toren eines globalen Welthandels. Indessen sollte die Landwirtschaft nicht unterschätzt werden, und so ist Klaus Bade recht zu geben, wenn er – ähnlich wie in den USA – von einer graduellen Entwicklung »vom Agrarstaat mit starker Industrie zum Industriestaat mit starker agrarischer Basis« sprach.18
Diese Entwicklung spiegelte sich auf vielen Sektoren der Wirtschaft, von denen hier nur der Bedarf an Grundstoffen und Energie im Vergleich zu England und Amerika erwähnt werden soll. Lag die deutsche Steinkohlenförderung 1880 noch bei 47 Millionen Tonnen, so war sie bis 1913 auf 191 Millionen angestiegen und lag damit an dritter Stelle in der Welt hinter England und den USA. In der Eisen- und Stahlproduktion rückte Deutschland bis 1910 gar auf den zweiten Rang vor England und hinter Amerika. Rasant war auch der Aufschwung im Fahrzeugbau und in der Elektrotechnik. Hatte die Automobilindustrie noch 1907 an die 26.000 Personenkraftwagen und 1211 Lastwagen hergestellt, so waren es sieben Jahre später bereits 83.000 bzw. 9700. Besonders erfolgreich war das Gebiet der organischen Chemie, die damals eine führende Stellung auf dem Weltmarkt für Farbstoffe und Pharmazeutika errang. Insgesamt wurde das Land zu einer der größten Exportnationen, wodurch sich auch die Handelshäuser, Banken und Versicherungen weiter ausdehnen konnten. Mitte der 1880er hatte Großbritannien am Export von Industriegütern noch einen Anteil von 43 Prozent, der bis 1913 jedoch auf 32 Prozent fiel. Derweil war der Anteil der USA inzwischen von 6 Prozent auf 14 Prozent gestiegen, der des Deutschen Reiches von 16 Prozent auf 20 Prozent.
Frank Vanderlip hatte auf seiner Europareise daher nicht nur die britische, sondern auch die deutsche Wirtschaft genau beobachtet und erkannt, dass die amerikanische Industrie durchaus nicht überall an erster Stelle stand.19 Mit Ausnahme des Maschinenbaus war das Land in der Eisen- und Stahlproduktion den Deutschen nicht voraus. Letztere, so der New Yorker Bankier, seien besonders gut in der Metallverarbeitung. Die meisten chemischen Apparaturen, so fügte er hinzu, kämen aus Deutschland sowie fast alle komplexeren Chemikalien und Farbstoffe. Auch hatte er Krupp in Essen besucht, die die größte Firma ihrer Art in der Welt sei. Krupps Stahl sei einfach ausgezeichnet und daher auch in den USA so stark nachgefragt, dass selbst hohe Zölle keine Hürde für dessen Einfuhr seien.
Der Bankier stellte schließlich fest, dass die Europäer die amerikanische Industrie, deren Technologien und Produktionsmethoden zwar genau studierten; doch sah er in den deutschen Werkhallen auch viele einheimische Maschinen und arbeitssparende Produktionsmethoden. Insgesamt entdeckte er in seinen Gesprächen mit deutschen Industriellen vielerlei Wahlverwandtschaften bei amerikanischen und deutschen Einstellungen zu moderner Unternehmensführung, Arbeitsbeziehungen, Vermarktung und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Belegschaften. Das galt auch für die Ausbildungssysteme, die er in Deutschland im Gegensatz zu Großbritannien vorbildlich fand. Kurzum, im Vergleich zu den deutschen Unternehmern, mit denen Vanderlip sprach, befand er die Engländer bei der Einführung von Betriebsverbesserungen als »langsamer«. Da viele der britischen Unternehmer in Oxford oder Cambridge studiert hatten, fehlte ihnen auch ein Verständnis für den dauernden, durch die Wissenschaften angetriebenen Wandel und die Komplexitäten moderner Volkswirtschaften.
So erhellend Vanderlips vergleichende Reisebeobachtungen zu den deutschen und britischen Industriesystemen auch waren, er ging kaum darauf ein, dass jenseits des Wirtschaftlichen zwischen den drei Ländern erhebliche Unterschiede in ihren politischen Systemen bestanden, die für die Entwicklung der Weltwirtschaft und Weltpolitik bis 1914 letztlich noch wichtiger waren. Bekanntlich war in Nordamerika Ende des 18. Jahrhunderts eine republikanische Verfassung eingeführt worden, in der ein von den Wahlberechtigten auf vier Jahre gewählter Präsident zwar recht große Exekutivmacht besaß, die aber durch das Prinzip der Gewaltenteilung eingeschränkt war. Gesetze hatten nur dann Gültigkeit, wenn sie nicht nur vom Präsidenten unterzeichnet, sondern zuvor von den ebenfalls gewählten Mitgliedern des Senats einerseits und denen des Abgeordnetenhauses andererseits mehrheitlich ratifiziert worden waren. Als weiteres Verfassungsorgan gab es schließlich den Obersten Gerichtshof, der angerufen werden konnte, um über die Rechtmäßigkeit politischer Entscheidungen zu befinden. Großbritannien hatte sich derweil im 18. Jahrhundert zu einer konstitutionellen Monarchie entwickelt. Das gekrönte Oberhaupt hatte seine einstige Macht verloren. Sie lag jetzt beim Unterhaus mit seinen gewählten Abgeordneten und einem oligarchisch zusammengesetzten und bestimmten Oberhaus. Nach dem Prinzip des Mehrheitswahlrechts war im Prinzip sichergestellt, dass die Regierung, die vom Unterhaus bestimmt wurde, immer eine Mehrheit besaß, mit der (zumindest bis in die jüngste Zeit einer fortschreitenden Handlungsunfähigkeit des Parlaments als Entscheidungsgremium) Gesetze ratifiziert werden konnten.20
1.3 Monarchische Verfassung und maritime Machtpolitik im Deutschen Kaiserreich
Im Gegensatz zu den USA und Großbritannien war das Kaiserreich als Monarchie verfasst, in der ein nicht vom Volke gewählter Kaiser sehr breite Machtbefugnisse hatte. Er war nicht nur der Oberbefehlshaber der Armee und Kriegsmarine, sondern besaß auch das ausschließliche Recht, die Grundlinien der Außenpolitik zu bestimmen und außenpolitische Initiativen bis hin zur Kriegserklärung zu ergreifen. Auf diesen Gebieten war der Monarch in erster Linie von Beratern abhängig, die er höchstpersönlich bestimmen und entlassen konnte. Gleiches galt auch für die Reichsregierung, deren Mitglieder vom Willen des Monarchen abhängig waren. Soweit es die Innenpolitik betraf, war dessen Machtvollkommenheit zum einen durch einen Bundesrat eingeschränkt, in dem die Regierungen der monarchisch regierten Fürstenhäuser den Gesetzesinitiativen der Kaiserlichen Reichsregierung zustimmen mussten, bevor sie an einen aufgrund eines allgemeinen demokratischen Wahlrechts von allen deutschen Männern über 21 Jahre mehrheitlich gewählten Reichstag weitergereicht und verabschiedet wurden.
Für die weitere Entwicklung der Innenpolitik ist hier vorerst nur festzuhalten, dass dieses komplexe Verfassungssystem gegen 1914 in eine schwere Krise geriet. Denn mit dem Aufstieg der Sozialdemokratischen Partei, die im Zuge der Industrialisierung wachsende Zahlen von Arbeitern aus den großen Städten anzog, aber von einer Regierungsbeteiligung ganz bewusst ausgeschlossen wurde, war es immer schwieriger geworden, im Reichstag Gesetzesmehrheiten zu finden. Das wiederum verleitete die Reichsregierung dazu, auf dem Wege über eine nationalistische und imperialistische Außenpolitik unter bäuerlichen und bürgerlichen Wählern Begeisterung, aber auch Ängste wachzurufen, die diese Schichten in die Arme der Monarchie und des Status quo trieben. Mit anderen Worten, der Kaiser und seine Berater bemühten sich, mit dem Schwungrad der Außenpolitik die Gefahr einer innenpolitischen Paralyse des Verfassungssystems zu überwinden.
Damit ist jenseits der Wirtschaftsentwicklung der Brennpunkt auf die internationale Machtpolitik und die militärischen Strategien sowie die außenpolitischen Ambitionen der Großmächte vor 1914 gerichtet. Es entstand damals eine gefährliche Rüstungsdynamik, die schließlich im Ersten Weltkrieg endete. An dieser Eskalation hatten Wilhelm II. und seine Berater einen entscheidenden Anteil. Wie bereits erwähnt, hatte im späten 19. Jahrhundert der Wettlauf um den Erwerb von Kolonien vor allem in Afrika und Asien eingesetzt, an dem sich alle Großmächte, aber auch kleinere Staaten wie Belgien und Holland beteiligten, indem sie zum Teil riesige Territorien oft gegen den Widerstand der einheimischen und seit langem dort siedelnden Gesellschaften militärisch eroberten und Truppen sowie Verwaltungsbeamte vor Ort einsetzten. Es ist typisch, dass ein konservativer preußischer Großgrundbesitzer wie Reichskanzler Otto von Bismarck von dieser Entwicklung nicht begeistert war. Seine Landkarte – wie er einmal bemerkte – lag nicht in Afrika, sondern auf dem europäischen Kontinent. Doch wie in den anderen Nationen Europas war es jetzt vor allem das aufsteigende deutsche Wirtschaftsbürgertum, das im Zuge der Industrialisierung und des weltweiten Handels auf eine deutsche Beteiligung an der Eroberung von Kolonien drängte.
Nicht weniger wichtig war, dass sich Wilhelm II. bereits für den Erwerb von Kolonien begeistert hatte, als er noch Kronprinz war. Doch als nach dem Tod des alten Wilhelm I., der Bismarcks Ansichten zuneigte, sein Sohn Friedrich III. schon kurze Zeit nach der Thronbesteigung an Krebs starb, wurde Wilhelm II. 1890 König von Preußen und Deutscher Kaiser. Obwohl noch jung und unerfahren, aber auch von seinem Temperament und seiner Erziehung her für eine so machtvolle Stellung im Grunde ungeeignet, sah sich Wilhelm II. nach Bismarcks Entlassung als der Begründer und Förderer eines transnationalen Reiches, das sich mit den anderen Großmächten und vor allem mit Großbritannien und seinem Empire politisch-militärisch, wirtschaftlich und kulturell messen konnte. Ja, letztlich dachte dieser Kaiser sogar schon in den neunziger Jahren daran, die Hegemonialstellung der Engländer diplomatisch und sogar auch militärisch herauszufordern. Zwar waren am Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr viele Territorien zu erobern, doch rechnete man in Berlin mit dem Verfall der älteren spanischen und portugiesischen Weltreiche und folglich mit einer »Neuverteilung der Erde« im 20. Jahrhundert.
An dieser Neuverteilung wollte Wilhelm II. an prominenter Stelle beteiligt sein, glaubte aber, dass Großbritannien seiner Strategie im Wege stehen würde, wenn er sie am Verhandlungstisch mit den anderen Mächten vortrug. Um sich auch gegenüber London durchsetzen zu können, war für ihn und seine Berater daher ein militärischer Hebel erforderlich, der freilich nicht aus Landstreitkräften bestehen konnte. Für die Verwirklichung seiner überseeischen Ambitionen brauchte er Seestreitkräfte nicht nur, weil es um Besitzungen jenseits des europäischen Kontinents ging, sondern auch, weil die Engländer mit ihrer über Jahrzehnte aufgebauten Royal Navy über eine Kriegsmarine verfügten, mit der sie jederzeit und auf allen Weltmeeren eine Herausforderung Wilhelms II. annehmen und ihm eine empfindliche Niederlage beibringen konnten.
Doch dann ernannte Wilhelm II. 1897 einen Marineminister, Alfred (von) Tirpitz, der ihm einen langfristigen Plan zur Vergrößerung der Kriegsmarine, deren Oberbefehlshaber er nach der Reichsverfassung war, entwickelte.21 Diesem Kriegsschiffbauplan lag als erstes die Erkenntnis zugrunde, dass man den Engländern mit ihren vielen Kreuzern, die überall im Empire stationiert waren, nicht würde pari bieten können. Indessen hatte sich der Schiffsbau inzwischen so weiterentwickelt, dass man große Schlachtschiffe bauen konnte, die zwar langsamer und schwerfälliger waren als Kreuzer, diesen aber durch ihre stärkere Panzerung und großkalibrigeren Geschütze in einer Seeschlacht überlegen waren. Der daraus gezogene logische nächste Schritt des »Tirpitz-Plans« war, diese großen Schiffe nicht auf die Meere zu verteilen, sondern sie in der Nordsee direkt vor der Haustür Großbritanniens zu konzentrieren und damit das britische Mutterland unmittelbar zu bedrohen. Diese Schlachtflotte konnte dann – so die Kalkulation – als diplomatischer Hebel am Verhandlungstisch oder auch zu einer Schlacht in der Nordsee eingesetzt werden. Allerdings musste diese Flotte für den letzteren Fall stark genug sein, um die Royal Navy in der Nordsee besiegen zu können und damit das internationale Mächtegleichgewicht auf einen Schlag radikal gegen England und zu Gunsten des Kaiserreichs zu verschieben. Andernfalls blieb die Kaiserliche Flotte nicht mehr als ein leicht zu entlarvender Bluff.
Tirpitz errechnete nun, dass er für einen Sieg insgesamt 60 Schlachtschiffe benötigte, wobei er annahm, dass London eine ähnliche Anzahl von großen Schiffen einsetzen würde. Gleichwohl hoffte er, durch besseres Training der Besatzungen und andere Verbesserungen in der Nordsee-Schlacht ein taktisches Übergewicht gegenüber der Royal Navy zu erringen, deren Offizierskorps er für altmodisch und ineffizient hielt. Freilich konnten die 60 Schiffe nicht in kurzer Zeit auf Stapel gelegt werden. Dazu fehlten dem Kaiserreich die Werftkapazitäten. Zudem musste ein zu schneller Ausbau in London Verdacht erregen und den Bau von eigenen Schlachtschiffen auslösen. Darüber hinaus bestand die Gefahr, dass die Royal Navy ihre noch überlegene Flotte zu einem Präventivschlag gegen die entstehende Kaiserliche Marine mobilisieren würde. Das Vorbild und entsprechend das Schreckgespenst auf deutscher Seite war, dass die Engländer einen solchen Schlag 1807 gegen die schwächere und in Kopenhagen liegende dänische Flotte geführt hatten. Es galt also, den Tirpitz-Plan durch diese Gefahrenzone zu schleusen.
Es gab somit zwei gewichtige Gründe, die Endziele dieser letztlich gegen die erste Weltmacht gerichteten Seerüstungsstrategie geheim zu halten und den Ausbau in mehreren kleineren Schritten über einen Zeitraum von 20 Jahren zu verteilen. Das war auch aus finanziellen Gründen ratsam, da Steuererhöhungen im Bundesrat und Reichstag